Vorgestern Nacht hatte ich wieder eine Idee, wie ich mich sonst noch um den Schlaf bringen könnte. Job, Steuer, Rente, dafür lassen sich Schafe gut durchnummerieren. Unruhe bringt auch diese Vorahnung: irgendeinmal ist Nostalgie und es fehlen die alten Fotos. Bis jetzt haben wir noch kein Familienalbum, das einmal an unser kleines Glück erinnern könnte (und den ganzen Ärger sentimental unterbelichtet, den wir ja auch ständig haben). Es gibt keine Fotodokumentation von uns auf Analog, mit schönen Sätzen daneben („J kann jetzt schon Fahrrad fahren! Mai 2011“). Unser-Leben-in-Bildern-Problem scheint besonders vorm Einschlafen riesig, nicht überschaubar, es wird schon Jahre aufgeschoben.
Dabei bräuchte ich drei. Eins für uns. Eins für den Fünfjährigen, das er als Erwachsener einmal zufällig entdeckt in unserem Bücherregal, Inspiration für seinen Familienroman. Eins für den Professor, heute zwei Jahre alt, das er wieder einmal schaut, wenn er vielleicht 42 ist und an einem Abend ganz melancholisch. Nicht eins, keins. Stattdessen unzählige digitale Fotos. Seit meiner Minolta von 1995, die ich einem alten Mann in Köln abkaufte, seit der Minibildkamera von 2007, die 2008 kaputt ging, schießen wir ja vor allem Handyfotos. In den Jahren ist diese ganze Menge zusammen gekommen, die Fotos liegen in kryptisch benannten Dateien auf meinem alten Laptop und warten. Oft schlafe ich nicht, weil ich die Fotos nirgendwo sonst gesichert habe, mein Computer in die Jahre gekommen ist und ich mir das mit Dropbox oder anderen virtuellen Orten immer vornehme und immer überwältigt bin von der Aufgabe, die vor mir liegt.
Der Laptop von meinem Mann fiel neulich herunter. Fotos weg. Tränen sind wiederbringlich. Auf dem neuen sind jetzt die neuen Fotos von seinem IPhone, in kryptisch benannten Dateien, viele warten, andere haben weniger Ambition, man sieht es ihnen an.
Zuletzt war immer Verlass auf die eine Großmutter, sie macht zwar auch nur Aufnahmen mit diesem albernen Fotohandy der allerersten Generation, aber wir loben ihr fotografisches Auge und vermuten, sie klebt diese Bilder in ein Album und notiert vielleicht „Mmmm! Der Rharbarberkuchen war lecker, Juli 2012“. Alle Oma-Bilder lagern in einem Online-Fotoalbum der Großeltern, dessen Link ich immer verbummele. Auch die vom Großvater, er besitzt eine schöne Leica, die er neulich in einem Taxi liegen ließ, dabei ist Karlheinz der beste Fotograf. Seine alten Dias, die den Familienroman erzählen, irgendwo in Kisten.
Die Omafotos gerieten zuletzt sehr grünstichig; mein Fotoproblem hat viele Nuancen und diese Facette: Die Kita meint es gut, sie fotografiert manisch. Alle paar Monate fürchte ich mich aber, weil der berühmte Bilderstick die Runde macht. Ich fürchte Hunderte Schnappschüsse in 70er-Jahre-Kinderladen-Optik, man muss sich durchwühlen durch Geburtstage, Ausflüge, gemeinsames Backen, die eigenen Kinder suchen, vielleicht noch den einen Sandkastenfreund für den Tag, an dem der Autor in den Bildern Antworten auf seine Fragen sucht und der Professor vielleicht 42 ist und an einem Abend ganz melancholisch.
Jetzt kann ich wirklich nicht mehr schlafen. In drei Wochen fahren wir in die Sommerferien zu den Großeltern, also grünstichige Fotos, Handybilder, die Leica-Raritäten, die Versicherung vom Großvater hat ja ein Auge zugedrückt.
Einmal auf einem Fest hatte Karin ihre Canon dabei. Sie knipste ein Bild, das ich liebe, mein jüngster Sohn schaut so à la Familienroman in die Kamera, mein Mann schaut auch, der Große ist nicht im Bild, er schreibt sich dann später hinein.
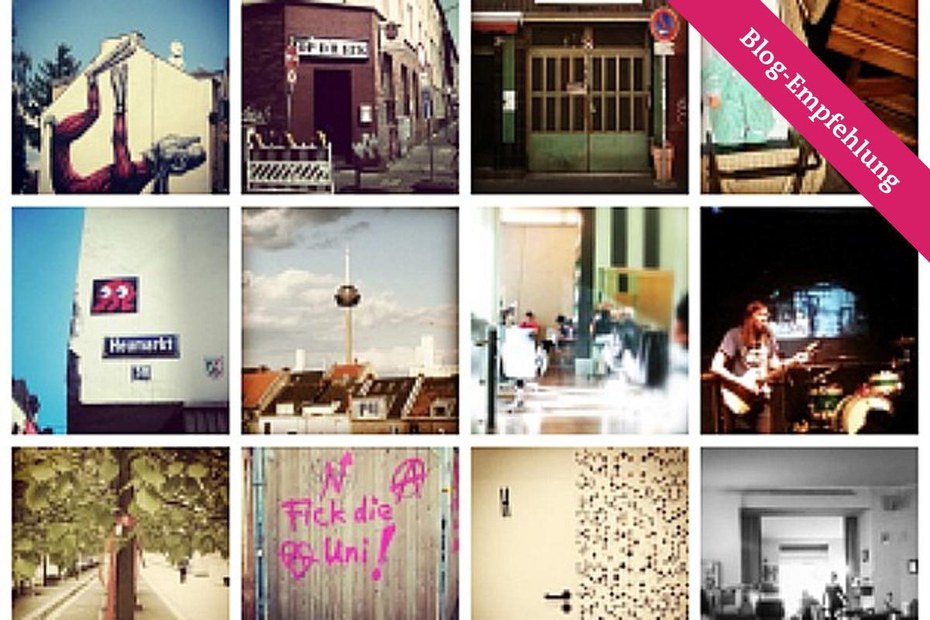





Was ist Ihre Meinung?
Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.