Amerikanische TV-Serien haben zumindest im deutschen Feuilleton begeisterte Fans. Mit Grund: Die deutsche Hausmannskost – insbesondere die staatliche Grundversorgung bei ARD und ZDF – feiert Triumphe allenfalls noch in punkto Biederkeit. Bestes Beispiel: das Renommier-Flaggschiff der Öffentlich-Rechtlichen, der »Tatort«. Folge: Gemäss dem Gesetz der kommunizierenden Röhren kommen die guten Stoffe schon seit längerem aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten, den USA. Ob »Sopranos«, »The Wire« oder das neue Serien-Highlight »Breaking Bad«: Das neue US-Erzählfernsehen hat sich längst als eigenständiges Medium etabliert – als zeitgemässes Format, um anspruchsvolle Geschichten zu schildern. Ein wesentliches Merkmal dabei: die ambivalenten Hauptfiguren und Handlungen. Nicht Gut und Böse sind im neuen Ami-TV gefragt. Sondern vielmehr die Wirklichkeit – beziehungsweise das unentdeckte Drama, das sich hinter selbiger verbirgt.
Authenzität statt Moral
Eine dieser neuen Serien ist das Biker-Melodram »Sons of Anarchy«. Wer »Sons of Anarchy« dechiffrieren will, findet in diesem Epos massig Stoff. Ebenso natürlich jene Moral überproduzierenden Zeitgenoss(inn)en, die das Genre insgesamt als brutal, frauenfeindlich, outlawverherrlichend und so weiter brandmarken bzw. am liebsten auf den Index setzen möchten. Drehbuchautor Kurt Sutter hat das Metier bereits in der Vorgängerserie »The Shield – Gesetz der Gewalt« ausgereizt – einer über sieben Staffeln erzählten Geschichte über eine Polizei-Spezialtruppe, deren Protagonisten Stück für Stück im metropolitanen Treibsand aus Verbrechen, Korruption und Gangkriminialität versinken. Den Hauptschauplatz von »Sons of Anarchy« hat Sutter in der nordkalifornischen Region um Oakland angesiedelt. Hauptschauplatz ist die fiktive Stadt Charming. Der Redwood Original-Ableger des Sons of Anarchy Motorcycle Club – abgekürzt SAMCRO – erscheint zu Serienbeginn als idealisierter Platzhalter für die Gründergeneration der Hells Angels Ende der Sechziger Jahre. Die Stimmung von »Wilde Engel«, »Easy Rider« und einem Hauch von Anarchie befördert auch der Soundtrack der Serie: Sixties pur – Rootsrock von Metallica, Creedence Clearwater Revival, viele Bob-Dylan-Coverstücke sowie ein paar neuere Singer-Songwriter.
Der Soundtrack fungiert innerhalb der Serie nicht nur als Stimmungsverstärker, sondern als Synonym. Die guten, alten Träume – von Liebe, Freiheit, von Selbstbestimmung, Brüderlichkeit und dem eigenen Weg, den jeder gehen muss – sie wollen nicht sterben, vergehen. Brothers – abgekürzt: Bro’s – sind vor allem Clay Morrow (Ron Perlman), der abhalfterte, mit allen Wassern gewaschene »Präsi« von Charmings Anarchiesöhnen sowie sein Stiefsohn, Clubvize Jax Teller (Charlie Hunnam). Der Grundplot nimmt auf die alten Hippieträume direkt Bezug. Jax’ Vater, auf nicht geklärte Weise bei einem Motorradunfall zu Tode gekommen, hat seinem Sohn ein Vermächtnis hinterlassen – ein Tagebuch, welches das Abdriften des Clubs in den organisierten Waffenhandel ebenso kritisiert wie die verlorengegangenen Ideale. Entlang der Achse Realität–Ideal positionieren sich auch die beiden Frauen-Hauptfiguren. Auf der Seite der Realität steht die Gang-Patriarchin: Biker-Queen Gemma Teller-Morrow (fulminant gespielt von Drehbuchautor Sutters Lebenspartnerin Katey Segal). Den Part der bürgerlichen Einsteigerin ins gesetzlose Rockerleben übernimmt Jax’ Geliebte und spätere Frau Tara Knowles (Maggie Stiff) – praktischerweise Ärztin im örtlichen Krankenhaus und für den Konflikt Geliebte–Schwiegermutter geradezu prädestiniert.
Der über bislang sechs Staffeln ausgetragene Grundkonflikt der Serie wurde vielerorts mit dem von Shakespeares »Hamlet« verglichen, beziehungsweise »Macbeth«, einem weiteren Shakespeare-Drama: Thronanwärter kontra König, Vater gegen Sohn. Ödipaler Mord und andere klassische Motive schwingen als Grundton in der Serie sicher mit. Bemerkenswert an »Sons of Anarchy« ist allerdings vor allem, mit welch rücksichtsloser Konsequenz Autor Sutter seine Helden – inklusive den handlungstragenden Personenbestand der Serie – zerlegt. Die erste, 2008 erstausgestrahlte Staffel, leistet das, was Pilotstaffeln gemeinhin leisten. Sie baut die wesentlichen Handlungsstränge auf, führt Grundkonflikte und Personal ein. Wozu im konkreten Fall auch eine Detailkartografie der unterschiedlichen MC-Chapter, ethnisch sortierten Streetgangs, Drogenkartelle und ermittelnden Polizeibehörden gehört. Die zweite, 2009 erstausgestrahlte Staffel vertieft den Plot der ersten und führt im Wesentlichen weitere Handlungsprotagonisten ein.
Essentielle, den Grundtenor verändernde Einschnitte markieren die dritte sowie fünfte Staffel. Die dritte, 2013 von deutschen Privatsender Kabel eins ausgestrahlt und handlungsmässig grossteils in der nordirischen Post-Bürgerkriegstristesse angesiedelt, führt ein neues Level von Härte in die Serie ein – von Erbitterung, mit der die Auseinandersetzungen zwischen den unterschiedlichen Fraktionen auf beiden Seiten des Gesetzes geführt werden. Die vierte (bislang nur in untertitelter Version erhältliche) Staffel schliesst daran an, vertieft darüber hinaus die Grundkonflikte zwischen Stiefvater und Sohn sowie den beiden beteiligten Frauen. Die Staffeln fünf und sechs schliesslich erweitern das Kampfterrain in fast jeder Beziehung – sowohl nach aussen als auch nach innen. Von Heldentum, von Romantik kann weit und breit keine Rede mehr sein. Die Szenerie ist geprägt von neuen Beteiligten (darunter der smarte White-Collar-Gangster Demon Pope sowie der – sympathisch gezeichnete – Escortservice-Betreiber Nero Padilla), und vom Kampf jeder gegen jeden. Sutter seziert seine Geschichte dabei buchstäblich mit dem Messer. Eine siebte, abschliessende Staffel der Serie ist zwar in Planung. Ob sie ausreichend Personal hinterlässt für eine weitere Fortsetzung, darf allerdings bezweifelt werden. Immerhin: Ein Prequel in Form einer Miniserie hat Kurt Sutter bereits in Aussicht gestellt.
Die Wiederkehr des White Trash
Helden mit Kippe im Mund auf der Harley, typische White-Trash-Thematik, Verherrlichung von Outlaw-Motorradclubs wie der Hells Angels oder Bandidos, das fragwürdige Verhältnis der Protagonisten zu Frauen – all das wurde in der (übrigens überwiegend positiven) Rezeption der Serie zur Sprache gebracht. All das mag stimmen – oder auch nicht. Auffällig sind die Parallelen zu einer anderen Ikone der modernen US-Film-Popkultur: dem Regisseur Quentin Tarrantino. Allerdings: Treffend ist der Vergleich allenfalls im oberflächlichen Sinn, in Bezug auf die Kubikliter Filmblut, die vergossen werden. Tarrantino – trotz »Inglourious Bastards« und »Django Unchained« – ist letzten Endes ein Postmoderner, ein Zyniker, ein Zitatfreak. »Sons of Anarchy«-Autor Kurt Sutter hingegen zelebriert letztlich das genaue Gegenteil. Sutter nimmt Geschichten und Personal seiner Serien ernst – blutig ernst sogar. SOA scheut nicht das Pathos; die melancholische Feuerzeug-Rockballade dient hier ebenso der Charakteruntermalung wie die zahlreichen ruhigen, den jeweiligen Stand der Figuren betonenden Szenen.
Sonstige Vergleiche? Wer den anspruchsvolleren, geschichtenerzählenden Teil der deutschen Serienproduktion verfolgt, wird sicher die beiden Highlights der letzten Jahre aufführen: Dominik Grafs Miniserie »Im Angesicht des Verbrechens« und die innovative, preisgekrönte ZDF-Serie »KDD«. Mit Blick aufs Kernland der neuen Serien-Erzählform lässt sich allerdings ein neuer Trend ausmachen: Die Themen des White Trash sind in die Popkultur zurückgekehrt. »Sons of Anarchy« ist letzten Endes nicht Tarrantino, auch nicht Graf-Roadmovie oder vergleichbar mit dem abgespeckten Stil von »Kriminaldauerdienst« (auch wenn diese Serie in manchen Momenten an die SOA-Vorgängerserie »The Shield« erinnert). Will man »Sons of Anarchy« historisch korrekt einordnen, ist vielleicht am ehesten der Vergleich mit den Italo-Western der Sechziger und Siebziger-Jahre angemessen. Auch sie inszenierten die Amoralität, den finalen Befreiungsschlag, den Bruch der Konvention, den Einzelnen und sein Weg. Darüber hinaus waren Django, Ringo & Konsorten bestes Popcorn-Kino – Befreiungsschläge nicht nur im Hinblick auf das Genre. Sondern – darüber hinaus – Befreiungsschläge im Rahmen einer Popkultur, die auf Aufbruch hin gebürstet war. Aufbruch zu neuen Ufern: Der Aufbruch der Sixties führte nicht nur zu Jimi Hendrix, Janis Joplin, den Stones und Grateful Dead. Der Kulturaufbruch verband sich ab Mitte des Jahrzehnts mit einem politischen Aufbruch – jenem Aufbruch, der rückblickend recht unterschiedliche Ergebnisse bescherte: mehr Zivilgesellschaft, mehr savoir vivre, mehr persönliche Freiheiten – aber auch eine neue Karrieristen-Generation, die sich in Form von Rot-Grün zu Anfang des neuen Jahrtausends manifestierte.
Was lehrt uns »Sons of Anarchy«? Zum einen ist SOA natürlich einfach eine saugute, atemberaubende, mit Genuss zu verfolgende Serie (vorausgesetzt, man bringt das nötige Faible für Noir-Stoffe und die damit verbundene härtere Gangart mit). Der Erfolg der Serie zeigt darüber hinaus, dass sich die Epoche saturierter Mittelstandsepigonen mit ihren Selbstfindungsproblemen (wie beispielsweise in »Sex in the City«) ihrem Ende zuneigt. Der White Trash (sicher nicht von ungefähr in der zugespitzten Form eines Bikerclubs) kehrt auf die Bühne zurück – ähnlich wie in den Filmstoffen der Sechziger und Siebziger. Gutverdauliche Epigonen, glatte Moral, unverbindliche Unterhaltung – das war gestern. Korreliert man den Erfolg von Italo-Western und aktuellen Serien auf die derzeitige politische Situation, könnte das hoffnungsfroh stimmen. Denn: Dem letzten politischen Aufbruch ging bekanntlich ein recht veritabler kulturell-subkultureller voraus.
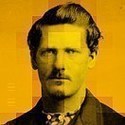




Was ist Ihre Meinung?
Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.