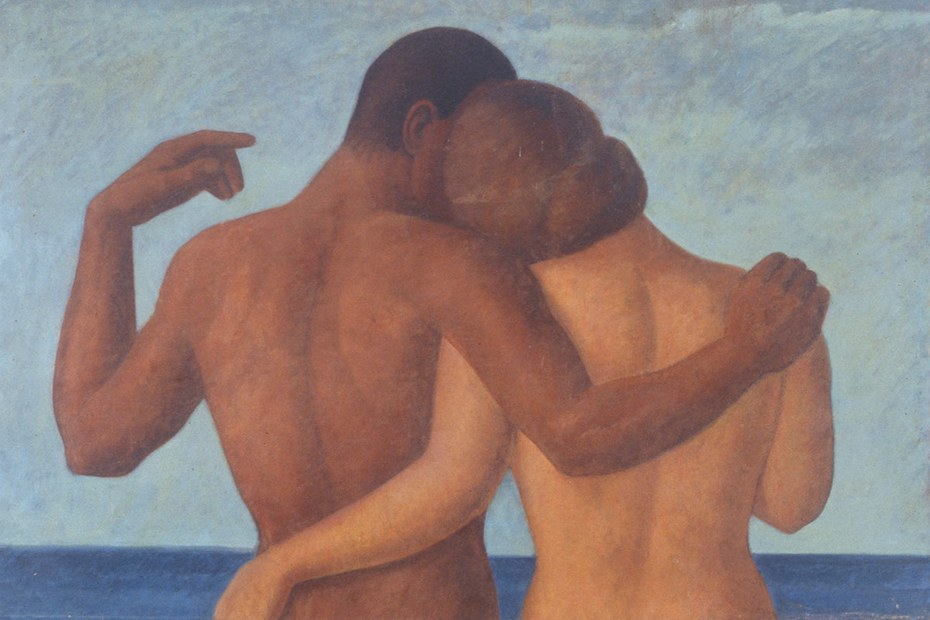Gab es ein Sexualleben im Paradies? Mit dieser überraschenden Frage beschäftigte sich der Theologe und Philosoph Augustinus von Hippo im vierten Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Seiner Ansicht nach waren die Lüste und Begierden im Paradies durchaus präsent, jedoch durch den Willen im Zaum gehalten. Erst mit dem Sündenfall überkam die Menschen ihre Sexualität unwillkürlich und unfreiwillig. Wenn Adam und Eva Scham empfanden, so nicht, weil sie plötzlich ihre nackten Körper wahrnahmen, sondern weil sie erkannten, dass ihre Sexualität nicht kontrollierbar war. Sie entdeckten die triebhafte Libido.
In seiner Lektüre des Augustinus bringt es Michel Foucault auf die Formulierung: Die Libido ist gegenüber dem Menschen das, was der M
was der Mensch gegenüber Gott ist, nämlich ein Rebell. Um Sexualität von nun an in den Griff zu bekommen, schreiben die Kirchenväter in den ersten Jahrhunderten nach Christus eine Reihe von Selbsttechniken vor. In Traktaten, Predigten und liturgischen Texten stellen sie Verhaltensregeln der Mäßigung und Selbstdisziplin auf, mit denen das Geschlechtsleben organisiert werden soll.Foucault hat diese Texte einer genauen Lektüre unterzogen, und zwar in dem gerade in Frankreich erschienenen Buch Les aveux de la chair (Die Geständnisse des Fleisches). Die Publikation des vierten und letzten Bandes seines groß angelegten Projekts Sexualität und Wahrheit 34 Jahre nach dem Tod des Autors ist ein Ereignis. Foucault schrieb seine Analysen der frühchristlichen Sexualethik zu Beginn der 1980er und reichte das Manuskript beim Verlag Gallimard ein. Dann jedoch unterbrach er den Veröffentlichungsprozess und wandte sich zunächst den beiden Bänden über die antiken Lebenstechniken zu, Der Gebrauch der Lüste und Die Sorge um sich, die 1984 erschienen. Kurz vor seinem Tod, auf dem Krankenbett, korrigierte er die Fahnen, doch über der Überarbeitung von Die Geständnisse des Fleisches verstarb Foucault am 25. Juni 1984. Seitdem stand dieser Text wie ein Gespenst im Raum, geheimnisvoll und unzugänglich. Denn Foucault hatte testamentarisch verfügt, dass es „keine posthume Veröffentlichung“ geben dürfe. „Macht nicht mit mir, was Max Brod mit Kafka gemacht hat“, soll er gesagt haben, womit er seine Nachlassverwalter in eine Aporie bugsierte. Schließlich verdankt sich die Rettung von Kafkas Werken Der Proceß, Das Schloss und Der Verschollene der Tatsache, dass sich Brod dem letztem Willen des Autors widersetzte. Ein Generationenwechsel bei den Foucault-Erben sorgt nun für eine etwas großzügigere Auslegung der Testamentsklausel und ermöglicht es, die Studie über die Geschichte der Sexualität posthum zu vervollständigen. Frédéric Gros hat die Ausgabe sorgfältig und umsichtig herausgegeben.Anders als der Titel vielleicht vermuten lässt, ist Die Geständnisse des Fleisches kein süffiges, sinnliches Buch. Foucault steigt umstandslos in die Lektüre der alten Texte ein, es gibt keine programmatische Einleitung wie in Die Ordnung der Dinge, keine erläuternden Bemerkungen über sein Projekt wie in den Vorlesungen am Collège de France, keine erzählerischen Passagen. Die rund vierhundert Seiten sind in ausnehmend nüchternem Stil gehalten. So erlaubt die Ausgabe inklusive vier Anhänge einen Blick über die Schulter des Historikers und „Archäologen“ Foucault und verdeutlicht seine Arbeit mit dem Material, das heißt Schriften von Clemens von Alexandria, Tertullian, Augustinus und anderen Theologen des zweiten bis vierten Jahrhunderts nach Christus. Die Kirchenväter behandeln darin Bedeutung und Herausforderung der Enthaltsamkeit, diskutieren das Ideal der Jungfräulichkeit und erkennen zugleich die Notwendigkeit des Geschlechtslebens an, das sie allerdings gänzlich in die legitime Ehe verlegen und dem Zweck der Zeugung von Nachkommen unterordnen. Auffällig daran ist, wie intensiv und explizit sich die frühen Christen mit Begierden und Lüsten auseinandersetzen. Foucault zufolge wird mit Fragen der Sexualität auf der diskursiven Ebene gerade nicht repressiv umgegangen.Frag nach bei KirchenväternDer Imperativ, über sich selbst und sein Inneres Rechenschaft abzulegen, dient aber dazu, den Sex sagbar zu machen und ihn damit zugleich einer ständigen Disziplinierung zu unterwerfen. Die ausführliche Thematisierung und Diskursivierung des Geschlechtslebens geht mit seiner Regulierung einher. Im ersten Kapitel „Die Herausbildung einer neuen Erfahrung“ zeigt Foucault, inwiefern die entstehende christliche Ethik in vielerlei Hinsicht an das Denken der griechisch-römischen Antike und ihre Praktiken der Askese und Selbstbeherrschung anschließt. Man findet bei den heidnischen und christlichen Autoren dieselben Verbote, Pflichten und sogar Referenzen auf die Natur und ihre Lektionen für ein ebenso maßvolles wie produktives Existieren. Die frühen Christen weisen den Lebensregeln jedoch eine religiöse Bedeutung zu und gehen zum ersten Mal von der Vorstellung eines inneren Kerns des Individuums aus, den es zu erkennen und über den es Geständnis abzulegen gilt.Foucaults Anliegen in diesem wie in seinen früheren Büchern ist es, die Herausbildung von Denkweisen und bestimmten Praktiken zu ergründen, die sich bis heute auf unsere Existenzformen auswirken. Es geht ihm darum, mithilfe der Geschichte die Gegenwart zu begreifen und kritisch in den Blick zu nehmen. Interessant und auch heute relevant wird Die Geständnisse des Fleisches gerade dort, wo Michel Foucault untersucht, wie im frühen Christentum das Verhältnis von Körper und Seele gefasst und wo dabei die Sexualität verortet wird. Ist sie rein körperlich beziehungsweise natürlich? Ist der Trieb der Schwäche der Seele geschuldet oder existiert die Libido, wie Augustinus schreibt, sui juris, also unabhängig und im eigenen Recht? Sind unsere Vorstellungen von Sexualität vor allem kulturell und durch die Einhegungen und Zwänge der Institutionen bestimmt? Die präzise Lektüre der Kirchenväter erlaubt es Foucault auf diese Weise nicht zuletzt, die für die Gender Studies so wichtige These der Konstruiertheit des Geschlechts genealogisch herzuleiten und ihre Bedingungen freizulegen. Seine Studie fügt zudem der aktuell viel diskutierten Frage nach der sexuellen Selbstbestimmung eine Dimension hinzu, indem er aufzeigt, wie komplex das Problem des freien Willens und sein Verhältnis zum Begehrensind.Mit ihrer ausgiebigen Thematisierung der Sexualität gestehen die Kirchenväter zu, dass die Libido macht, was sie will, und sich auch durch strenge Moral nicht gänzlich disziplinieren und bestimmen lässt. Sie muss deshalb nicht befreit werden, sie befreit sich selbst. Die Libido ist ein Rebell.Placeholder infobox-1Placeholder authorbio-1