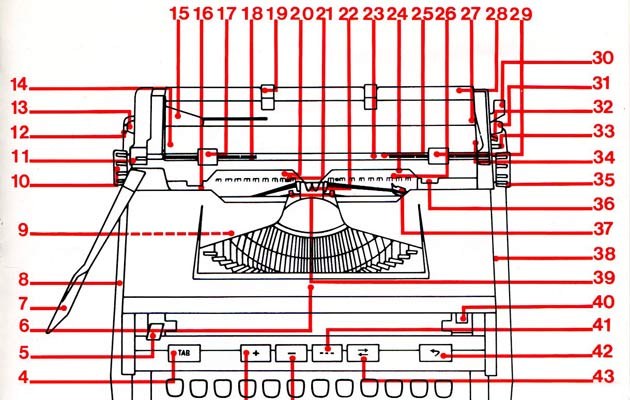Verständlich zu sein, ist nicht immer einfach. Dass es aber wichtiger wird, sich klar und deutlich auszudrücken, um seine Botschaft an den Mann zu bringen, wird allmählich mehr und mehr Behörden und Unternehmen bewusst. So gab die Deutsche Rentenversicherung am 15. Juni bekannt, dass sie den 20 Millionen Rentnerinnen und Rentnern zum 1. Juli 2012 kundenfreundlichere Rentenanpassungsmitteilungen schicken würde. Das sei das Ergebnis des Projekts „Bürgernahe Verwaltungssprache“. Die Mitteilungen seien sprachlich überarbeitet und neu gegliedert worden, um für die Adressaten nachvollziehbarer zu sein.
Doch nicht nur bei der Deutschen Rentenversicherung tut sich etwas. Auch das Düsseldorfer Versicherungsunternehmen Ergo hat die Problematik
oblematik für sich entdeckt. Am 20. Juni stellte sie in Berlin die Ergebnisse einer von ihr in Auftrag gegebenen Studie mit dem Titel „Was verstehen wir noch?“ vor. 2.600 Personen ab 18 Jahren wurden vom Meinungsforschungsinstitut forsa für die repräsentative Untersuchung befragt. Dabei kam heraus: Jeder Dritte trifft im Alltag häufig oder sehr häufig auf schwer verständliche Informationen.Ob Gebrauchsanweisungen, Produktinformationen, Vertragsunterlagen oder Geschäftsbedingungen – die Menschen nehmen das alltägliche Leben als immer komplizierter wahr. 79 Prozent der Deutschen, so das Resultat, stoßen auf schwer verständliche Informationen. Die Ursachen liegen hierfür in den oft langen Texten, die vor Fachbegriffen und Fremdwörtern strotzen. Torsten Oletzky, Vorstandsvorsitzender der Ergo Versicherungsgruppe AG, sagte, er sähe die Gründe dafür im Auslagern von Prozessen an Kunden wie etwa beim Fahrkartenkauf, in der Forderung der Politik nach mehr Eigenverantwortung und in den gestiegenen Erwartungen der Kunden an Transparenz.Unverständlichkeit ist allgegenwärtigEnde 2011 ermittelte forsa im Auftrag des Versicherers, wie die Verbraucher mit Informationen in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens zurechtkommen: Medizin, gesunde Ernährung, Steuern, Versicherungen, Mobilfunk, Stromversorgung und Geldanlagen. Beipackzettel von Arzneimitteln schneiden dabei am Besten ab. Dass diese jeder verstehen könne, meinen ein Drittel der Befragten. 26 Prozent halten Informationen auf Lebensmittelverpackungen für nachvollziehbar. Am Schlechtesten kommen Formulare und Erläuterungen für die Steuererklärung weg, die 35 Prozent als unverständlich empfinden. Etwas besser werden Produktinformationen von Banken (für 31 Prozent nicht verständlich) und Versicherungen (28 Prozent) beurteilt.Für das Verständnis spielen sowohl Alter als auch Geschlecht der Befragten eine wichtige Rolle. Jüngere Menschen haben weniger Schwierigkeiten als ältere. 39 Prozent der über 60-Jährigen begegnen häufig oder sehr häufig unverständliche Informationen im Alltag. Bei den 18- bis 29-Jährigen ist es nur jeder Fünfte. Unterschiede gibt es darüber hinaus zwischen Männern und Frauen. Vor allem bei Ernährung und Gesundheit geben Frauen häufiger als Männer an, genauer zu lesen. Während nur 21 Prozent aller Männer Informationen auf Lebensmittelverpackungen detailliert lesen, sind es bei den Frauen 38 Prozent, bei Arzneimitteln sind es 48 beziehungsweise 64 Prozent.Ein anderer Faktor ist Bildung. Menschen mit einem mittleren Abschluss, mit Abitur oder Studium treffen nach eigenen Aussagen seltener auf Informationen, die sie für nicht verständlich halten. Dagegen geben überdurchschnittlich viele Befragte mit Hauptschulabschluss an, dass sie häufig oder sehr häufig mit schwer Verständlichem konfrontiert sind. Überraschend ist jedoch, dass im konkreten Fall der Bildungsgrad bei der Frage, wer Unterlagen versteht, keine große Rolle spielt: So schätzen Befragte mit unterschiedlichen Bildungsabschlüssen Steuerunterlagen und Beipackzettel von Medikamenten ähnlich ein.Verbesserungen sind nicht leicht, aber machbarFür Anikar Haseloff, Kommunikationswissenschaftler an der Universität Hohenheim, sind unverständliche Informationen gerade aufgrund der zunehmenden Komplexität des Lebens kein Randgruppenproblem. „Es wird immer schwieriger, einfacher zu werden“, sagte er bei der Vorstellung der Studie. Der Forscher verwies angesichts des positiven Abschneidens der Beipackzettel auf die seit 2006 in der Pharmabranche durchgeführten Verständlichkeitstests. Er sprach davon, dass flächendeckende Prüfungen und Standardisierungen sehr wirksam seien könnten. Die Politik könne durch sinnvolle und durchdachte Regelungen eine deutliche Verbesserung erreichen. Aber auch die Unternehmen sollten Strategien entwickeln, durch eine andere, verständlichere Sprache näher an die Menschen heranzukommen. „Es ist nicht leicht, aber machbar“, sagte er.Angesprochen auf die beiden Skandale bei Ergo im vergangenen Jahr, sprach Oletzky davon, dass die Negativschlagzeilen sicherlich nicht dazu beigetragen hätten, das Image des Versicherers zu verbessern. 2011 war das Unternehmen in Misskredit gefallen, als im Mai und August herauskam, dass es 100 seiner Mitarbeiter eine Sex-Party in Budapest spendiert hatte und darüber hinaus Versicherungsvermittler offenbar überteuerte Einzelpolicen verkauft und dafür satte Provisionen eingestrichen hatten. Die vorliegende Studie kann man in diesem Zusammenhang daher auch als einen Versuch werten, verloren gegangenes Vertrauen wiederzugewinnen.