Nachdem bereits vor einer Weile Anna-Lena Scholz mit Thomas Kerstan in der ZEIT über die Frage stritt, ob es nun „Studenten“ oder „Studierende“ heißen sollte (DIE ZEIT Nr. 24/2016) und vor kurzem mit Jens Jessen ein alter, weißer Mann die Gelegenheit erhielt, seine irrationalen Ängste vor einem „totalitären“ Feminismus auszubreiten (DIE ZEIT Nr. 15/2018), inszeniert die Wochenzeitung erneut den Geschlechterkampf.
Dieses Mal (DIE ZEIT Nr. 23/2018) widmet sie das Titelthema der Debatte um eine geschlechtergerechte Sprache und stellt über dem Leitartikel im Feuilleton die Frage „Droht uns die Sprachzensur?“. Dazu dürfen sich eine Autorin (Marie Schmidt, Antwort: Nein!) und ein Autor (Ulrich Greiner, Antwort: Ja!) äußern. Während in Schmidts Text die meisten Argumente für ein bewusstes und angepasstes Sprechen bereits enthalten sind, darf mit Ulrich Greiner ein Autor, der in den letzten Jahren vor allem mit Büchern über einen gesellschaftlichen Schamverlust oder sein Outing als Konservativer in Erscheinung trat, die Gegenseite einnehmen und erneut die alten Begründungen und Beispiele abspielen, derer sich die Konservativen jedes Mal aufs Neue bedienen, um nicht von den gewohnten Strukturen abweichen zu müssen. Anscheinend ist es daher auch weiterhin notwendig, sich diese manchmal mehr meistens weniger einleuchtenden Rechtfertigungen genauer anzusehen.
Droht uns die Sprachzensur?
Zunächst soll allerdings kurz die Frage beantwortet werden, auf die sich Greiners Text bezieht: „Droht uns die Sprachzensur?“ Die Antwort darauf ist einfach, da es eine dämliche Suggestivfrage ist, die schnell beantwortet werden kann: Nein. Uns droht keine Sprachzensur.
Artikel 5 des Grundgesetzes besagt: „Eine Zensur findet nicht statt.“
Wer sich zensiert fühlt, darf dagegen klagen. Genau so ist es mit der Meinungsfreiheit, von der aktuell viele behaupten, sie existiere nicht mehr, um gleich im Anschluss Dinge zu sagen, die sie nur sagen dürfen, weil es eine Meinungsfreiheit gibt. Man darf sagen, was man möchte, das darf einem niemand verbieten – man muss allerdings mit Konsequenzen rechnen, zum Beispiel, wenn man mit dem, was man sagt, das Gesetz bricht. Womit die, die sich darüber beschweren, man dürfe ja heutzutage nichts mehr sagen, allerdings ein Problem haben, das ist die Tatsache, dass Meinungsfreiheit nicht bedeutet, dass Andere die Dinge, die man sagt, nicht kritisieren dürfen. Wer sich in die Öffentlichkeit stellt und Menschen beleidigt oder angreift, muss damit rechnen, dass diese Menschen sich angegriffen fühlen.
Wenn die ZEIT also unter dieser Frage schreibt: „Selbst die Duden-Redaktion streitet: Wie sinnvoll sind Binnen-I und Gendersternchen?“, so kann man auch hier nicht von einer Zensur sprechen. Der Duden gibt eine Empfehlung und bildet die Grundlage für unsere Rechtschreibung, er ist jedoch weder ein Gesetzestext noch zensiert er alternative Sprech- oder Schreibweisen. Niemand wird dadurch gezwungen, geschlechtergerecht zu sprechen. Wer sich einer Arbeitgeberin oder einem Arbeitgeber gegenüber vertraglich zu einem bestimmten Wording verpflichtet, wird dadurch trotzdem nicht zensiert. Eine Sprachzensur findet nicht statt.
Doch nun zu Greiner. „Gendergerechte Texte sind hässlich und voller Verrenkungen. Nur das bisherige Deutsch ist für alle verständlich“, behauptet Greiner in der Unterzeile, um im Anschluss daran auszuführen, warum es ihm zu mühsam ist, sich in seinem Alter sprachlich noch einmal anzupassen. Schauen wir uns im Folgenden aber einmal die Argumente an, die Greiner vorbringt, um seinen Standpunkt zu untermauern.
1. Nur das bisherige Deutsch ist für alle verständlich
Greiner bleibt leider eine Antwort auf die Frage schuldig, wann für ihn dieses „bisherige“ Deutsch anfängt bzw. wann es endet. Ein bisheriges Deutsch gibt es nicht, weil sich Sprache ständig verändert, anpasst und wächst. Wenn sie, wie Greiner behauptet, einem „vegetativen Nervensystem“ gleiche, „das sich gegen externe Anweisungen sträubt“, dann wäre sie ein ziemlich flexibles Nervensystem, das sich, wenn einem Neuerungen der Sprache gefallen, erstaunlich schnell anpassen kann. Ob für Greiner auch das Mittelhochdeutsche zum bisherigen Deutsch zählt, oder ob zum Beispiel Anglizismen in Ordnung sind, Frauen ebenso wie Männer anzusprechen aber nicht, das sagt er nicht. Greiners Vorstellung von einem bisherigen Deutsch ist lediglich das Deutsch, das ihm vertraut ist und in dem er sich wohlfühlt. Alternativen lässt er nicht gelten.
2. Die Genera des Deutschen machen seinen besonderen Reichtum aus
Niemand und auch nicht die gendergerechte Sprache möchte die grammatikalischen Geschlechter der deutschen Sprache abschaffen. Das ist ungefähr so falsch wie zu behaupten, Feministinnen würden einen Salzsteuer nun „Salzstreuerin“ nennen wollen. Einen satirischen Antrag der Linksfraktion im Flensburger Stadtrat erwähnt Greiner aber trotzdem, um zu zeigen wie weit die Unterstützer*innen dieser „neuen“ Sprache gehen wollen. Dass Satire nicht ernst gemeint ist (er nennt den Antrag „humoristisch“), vergisst er anscheinend. Stattdessen bemüht er die Lyrik, um zu zeigen, dass die grammatikalischen Geschlechter eines Fichtenbaumes und einer Palme in einem Heine-Gedicht eine erotische Spannung erzeugen, die in der englischen Übersetzung, in der beide zu einem „it“ werden, verloren gehe. Warum diese erotische Spannung nicht aufrechterhalten werden kann, wenn ein grammatikalisch neutraler Baum von einem anderen grammatikalisch neutralen Baum träumt, oder zum Beispiel auch entstehen könnte, wenn DER Fichtenbaum lediglich als DIE Fichte benannt würde und von DEM Palmenbaum träumte, auch das erklärt er nicht. Literarisch-ästhetische Texte werden stets subjektiv erfasst und Greiner kann sich in seiner Rezeption offensichtlich nicht über seinen heteronormativen Horizont hinausbewegen. Er ist studierter Germanist und Literaturkritiker. Gerade ihm müsste bewusst sein, dass insbesondere die Literatur stetig um die Erneuerung und Veränderung der Sprache bemüht und an ihr beteiligt ist. Sie geht über die „bisherige“ Sprache hinaus und ist ein ständiges Experimentierfeld. Genau das macht zumindest einen ihrer Reize aus.
In der Diskussion um eine geschlechtergerechte Sprache geht es aber eben nicht um Literatur, sondern um die Ansprache von gesellschaftlichen Subjekten. Wer sich von einem Buch nicht angesprochen fühlt, kann es weglegen. Wer sich jedoch von Gesetzestexten oder Verträgen nicht angesprochen fühlt, kann diese nicht einfach ignorieren. Auch sein Hinweis darauf, dass man Dinge nicht gendern könne, führt hier nicht weiter. Dinge müssen auch nicht als Subjekt angesprochen werden.
3. Wenn man „zum Bäcker“ oder „zum Friseur“ geht, sind Frauen mitgemeint
Greiner behauptet, niemand würde „Bürgermeisterinzimmer“ oder gar „Bürgerinnen- und Bürgermeisterzimmer“ sagen wollen (ist seiner Ansicht nach „Bürgerinnenmeister“ die korrekte Form?) und auch, wenn man zu einer Bäckerin oder einer Friseurin gehe, würde man ja doch sagen, man gehe „zum Bäcker“ oder „zum Friseur“. In all diesen Fällen seien Frauen „selbstverständlich mitgemeint“.
Merkwürdig, dass fast immer nur Männer behaupten, Frauen seien ja schließlich mitgemeint. Gegen diese Behauptung, dass Frauen sich mitgemeint fühlen, bringt nicht nur Marie Schmidt gute Argumente gegen Greiner vor, es haben nach dem BGH-Urteil gegen Marlies Krämer in den letzten Monaten auch genug andere Frauen darüber geschrieben, dass sie sich eben nicht mitgemeint fühlen. Es soll sogar Menschen geben, die sagen, dass sie zu ihrer Bäckerin oder ihrer Friseurin gehen. Das wäre für Greiner jedoch ein „konkreter“ und kein allgemeiner Fall. Linguistische Studien darüber, wie z.B. eine Berufsgruppe wahrgenommen wird, wenn sie stets im generischen Maskulinum benannt wird, sind Greiner aber nicht wichtig. Eine Veränderung von Benennungen führe für ihn allerdings nicht nur zu „unschönen Umständlichkeiten“, sondern unterminiere unser Sprachsystem. Als Gegenbeispiele führt er ausschließlich Alternativen ohne Binnen-i oder anderweitig gegenderte Sprache in allgemeinen Aussagen an und Sprachregelungen wie die der Universität Leipzig, die nun das generische Femininum verwendet, sind für ihn „Absurditäten“. Dabei wäre er als Mann doch auch mitgemeint. Oder nicht?
4. Wo sollen wir mit allen anderen hin? Müssen wir nun auch Tiere gendern?
Greiner benutzt nun ein weiteres beliebtes Argument gegen das Gendern: Aha! Angeblich gibt es ja jetzt ganz viele Gender! Was ist denn mit allen anderen? Wo soll das bitte enden? Was ist mit LSBTTIQ? Nicht nur scheint er zu vergessen, dass auch viele lesbische, schwule oder bisexuelle Menschen sich durch maskuline oder feminine Formen angesprochen fühlen und das insbesondere die gendergerechte Sprache bemüht ist, durch neue Vorschläge – sei es nun ein Asterisk, ein Unterstrich oder gar ein x, die durch die auffällige Veränderung oder die Leerstelle versuchen darauf hinzuweisen, dass sich möglichst alle angesprochen fühlen sollen – über eine binäre Opposition der Geschlechter hinauszugehen, er geht auch noch einen Schritt weiter: „Sprache ist nicht gerecht. Wenn jemand glaubt, dass Tiere ähnliche Rechte haben wie Menschen, dann wird er um Reformen nicht herumkommen. Hat das Schwein es verdient, dass es bloß ein Neutrum ist?“.
Spätestens hier klingt er wie Ultrakonservative, die bei einer Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe befürchteten, dass nun bald auch Ehen zwischen Tieren und Menschen geschlossen werden würden. Jetzt mal ehrlich, wer bei dem Vorschlag, dass man ja auch z.B. Frauen in Verträgen ansprechen könnte, befürchtet, nun müsse man sicherlich bald auch Tiere ansprechen, scheint eher ein Problem damit zu haben, Frauen als Menschen anzusehen.
5. Gendergerechte Texte sind nicht lesbar
Für seine These, dass gendergerechte Texte weder lesbar noch sprechbar seien, reiht sich auch Greiner in die Reihe derer ein, die Schreiben universitärer Fachschaftsinitiativen oder AGs zitieren, um zu zeigen, wie unmöglich diese zu lesen seien. Es stimmt. Diese Texte, die so peinlich genau um die korrekte Ansprache und um Inklusion bemüht sind, sind schwer lesbar. Aber sie finden an einem bestimmten Ort statt, an dem neue Sprache ausprobiert wird und der nicht der Öffentlichkeit entspricht. Natürlich will das, was an Universitäten geforscht wird, „ans Licht der Öffentlichkeit“, aber nicht jeder Vorschlag bewährt sich oder setzt sich durch. Vieles bleibt ein Experiment oder einem bestimmten Kreis vorbehalten. Für bestimmte Texte oder eine bestimmte wissenschaftliche Arbeit kann eine spezifische Sprache sehr nützlich sein. Trotzdem spricht niemand im Alltag konstant in verschwurbeltem poststrukturalistischen Jargon. Auch Gesetztestexte oder Verträge sind oft unlesbar oder schwer verständlich und uns gelingt es trotzdem, sie umzusetzen oder sie zumindest meistens als eine ganz gute Sache zu akzeptieren. Greiner stellt sich die universitäre Sprache aber als eine Flutwelle vor, die staatliche Stellen und Medien erfassen und mit dem „Furor des korrigierenden Verdachts“ der „Verhässlichung“ anheimfallen lassen wird.
6. Würden Frauen höher geachtet, besser bezahlt und seltener misshandelt, wenn wir eine gendergerechte Sprache hätten?
„Sprache ist nicht gerecht.“ Das erkennt auch Greiner. Statt daran etwas zu ändern, schlägt er jedoch vor, sich lieber auf dieser Ungerechtigkeit auszuruhen, denn „je länger man misstrauisch und verdachtsgeladen in dieser ungerechten Sprachwelt herumstochert, umso mehr Ungerechtes findet man darin.“ Seiner Ansicht nach sollten wir die Dinge also lieber belassen, wie sie sind, statt Menschen wie ihn zu verdächtigen, sie würden mit ihrem Sprechen Ungerechtigkeiten reproduzieren.
Für seinen Schluss findet Greiner ausgehend von dieser Ansicht dann noch einen erstaunlichen Vergleich, den andere vielleicht als plumpen Whataboutism bezeichneten: „Würden die Frauen in diesem Land höher geachtet, besser bezahlt und seltener misshandelt, wenn wir eine ‚gendergerechte’ Sprache hätten? Der Kinderbuchstreit hat gezeigt, wie leicht es ist, Astrid Lindgrens ‚N-Wort-prinzessin’ [schreibt er aus] (Pipi Langstrumpf) oder Michael Endes ‚kleinen N-Wort’ [schreibt er auch aus] (Jim Knopf) zu entfernen. Davon ist der Rassismus mit Sicherheit nicht weniger geworden.“
Das ist ein bisschen so als sage man: Nur, weil in den USA die Sklaverei abgeschafft wurde, ist der Rassismus nicht verschwunden. Und der nächste logische Schritt wäre dann zu sagen: Also hätte die Sklaverei nicht abgeschafft werden sollen. Davon einmal abgesehen, dass es Greiner anscheinend trotz dieser „Entfernung“ immer noch möglich ist, dieses Wort in einer großen deutschen Zeitung zu schreiben.
Sicherlich würden Frauen nicht automatisch und sofort besser bezahlt oder höher geachtet, wenn wir überall eine gendergerechte Sprache hätten. Sie würde aber dazu führen, dass man sie eher als gleichberechtigtes und ebenso angesprochenes Gegenüber wahrnimmt und daher vielleicht auch eher bereit wäre, sie besser zu bezahlen oder überhaupt öfter als Subjekt und seltener als Objekt wahrzunehmen. Eine Ungerechtigkeit zu beseitigen, löst nicht alle Ungerechtigkeiten. Es ist aber ein denkbar schlechtes Argument zu behaupten, man müsse deswegen diese Ungerechtigkeit als notwendiges Übel akzeptieren.
So bleibt Greiners Plädoyer für das „bisherige Deutsch“ nur der verzweifelte Versuch eines mit den Jahren konservativ gewordenen Mannes, sich an den ihm bekannten Strukturen festzuklammern, weil alles Neue ihm Angst macht. Ein bisschen möchte man ihn in den Arm nehmen und ihn damit trösten, dass die Welt nicht untergehen wird, nur weil sich Sprache verändert und anpasst.
Konservative sind zähe Gebilde. Sie gleichen einem vegetativen Nervensystem, das sich gegen externe Anweisungen sträubt. Trotzdem haben sich auch Lebewesen mit vegetativen Nervensystemen immer wieder verändert, um überleben zu können.
Was sich nicht anpasst, stirbt aus. The Times They Are a-Changin'.
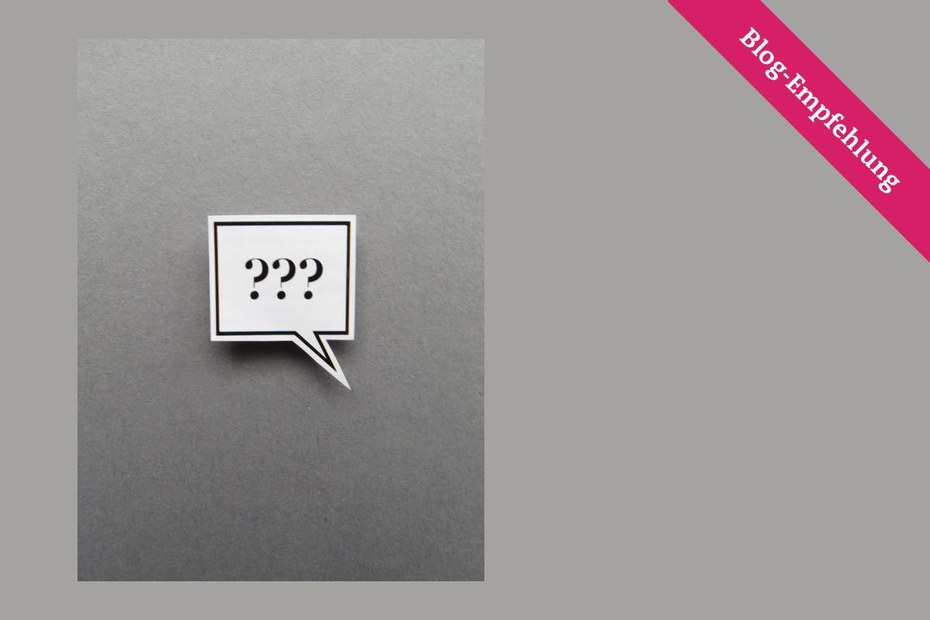





Was ist Ihre Meinung?
Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.