Der Corona-Virus verlangt den ohnehin schon unter Druck stehenden Schulen einiges ab. Pragmatische Lösungen haben Konjunktur. Die könnten unterschiedlicher nicht sein und reichen von ausgedruckten Arbeitsblättern, die als Posteinwurf zugestellt werden, über virtuelle Klassenräume, mit täglichen Online-Gesprächen, bis zum selbstgesteuerten Online-Lernen, mit eigens produzierten Lernvideos und Linksammlungen – abhängig von den Gewohnheiten und digitalen Kompetenzen der Lehrenden. Dabei vollzieht sich nicht die vermeintlich überfällige Transformation zur digitalen Bildung – Lehrende, die bisher analog unterrichtet haben, können sich nicht über Nacht fortbilden. Auch die Entwicklung der Infrastrukturen ist ein langfristiger Prozess. Es ist die Stunde derjenigen, die bereits seit Jahren digitalgestützte Lernszenarien entwickeln und praktizieren. Jetzt gilt es zu zeigen, wie dezentrales Lernen, das Teilen von Wissen und der Einsatz geeigneter Tools Bildung zeitgemäß transformieren können.
Digitale Werkzeuge: gekommen, um zu bleiben?
Aber welche Tools sind geeignet? Inzwischen existieren zahlreiche Listen, die digitale Werkzeuge empfehlen. Eingesetzt wird am Ende das, was in der Krise am leichtesten von der Hand geht: Lehrende, die Dropbox für das Teilen von Dateien nutzten, wenden es nun an, andere Nextcloud. Es muss pragmatisch sein. Und das ist auch okay, denn jetzt zählt es, das System funktionstüchtig zu halten. Aber was wird bleiben? Viele der eingesetzten Tools sind datenschutzrechtlich bedenklich. Die Angst ist groß, dass sich diese jetzt etablieren und Lock-In-Effekte entstehen. Zahlreiche selbstgehostete Instanzen verschiedener Open Source-Lösungen, die gerade aus dem Boden sprießen, sollen zeigen, dass es auch anders geht. Sie ermöglichen Lehrenden zum Beispiel die einfache Videotelekommunikation oder kollaboratives Schreiben. Ein dezentrales Netzwerk von datensparsamen Anwendungen, die zur freien Verfügung stehen. Es ist kein strukturierter Entwicklungsprozess, der sich gerade vollzieht, sondern ein experimenteller Testbetrieb, aus dem wir mit vielen Erfahrungen herausgehen werden. Einige Fragen zeichnen sich allerdings schon jetzt ab: Wie gelingt der Spagat zwischen pragmatischen, verlässlichen Tools und Datenschutz? Und wie ermöglichen wir eine digital gestützte Bildung auch Benachteiligten? Open Source Software und Open Educational Resources – kostenlos nutzbare und leicht zugängliche Bildungsmaterialien – halten viele Antworten bereit. Ob sie zur Lösung beitragen, hängt allerdings an individuellen und politischen Entscheidungen. Oft ist der Weg der prorietären und zentralen Plattform-Lösung einfacher. Das muss sich ändern und Anreize geschaffen werden – die zivilgesellschaftliche Akteure, wie das Bündnis Freie Bildung, immer wieder fordern. Es braucht gezielte Investitionen, um fehlende Infrastrukturen zu schaffen und lokale Institutionen, die insbesondere den fehlenden Service kompensieren – eine Aufgabe zum Beispiel für Landesmedienzentren.
Die Zeit des freien Wissens
Aber es geht nicht nur um Tools – sie prägen nur den Handlungsraum –, sondern auch um Konzepte und Materialien. Die werden gerade hemmungslos geteilt. Dieser Trend zu Open Source zeigt auch das Potential von Open Educational Resources. Die aktuell neuen und provisorischen Lernräume bieten die Chance, sich einem dezentralen, selbstgesteuerten Lernen zu nähern, das auf individuell wählbaren und freien Bildungsmaterialien basiert. Lernende arbeiten Selbstständig im Rahmen allgemeiner Lernziele, gestalten den Prozess entlang ihrer Interessen und üben sich so in Partizipation. Modularisierte Open Educational Resources spielen hierbei eine wichtige Rolle. Denn die komplexen Lernwege benötigen eine Vielzahl unterschiedlicher Materialien, die barrierefrei auch Benachteiligten zur Verfügung stehen müssen. Durch das Teilen von Wissen verbreiten sich gerade solche Materialien, Erfahrungen und Konzepte rasend schnell. Daran zeigt sich, wie ein offener Austausch Innovationen in die Breite bringt und zur Lösung von Problemen entscheidend beiträgt. Diese Kultur kann nicht nur ein Momentum der Selbsthilfe sein, sondern muss strukturell gefördert werden.
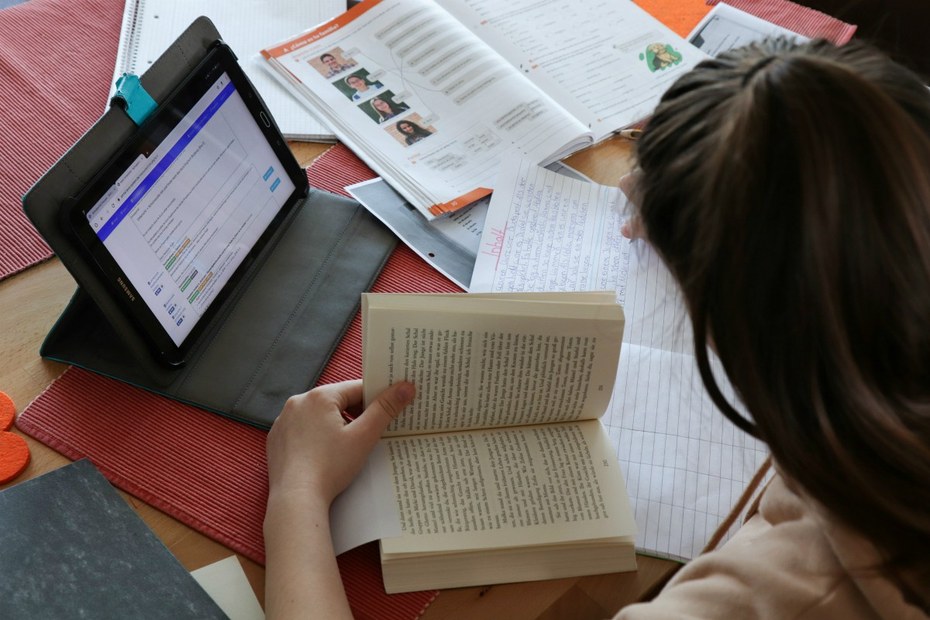






Was ist Ihre Meinung?
Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.