In den politisch höchst diversen Jahrzehnten meiner verlegerischen Praxis gab es zwar kaum eine Möglichkeit, gutes Büchermachen aus wirtschaftlichen Zwängen zu lösen – mein Herzblutprojekt sind politische Krimis von Frauen, und Literaturförderungen scheuten allzeit die Genreliteratur, sei sie noch so exzellent–, dafür bestand jedoch immerhin eine relativ stabile vertriebliche Struktur am Buchmarkt. Das war Lichtjahre entfernt von einem Bekenntnis zum Kulturauftrag, aber doch eine geordnete Leistungskette.
Die Kette, die unabhängige Verlage und speziellere Bücher, sogar Nischentitel nicht hermetisch ausschloss, verlief von der Auslieferung des produzierenden Verlags zum Buchhandel oder zum Zwischenbuchhandel. Im Inland spielen die Barsortimente die entscheidende Rolle: Als Lager- und Logistikdienstleister gewährleisten sie Zugriff auf die ganze Palette lieferbarer Bücher, schnell und unkompliziert. Das Barsortiment ist bildlich gesprochen das virtuelle Lager des kleinen Buchladens, die virtuelle Sortimentsbreite. Ein Blick der Buchhändler*in ins System, und fast jeder Titel kann bestellt werden, ist tags drauf abholbar.
Je mehr der Buchhandel durch Branchenkonzentration und den Internethandel in Bedrängnis geriet, umso bedeutsamer wurde die Rolle der Barsortimente. Im Januar meldete das größte deutsche Barsortiment KNV Insolvenz an, ein Erdbeben im System. Wenige Monate später meldete das zweitgrößte deutsche Barsortiment Libri einen radikalen Abbau der lieferbar gehaltenen Titel. Libri kürzte seinen Bestand um 250.000. Es sind Titel, die nun in manchen Sortimenten nicht mehr auftauchen, auch bei vielen Onlineanbietern nicht. Titel, die Libri als Remissionen den Verlagen zurückgibt. Eine offizielle Kommunikation zur neuen Strategie gab es bislang nicht, nichtsdestotrotz hat Libri mit den Auslistungen und Remissionen bereits Fakten geschaffen. Teilweise sind die Auslistungen nicht nachvollziehbar, wenn zum Beispiel Band vier einer zehnbändigen Reihe verschwindet. Für die Kunden sind manche Titel nicht mehr sichtbar – außer bei Amazon. Das macht es gerade den kleineren Verlagen künftig noch schwerer, im Buchmarkt zu bestehen. Auch hinterlässt es keinen guten Eindruck, wenn der stationäre Buchhändler dem Kunden sagt, ein Buch wäre nicht lieferbar, dieser aber feststellt, dass es bei Amazon vorrätig ist.
Das Ausmaß der Auslistungen ist sehr unterschiedlich. Bei einigen wurde kaum ausgelistet, bei anderen bis zu 90 Prozent. Ebenso ist es mit den Remissionen: Teilweise bewegen sie sich im üblichen Rahmen, doch für einige Verleger ist die Höhe existenzbedrohend. Die Neustrukturierung bei Libri ist durchaus systemrelevant.
Wie sieht das aus, wenn die schiere Quantität der Nachfrage die „Spreu“ vom „Weizen“ trennt? Die Kurt-Wolff-Stiftung zur Förderung einer vielfältigen Verlags- und Literaturszene sah sich dieser Tage veranlasst, die Branche sowie die Leser*innen aufzurütteln. „Denn jede gute Buchhandlung wird jedes lieferbare Buch besorgen.“ Und selbst eine keineswegs kapitalismuskritische Politik sieht die Entwicklung mit Besorgnis. Auf der Buchmesse in Frankfurt hat die Bundesregierung über 60 unabhängigen Verlagen erstmals den Deutschen Verlagspreis verliehen, es ist das derzeit einzige spürbare Signal, dass Bibliodiversität gebraucht wird.
Der Kultur- und Bildungsauftrag rund ums Buch wird von der Profitmaxime ausgehöhlt, er gehört aus dem Wirtschaftswürgegriff gelöst und als extrem relevante Ressource für die Gesellschaft erkannt.
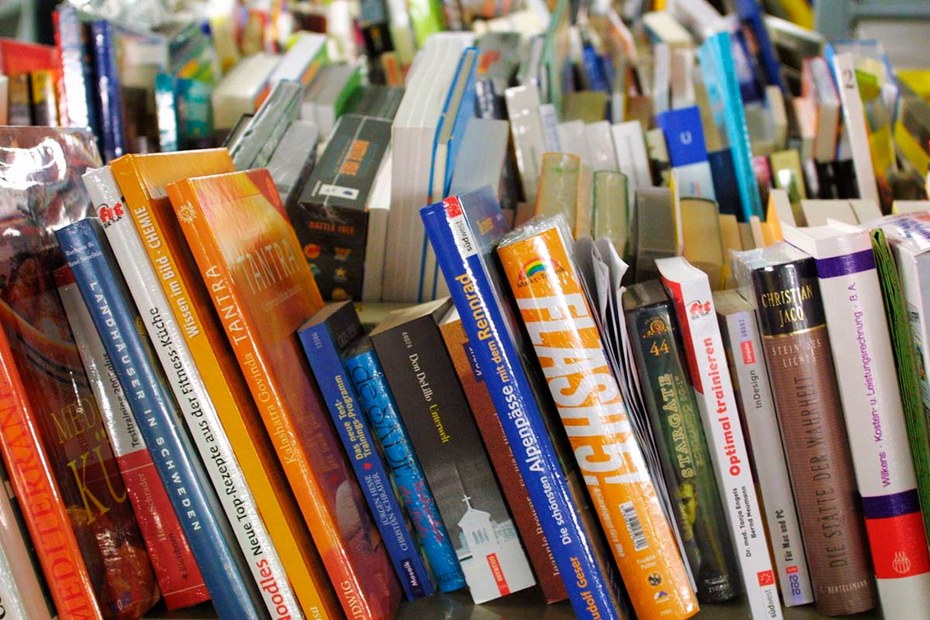






Was ist Ihre Meinung?
Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.