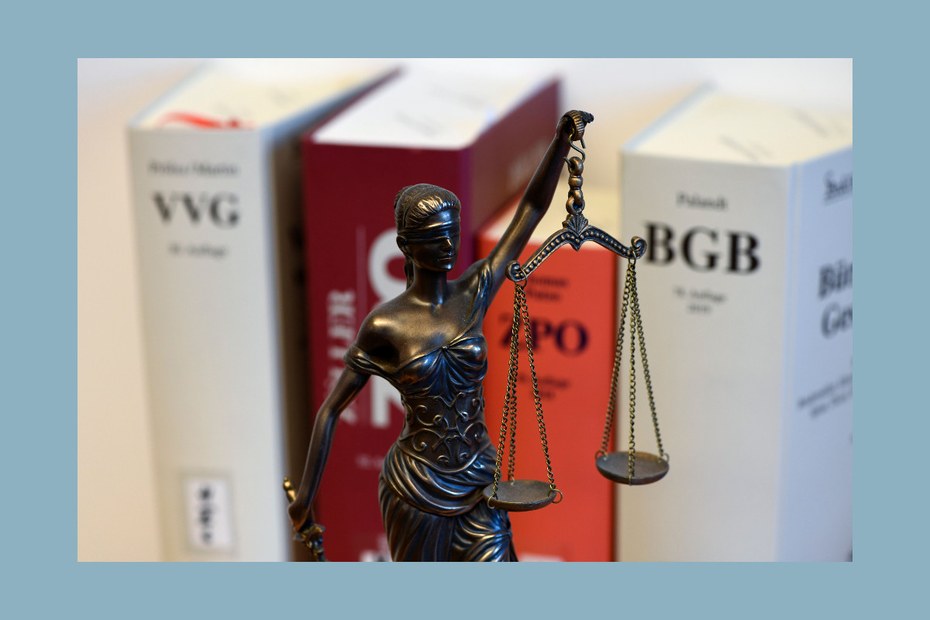Vor dem Recht sind alle gleich. Doch es wäre vermessen, zu glauben, das Recht sei aufgrund seines universalen Gleichheitsversprechens vor rassistischem Denken gefeit. Dies bestätigte sich jüngst in erschreckender Deutlichkeit. Anlass, die Komplizenschaft zwischen dem Recht und Rassismus zu hinterfragen, gibt der Fachaufsatz „Ist Ugah, Ugah eine rassistische Äußerung?“ von Prof. Dr. Rüdiger Zuck, welcher in der Neuen Zeitschrift für Arbeitsrecht im renommierten Beck Verlag veröffentlich wurde. Bereits die Frage im Titel suggeriert, dass hier ergebnisoffen verfahren wurde.
Doch worum geht es genau? Der Aufsatz bespricht eine Gerichtsentscheidung, welcher folgender Sachverhalt zugrunde liegt: Ein Betriebsrat adressiert einen Schwarzen Kollege
n Schwarzen Kollegen im Rahmen einer hitzigen betrieblichen Diskussion mit dem Ausruf „Ugah, Ugah“. Daraufhin wird dem Betriebsrat gekündigt. Die Arbeitsgerichte bestätigten in allen Instanzen, dass es sich bei dem Ausruf um eine menschenverachtende Äußerung handelt. Die Kündigung sei daher rechtmäßig. Der Betriebsrat legte schließlich erfolglos Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht ein. Hier könnte die Geschichte enden. Prof. Zuck jedoch hatte Klarstellungsbedarf. Seine These: Zwar sei der Ausruf kränkend, mit Rassismus habe er aber „sicher (…) nichts“ zu tun. Die geäußerten Laute sollen gerade nicht an einen Affen, sondern eine „primitiv(e) Kommunikationsform der Steinzeit“ erinnern. Sie seien daher von der Meinungsfreiheit gedeckt.Rassistische Stereotype, koloniale DenklogikDass Zuck sich diese Umdeutung nicht einmal selbst glaubt, wird im weiteren Verlauf des Beitrages klar. Um seine Argumentation zu untermauern, zieht er eine vermeintlich alltägliche Kommunikation eines fiktiven Paares heran. Man solle sich vorstellen, ein Schwarzer Mann fordere am Frühstückstisch von seiner weißen Freundin eine Banane, diese antworte mit „Ugah, Ugah“. Laut Prof. Zuck nur harmloser Spott, neckisch, mehr nicht. Woher jedoch das Bild der Banane stammt, ist offensichtlich: Zuck greift auf die animalisierte Assoziation eines Schwarzen zurück, den er gedanklich mit einem bananenliebenden Affen gleichsetzt. Es handelt sich dabei nicht um die einzige Ausführung, in welcher Zuck rassistische Stereotype und eine koloniale Denklogik reproduziert, darunter auch das N-Wort.Spannender als die Wiederholung seiner unwissenschaftlichen Ausführungen ist jedoch die Frage, wieso ein solcher Text in einer der bekanntesten Zeitschriften für Arbeitsrecht überhaupt publiziert wird? Aus welchen Gründen können rassistische Denkfiguren in der Rechtswissenschaft weiterhin unkritisch verwendet werden?Zur Erklärung ist weiter auszuholen: Rassismus galt lange als Thema, welches außerhalb der Rechtswissenschaft zu verorten sei. Im Jahre 1949 wurde als Reaktion auf die NS-Zeit das verfassungsrechtliche Diskriminierungsverbot aufgrund der „Rasse“ normiert. Das Recht rühmte sich damit, die rassistische Vergangenheit hinter sich gelassen zu haben. Seither fällt weder die höchstrichterliche Rechtsprechung noch die Fachliteratur durch eine tiefgreifende Beschäftigung mit Rassismus auf. Statt diese Lücke als Problem zu verorten, wird sie als Zeichen des Fortschritts der deutschen Verfassungsgeschichte gedeutet. Es verfestigt sich der Eindruck, dass in der Rechtswissenschaft noch immer ein großer Widerwille besteht, sich mit den strukturellen Mechanismen von Macht und Herrschaft auseinanderzusetzen.Die „herrschende Meinung“ herrschtNeben der mangelnden Aufarbeitung von Kolonialismus und Nationalsozialismus hängt dies auch mit der juristischen Ausbildung und damit mangelnden Kompetenzen zusammen: Angehenden Jurist*innen wird kaum vermittelt, bestehende Herrschaftsverhältnisse im Recht zu hinterfragen. Eine Atmosphäre im Hörsaal, die Hochschullehrer*innen sowie die „herrschende Meinung“ als nicht unangreifbare Entität erscheinen lässt, leistet ihr Übriges. Für die Diskussion über Rassismus in der Rechtswissenschaft ist es jedoch zentral, dass gerade die Über- und Unterordnungsverhältnisse, welche das Recht zu normalisieren versucht, aufgedeckt und kritisiert werden. Eine weiße Rechtswissenschaft muss ihre eigene Situiertheit reflektieren und verstehen, dass sie selbst in rassistische Machtverhältnisse verwoben ist. Notwendig wäre dazu auch, vielfältigere, nicht-weiße Stimmen in den juristischen Kanon aufzunehmen.Ein weiteres, eindringliches Beispiel für die mangelnde Reflexion in der Rechtswissenschaft betrifft die Benennung des bekanntesten Nachschlagewerks im Zivilrecht, des Kurzkommentars zum Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) von Otto Palandt, der ebenfalls im Beck Verlag publiziert wird. Wurde das Standardwerk vor 1933 noch von dem jüdisch-deutschen Verleger Otto Liebmann herausgegeben, kaufte der Beck Verlag das gesamte Unternehmen im Zuge der „Arisierung“ des Rechtswesens auf. Seit 1938 ist der Kommentar benannt nach Otto Palandt, dem Präsidenten des Reichsjustizprüfungsamtes, Mitglied der NSDAP und der Akademie für Deutsches Recht. Der Verlag reagiert auf die geäußerte Kritik der Initiative „Palandt umbenennen“ mit folgender, unzulänglicher Rechtfertigung: Otto Palandts Inhalte seien aus dem Werk entfernt worden, die Bezeichnung „Palandt“ stehe für sich selbst und sei eine Eigenmarke. Der Titel solle auch in Zukunft „Anlass zur kritischen Reflexion“ geben. Klingt gut, setzt in Wahrheit aber unternehmerische Verkaufsinteressen über eine entschiedene Distanzierung zur menschenfeindlichen Tradition des Werkes. Den Beitrag Zucks entschuldigt der Beck Verlag, indem er auf die „Meinungsvielfalt“ der Autor*innenschaft verweist. Gleichzeitig distanziert sich die Redaktion von dem Beitrag. Jedoch ist sowohl die Verteidigung eines nationalsozialistischen Personenkults sowie rassistischer Äußerungen unter dem Deckmantel von Erinnerung und Pluralität wenig überzeugend.Hoch die Meinungsfreiheit. Und die Machtverhältnisse?Die Analyse von Prof. Zuck und das unkritische Handeln des Beck Verlags können schlussendlich bestenfalls als unreflektiert oder unwissend verstanden werden. Schlimmstenfalls wird dadurch einem rassistischen Weltbild Ausdruck verliehen. Doch kommt es auf einen Schuldspruch wirklich an? Der Beitrag Zucks verteidigt eine problematische Deutungshoheit. Die Meinungsfreiheit wird als Argument genutzt, um rassistische Beleidigungen als legitime Sprechakte zu rechtfertigen. Die dahinter bestehenden Machtverhältnisse werden jedoch ausgeblendet.Es bleibt zu hoffen, dass der Beck Verlag und andere juristische Institutionen die Tragweite ihrer Positionen zu verstehen lernen. Im jüngsten Fall erwies sich die Gegenrede kritischer Stimmen der Rechtswissenschaften als wirksam: Zumindest wurde der Artikel von Herrn Zuck nach etwa 48 Stunden von der Online-Plattform des Verlags genommen. Ein offener Brief, der auf die Initiative von Prof. Dr. Anna Katharina Mangold zurück geht, fasst die Kritik zusammen und fordert für die Zukunft eine aktive Auseinandersetzung mit Rassismus in der Rechtswissenschaft. Dem stimmen wir uneingeschränkt zu.