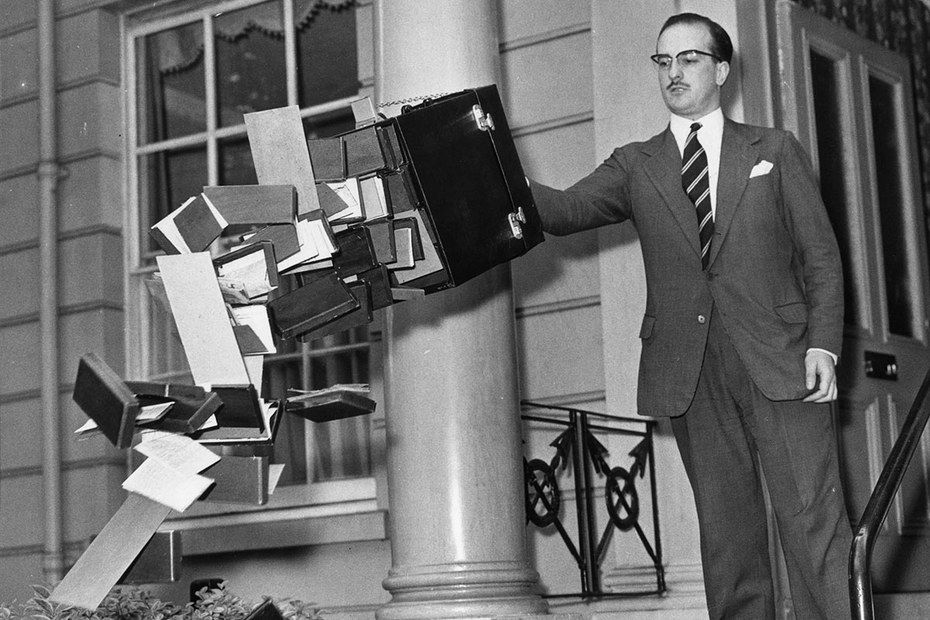Die Gattin des Bundespräsidenten hält Ameisen für die politischsten aller Tiere, weil sie sich organisieren und Staaten bauen. Wir wollen nicht widersprechen, lediglich hinzufügen, dass den Ameisenforschern Susanne Foitzik und Olaf Fritsche zufolge Ameisen eine Weltmacht sind. Und keineswegs im Rückzug begriffen, wie die USA, mit dem Aufstieg beschäftigt, wie China, oder davon fantasierend, wie Rußland. Sie sind es. Basta. Aufs Ganze gesehen gibt es weit mehr Ameisenarten und Populationen mit wesentlich größeren Unterschieden untereinander als innerhalb der Menschheit. Zwar müssen die Autoren sich auf die geläufigsten und spektakulärsten der vielen Unterarten beschränken, aber faszinierend ist das wirklich. Das geht naturgem&
. Das geht naturgemäß weit über das Schulwissen von Staatenbildung, Königinnen, Arbeiterinnen, Soldatinnen, chemischer Kommunikation, Pilzzucht et cetera hinaus, zeigt etwa das Spektrum zwischen Gewalt und Symbiose im Verhältnis der Arten. Ob man mit reißerischen Titeln wie „Skrupellose Bandenkriminalität zu unseren Füßen“ wirklich bei unsereins punkten kann, sei dahingestellt. Die Kapitelchen sind so übersichtlich wie die Darstellung klar und verständlich. Durchaus etwas für das wissbegierige Man im Kinde.Mit Ameisen haben die, die man gewöhnlich zur Frankfurter Schule zusammenfasst, wenig zu tun gehabt, jedenfalls Adorno und Benjamin. Adorno redet einmal von Grille und Ameise, Benjamin sah in Monets Bild der Kathedrale von Chartres „gleichsam einen Ameisenhaufen aus Stein“, und in den Passagen-Notizen findet sich der nicht allzu tiefschürfende Gedanke: „Tiere (Vögel, Ameisen), Kinder und Greise als Sammler.“ Umso ameisenhafter hat sich die einschlägige Forschung über die sogenannte Frankfurter Schule hergemacht. Sehr mutig ist es, sie gar noch in ihrer Zeit darstellen zu wollen, unter dem schönen, von Georg Lukács geprägten Titel Grand Hotel Abgrund. Die Darstellung selbst ist nicht eben abgründig. Vielmehr vom Schwung der Begeisterung getragen. Enthusiasmus schützt aber vor Fehlern nicht. Davon gibt es hier allerlei. Im Detail wie kategoriale – schon der, dass die späte Subsumption zur Frankfurter Schule identisch sei mit dem Institut für Sozialforschung. Zudem muss man allerlei ins Allbekannte Schweifendes wie flottierend Aktualistisches, auch Stilblühendes hinnehmen. Dennoch ist das Buch empfehlenswert, auch weil es breit auf die Zeitläufte und neben den ikonischen Adorno und Benjamin auf Horkheimer und inzwischen eher in den Hintergrund geratene Figuren eingeht, wie auf Erich Fromm, Herbert Marcuse, Leo Löwenthal oder Friedrich Pollock.Adornos Vortrag 1967 zum neuen Rechtsradikalismus hat es jüngst aus unguten Anlässen und guten Gründen zum Bestseller gebracht. Er findet sich nun auch hier in einem Band mit Verschriftlichungen von Vortragsmitschnitten. Vorträge, die er zwischen 1949 und 1968 gehalten hat und die sich naturgemäß hin und wieder mit den seinerzeit gedruckten Aufsätzen überschneiden. Viel zur Musik, zu Fragen der Soziologie, zum Verhältnis von Individuum und Gesellschaft, zu Kultur und Culture, zum Aberglauben, zur universitären Ausbildung oder zum Städtebau. Erstaunlich und traurig zugleich, wie sehr fast alles Dringlichkeit bis heute bewahrt hat. Ein Fundus daher, der noch lange Zeit denkenden Köpfen Argumente und Trost liefern wird.In einem Vortrag zu Marcel Proust entwickelte Adorno 1954 aus Anlass der Übersetzung von Eva Rechel-Mertens noch einmal die Schwierigkeit bis dahin, Proust bekannt zu machen. Für ihn plaudert Proust „die Geheimnisse eines jeden“ aus, weshalb sich für jeden, der sich darauf einlässt, seine „magnetische Kraft“ ein für alle Mal entfalte. Inzwischen haben wir die dritte Übersetzung, dazu zwei Hörversionen – und seit Langem die Proust-Gesellschaft. So weit freilich wie die französischen Medien sind wir noch nicht, die den Umstand, dass Proust im Dezember 1919 den Prix Goncourt für den zweiten Band seiner Recherche erhielt, zum Anlass eines Großaufgebots von opulenten Sonder- und Beiheften nahm. Bei uns immerhin ist ein Sammelband zum Thema Proust und die Frauen erschienen. Der legt das Thema entschieden weiter aus als die Transformation des begehrten Agostinelli in Albertine, die Gefangene, Entflohene et cetera. Immerhin gibt es in der Recherche ja einen ganzen Schwarm von Frauen, beginnend bei Mama und der Großmutter, über die junge Mädchenblüte hin zu den Salondamen, die mehr noch für den Erzähler schwärmten als er für sie. Hizu komen Frauen im „übertragenen Sinne“, „fließende“ Frauen, Selbstschwängerung mit dem Manuskript, Mutterkult und -mord, angeblich weibliche Poetik der Passivität. Die damennamigen Blümchen nicht zu vergessen - und überhaupt die von Hörensagern gern in den Tee ihrer Unkenntnis gematschte Madeleine. Ein Prachtstrauß an Aufsätzen. Zwar auch sterile Stilisierungsblüten darunter, an denen Mme. Verdurin ihre Freude gehabt hätte. An den anderen aber nehmen wir unser Vergnügen.Placeholder infobox-1