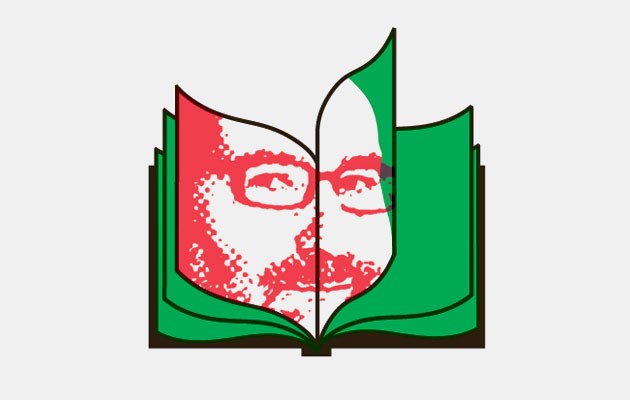Der Dilettant zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass er sich alles zusammen zutraut, was dem Experten oder Künstler je einzeln schon größte Mühe macht. Wenn der Metadilettant einer ist, der nicht nur trotzdem herumfrickelt, sondern dabei seine Reinfälle als gelungene Einfälle verkauft, dann ist Tex Rubinowitz einer. Er unternimmt Reisen, die der Profireisende nie unternehmen würde. Nicht weil sie zu gefährlich, sondern weil sie zu öde oder unbequem sind. Ob er nach Bhutan reist, um eine Ampel in einen Yakfladen zu stellen, oder sich an das Dorf West-berlin erinnert, wo Kapielski und Blixa Bargeld schreberten, stets gibt es forsche Formeln gemischt mit Alkohol, Musik- wie Namedropping. Die Marotten der Pubertät werden zu Lebensmitteln
den zu Lebensmitteln in einer Welt, in der er stets wieder auf Seinesgleichen, harmlose oder hormonvolle Irgendwiemitkunstrummacher trifft. Parallelwelttourismus. Und dadurch sind denn auch seine Berichte von so menschheitsförderlichen Veranstaltungen wie dem zuschauermarternden Eurovision Song Contest oder den autorenfolternden Klagenfurter Schaulesungen besonders eindrücklich. Leitmotivlich wetteifern dabei übrigens Wiedehopf und Eier. Während der Vogel undekliniert wiedehopfig bleibt, konjugieren die Eier von japanischen zu finnischen, zwischen denen von Igeln zu Seepferdchen. Und welches Buch endet schon mit dem Satz „Ich brauche Jod“?1936 reisten zwei Russen in die USA, deren Bericht das bei uns gehätschelte Paradies Amerika von Egon Erwin Kisch als alberne Effekthascherei erscheinen lässt. Sie sind von Hochhäusern fasziniert, blicken jedoch auf das flache Durchschnittsamerika, um ihm die Schrecken eines stupiden Alltags abzugewinnen. Für sie haben das Empire State Building und die Niagarafälle, die Ford-Werke und der Grand Canyon sich dort zusammengetan, „um im Verein die Vorstellungskraft des Menschen herauszufordern, ihn klein zu machen“. Pflichtschuldig singen die damaligen Literaturstars Ilf und Petrow zwar ihr Loblied auf Stalins Sowjetunion, aber schimmernder und schillernder ist doch der Reiz des Kapitalistensumpfs. „Eine Autotour durch die USA ähnelt einer Schiffsreise über den Ozean. Sie ist ebenso einförmig wie großartig.“ Ihr Bericht jedenfalls ist selbst heute nicht einförmig, sondern immer noch großartig. Nicht zuletzt auch durch die beigegebenen, ein wenig dilettantischen, aber hellwachen Fotos. Und ein klugschönes Vorwort von Felicitas Hoppe gibt es obendrein.„Noch vor einem Jahrhundert ist das Reisen eine Sache für Spezialisten gewesen“, schrieb Paul Bowles. Heute, 1958, könne jeder überall hingehen. Von unserem Heute aus gesehen, war Bowles jedoch höchst privilegiert, weil eben noch keineswegs jeder überall hinging. Und dorthin, wo Bowles vorzugsweise hinging und dann auch wohnen blieb, in den afrikanischen Norden, reisten damals vor allem Knabenaufreißer, die das dann auch noch gern insiderhaft annoncierten. Das fand er degoutant. Und er fand damals eben auch, dass ein Reisebericht längst nicht mehr nur vom verlockenden Gegenstand, sondern von den originären Eindrücken des Schreibenden lebe. „Der Gegenstand der besten Reisebücher ist der Konflikt zwischen dem Schreibenden und dem Ort.“Ob der Schreibende dabei unterliegt, spielt keine Rolle, solange er den Konflikt durch sein Schreiben für sich entscheidet. Und damit für die Leser, außen- wie innenge-wendete. Ob er über Fès als bukolischen Ort in der marokkanischen Barbarei, über den unvergleich-lichen Himmel über dem Einsamkeits-Baptisterium der Sahara, über das internationale Kalte-Kriegs-Tanger, die Faszination der salazaristisch diktierten, archaischen Armut Madeiras oder – nun schon 1965 – vom angeblichen Landescharakter Spaniens schreibt, der unterm Tourismus an der Costa del Sol verschwindet, und doch nur Armut ist, die abnimmt – das sind, auch durch die Übersetzung, Perlen der Reise-literatur, in ein ausnehmend sorgfältiges Buch gefasst!Nun noch dahin, wo die Nach-krieger und ihr oberster Häuptling so gern hinfuhren, zum Lago di Como. Godehard Schramm, in seiner Dichterjugend realkommunistischer Inklinationen nicht abhold, ist heute ein christlich-abend-ländisch Versöhnter, was vielleicht Voraussetzung seiner Hausautorschaft für Adenauers Cadenabbia war, für sein Buch über den Kanzler und seine Gäste aber keineswegs abträglich. Hingegen stört allerlei cavalierehafte Selbstgefälligkeit und manch bräsiges Prospekt-sätzlein, aber wenn man’s zu überlesen vermag, lohnt die Lektüre des fein gestalteten Buchs: Man versteht, warum es hier so viele Paradiese auf einmal gab und noch gibt, warum der Eintritt nicht allen gewährt, aber trotzdem so begehrt wird. Und wenn man Glück hat, kann man sogar in Adenauers Residenz Unterkunft finden …