Längst ist erwiesen, dass vor dem Coronavirus nicht alle gleich sind: Die Pandemie trifft Geringverdiener und Arme deutlich härter als die Wohlhabenderen. Darüber redet in Deutschland jedoch kaum jemand. In Talkshows und Zeitungen wird Woche für Woche über Lockerungen und Lockdowns diskutiert, aber fast nie über die soziale Ungleichheit in der Pandemie. Selbst auf den Websites von SPD oder Grünen findet sich nichts Genaues dazu, und die Medien haben auch kaum darüber berichtet, dass darüber nicht berichtet wird.
Noch im 19. Jahrhundert erstellten die Zeitgenossen bei Epidemien detaillierte Karten über die Verteilung von Infektionen und Todesfällen in Stadtgebieten – auch um die sozialen Effekte der Seuchen zu dokumentieren. Heute verfügen sogar manche Bundestagsabgeordnete nicht über entsprechende Daten in ihren Wahlkreisen. Dabei wäre es im digitalen Zeitalter kein Problem, lokale Corona-Karten zu produzieren, die Zusammenhänge zwischen ungleichen Lebenslagen und Anfälligkeit für die Seuche sichtbar machen könnten.
Deutschland ist bei diesem Thema ein Nachzügler. Bis Sommer 2020 existierte hierzulande nur eine einzige wissenschaftliche Studie zum Thema Ungleichheit und Covid-19. Das Online-Angebot des Statistischen Bundesamtes zur Pandemie enthält keinerlei Analysen nach Einkommen oder anderen Indikatoren der Ungleichheit – als ob diese überhaupt nicht existierten. In der Presse wurde der Mythos vom egalitären Virus schon frühzeitig infrage gestellt, dies allerdings meist nur anhand anekdotischer Evidenz, nicht auf Basis repräsentativer Statistiken. Der Mangel an Statistiken zeigte sich zuletzt in der spekulativen Diskussion über den Anteil von Corona-Patienten mit Migrationshintergrund.
In anderen Ländern mit besseren Statistiken ist niemand mehr überrascht über die disproportionalen Effekte der Pandemie auf ethnische Minderheiten und sozial benachteiligte Gruppen. In den USA zeigten Studien, dass etwa doppelt so viele Schwarze wie Weiße an Covid-19 starben – ein Befund, der die Black-Lives-Matter-Proteste zusätzlich befeuerte. Im Vereinigten Königreich verknüpften Statistiker den offiziellen Index of Multiple Deprivation, eine sozialgeografische Armutsstatistik, mit Daten über Corona-Todesfälle. Dies erbrachte schon im Frühjahr 2020 fast in Echtzeit den Beweis: je ärmer und multiethnischer die Gegend, desto höher die Mortalität. Die Befunde führten zu Debatten, die hierzulande nicht stattfanden: Sie bewogen die Labour Party dazu, eine gesellschaftliche Umkehr zu fordern.
Die britische Gesellschaft ist auch deshalb informierter, weil sie aus historischen Gründen über geeignetere statistische Infrastrukturen verfügt. Die Entstehung des Index of Multiple Deprivation reicht bis in die 1960er und 1970er Jahre zurück, als man Armut und ökonomische Ungleichheit als gesellschaftliche Probleme wiederentdeckte. In der Bundesrepublik dagegen wurden solche Fragen weitgehend ausgeblendet. Erst seit den 1980er Jahren beschäftigte man sich mit Armut, und erst seit den 2000ern wurde die Einkommens- und Vermögensverteilung zu einem Thema. Die amtliche Statistik schloss bis in die 1990er Jahre auch alle „Ausländer“ aus wichtigen Surveys aus. Mittlerweile sollte allerdings klar sein, dass ihre gesundheitlichen Nachteile etwas mit ihren geringeren Lebensstandards zu tun haben.
Erst in jüngster Zeit wurde auch die Entwicklung eines Deprivationsindex endlich nachgeholt. Im Jahr 2017 produzierte das Robert-Koch-Institut den German Index of Socioeconomic Deprivation (GISD), auch wenn dieser nicht so detailliert und sensibel ist wie das britische Vorbild. Ein Abgleich des GISD mit Corona-Fällen bestätigte im Herbst 2020 dann auch für Deutschland den Befund starker gesundheitlicher Ungleichheiten. Bezeichnenderweise aber nahm kaum jemand Notiz davon und kaum jemand kennt überhaupt den GISD. Das ist symptomatisch für die geringere „statistical literacy“ der deutschen Gesellschaft, die historisch bedingt ist, aber bis in die Gegenwart unsere Debatten prägt.
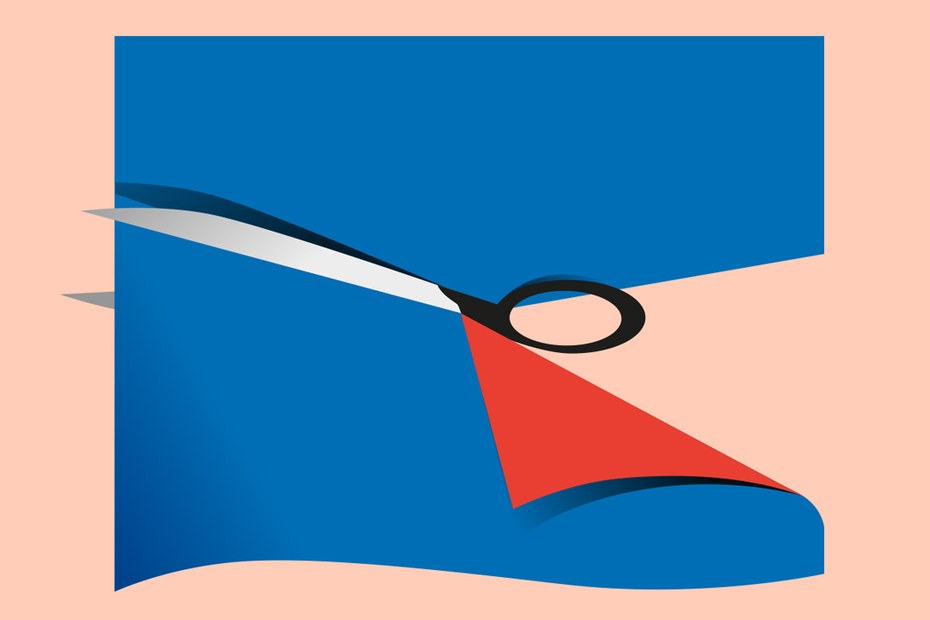






Was ist Ihre Meinung?
Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.