Was die Geschichte von Popmusik in Deutschland allgemein und in deutscher Sprache im Besonderen anbelangt, so gibt es dazu eine identitäre Erzählung, die bisher kaum kritisiert wurde. Sie geht in etwa so: Im deutschen Schlager der 50er Jahre wurden – zeitgleich mit einer direkten Fortsetzung der Unterhaltungsmusik aus dem „Dritten Reich“ – Spurenelemente des Rock ’n’ Roll aufgenommen, niedlich und brav gemacht. Anschluss an die Pop-Welt wurde durch den Einsatz von schwedischen, amerikanischen, französischen und britischen „Interpreten“ mit mehr oder weniger spaßigem Akzent gesucht. Unbestimmte Sehnsucht nach der Ferne beherrschte die weitere Entwicklung, aber immer noch wurden rote Rosen verschenkt, an Frauen, die Peggy Su
Geschichte des Deutschpop: Yes. We. Can.
Soundtrack Die Geschichte des Deutschpop ist gespickt mit Halbwahrheiten und frechen Lügen. Zeit für einen Gegenentwurf
Exklusiv für Abonnent:innen
|
Ausgabe 31/2015
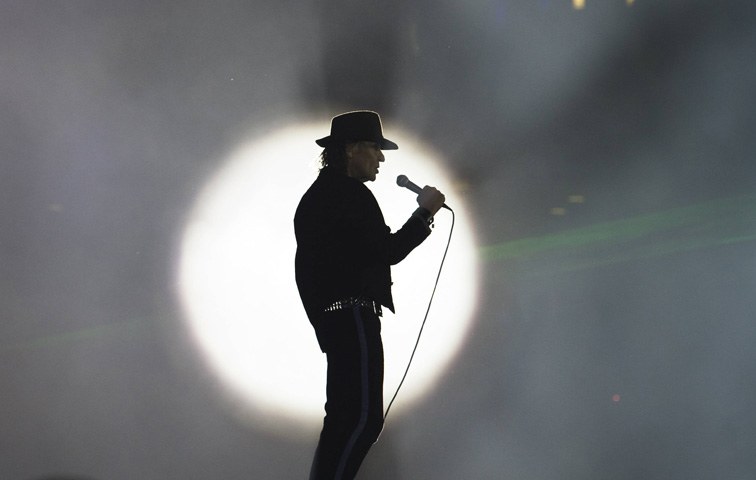
Unser König des Pop: Udo Lindenberg
Foto: Mito/Imago
Sue oder Cindy Lou hießen. Die Beatles änderten auch hier alles. Jetzt ging es nicht mehr darum, Musik nur zu hören, sondern zu machen. Den Mythos vom Kellerclub zum Weltruhm zu wiederholen, auch wenn es meistens beim Kellerclub blieb. Man sang die englischen Texte nach oder in einem lautmalerischen Fantasie-Englisch. Auf die Idee, Beat-Musik in deutscher Sprache zu produzieren, kamen nur verrückte Plattenproduzenten, die allen Ernstes die Beatles „Komm, gib mir deine Hand“ singen ließen. Ein definitiv abschreckendes Beispiel für das Verdikt: Popmusik in deutscher Sprache geht nicht.Es musste dann aber doch gehen. Aus irgendeinem Grund verlangte es die deutsche Musikszene nach „Selbstständigkeit“ und „Authentizität“. Damit begann das Elend des Deutschpop. Auf den (schauerlichen) Urknall – eine Nürnberger Rockband namens Ihre Kinder – folgten alsbald in Deutsch: Politrock, Befindlichkeitspop, Deutschpunk, Neue Deutsche Welle, deutscher Stadionrock, Hamburger Schule, Diskurspop (ja, okay, auch Nazirock und rechte Barden), um schließlich im alles umarmenden deutschen Indierock der Blumfeld-Transformationen und Tocotronic-Nachfolger, in deutschem Hiphop, deutscher Weltmusik zu münden. Hier nun endlich konnten Musik und Text „unverkrampft“ zusammenkommen und wirklich alles oder auch wieder gar nichts gesagt werden. Es ist, mit anderen Worten, eine nationale Emanzipationserzählung: die lange Reise einer Suche nach der endlichen Versöhnung von Pop und Deutschtum.Dieser Nationalerzählung des Deutschpop, die es in einer rechten, einer linken und in einer „unpolitischen“ Version gibt, muss entschieden widersprochen werden. Frank A. Schneider tut es. In seinem Buch Deutschpop, halt’s Maul, das soeben im Ventil-Verlag erschienen ist, schreibt der Künstler und Poptheoretiker: „Die identitäre Erzählung vom deutschen Pop ist heute so hegemonial, dass ihre Halbwahrheiten, Ungenauigkeiten, ja sogar die frechen und anmaßenden Lügen immer weiter verarbeitet werden: zu Waschzetteln, Promotionen, Ausstellungen und einer Kolonialpolitik, die Techno und Hiphop (über den nie wirklich bestimmten Kraftwerk-Input) zum deutschen Einflussbereich erklärt. UNSER befreites Selbstbewusstsein muss eben auch auf den Straßen von New York und Detroit verteidigt werden.“Wie nun aber sähe die Gegengeschichte aus? Ebenso gut kann man die Geschichte des Deutschpop als eine der Fremdheiten schreiben. Das Sprechen in einem unvollkommen adaptierten Englisch zu Beginn war in all seiner Unbeholfenheit dem Gestus des Pop am nächsten. Denn Pop ist ursprünglich eine Musik der Fremden, der Entrechteten, der Heimatlosen, der Verschleppten, Flüchtenden, Exilierten, und damit verspricht amerikanische Popmusik eben nicht eine andere Heimat, sondern eine Gemeinschaft der Heimatlosen, einen gelebten und lebenden Gegensatz zum faschistischen Blut und Boden. Popmusik vereinte immer drei Elemente: eine unbestimmte Sehnsucht nach der verlassenen Heimat, eine nicht minder unbestimmte Sehnsucht nach einer besseren und vor allem freieren Zukunft und schließlich ein offenes, rabiates Scheitern an der Gegenwart. Immer spiegelt sich in Popmusik zugleich Klassenkampf und ein freches individuelles Überschreiten der Klassenschranken. Sie war und ist auch in den USA und England alles andere als national und auch nicht wirklich identitär, sondern eher transformativ.Schaltstelle KrautrockDie Hinwendung zu einer „eigenständigen“ deutschen Popmusik bedeutete in Deutschland (Ost wie West) deshalb immer auch den Verlust eines Fluchtwegs. Die Sprache macht den Pop kontrollierbar, weshalb er immer wieder dazu tendiert, die Sprachgrenzen zu überschreiten, ambivalent und diskontinuierlich zu werden. Nun war es ja nicht so, dass kein deutscher Popmusiker jemals diese Sprachfalle erkannt hätte. Viele der interessanteren Gruppen reflektierten auch nach dem Verlassen des Pop-Englisch die Flucht aus der Tätersprache. Can zum Beispiel, mit ihrem japanischen Sänger Damo Suzuki, der seine Stimme eher wie ein Instrument einsetzte und in dessen Klangkunst sich nur unlesbare Texte verbargen. Umgekehrt versuchten die Vertreter des linken Politrock, den „richtigen“ Text mit einer Musik zu unterlegen, die bei den Jugendlichen ankam, was sehr häufig nicht viel anders peinlich war als die Texte der DDR-Singebewegung oder der christliche Rock. Da wurden dann allen Ernstes Karl der Käfer oder die Kleine Löterin besungen. Den großen Übersprung zwischen Pop und sozialer Bewegung schafften nur Ton Steine Scherben. Sie benutzten nicht Pop, sie waren Pop (auch wenn sie das nicht zugegeben hätten).Krautrock wiederum ist, partly truth and partly fiction, eine wesentliche Schaltstelle in der Geschichte von Deutschpop. Als Mythos eines Aufeinandertreffens von Pop und Avantgarde, deutscher Kultur und internationalem Flair, ohne den die Geschichte des Pop, von David Bowie über Madonna bis zu den Talking Heads und Afrika Bambaataa, unmöglich gewesen wäre. Allein wie geflissentlich dieser „deutsche Beitrag zur Popgeschichte“ hervorgehoben werden muss, zeugt von einem Pop-Missverständnis.Die Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit eines angelsächsischen Popsongs ließ sich in Deutschland jedenfalls weder in der eigenen Sprache generieren, deren Erbe in sich nur „verklemmt“ sein konnte, noch in der schwerfälligen Adaption der englischen. So gebar diese Verkrampfung eine eigene Ästhetik. Selbst die Lockerheit von Countrysongs konnte von erfolgreichen Gruppen wie Truck Stop nur imitiert, nicht erzeugt werden. Der König der künstlichen Lockerheit wurde Udo Lindenberg, der sich dazu gleich ein eigenes Idiom schuf, ein Kunst-Reeperbahnisch, wie es Rainer Werner Fassbinder in seinen Filmen mit seinem Kunstbayrisch pflegte, das auf andere Weise die Spannung zwischen dem „Authentischen“ und dem „Künstlichen“ wiedergab. Man kann all diese Versuche, dem Deutschen in der Popkultur zugleich zu entgehen und es zu erhalten, unter dem Stichwort Manierismus zusammenfassen.Dialekt, Blödsinn, Jargon„Unverkrampft“ zu sein aber war das so hehre wie falsche Ziel von Deutschpop, und jedes Mittel war recht dazu: Dialekt, Blödsinn, Jargon, Alltäglichkeit, am Ende auch eine Sprachkunst der hart erarbeiteten Einfachheit, die aus Deutschpopsängern nahezu notwendig Schriftsteller macht (oder umgekehrt). Unverkrampfter Deutschpop besagte aber nichts anderes als unverkrampft Deutschsein, was indes nicht so ganz unwidersprochen blieb.Innerhalb der Neuen Deutschen Welle gab es zum Beispiel die „genialen Dilletanten“, die mit den Mitteln von Dadaismus, Surrealismus und Cut-up eine lustvoll bösartige Form von Sprachzertrümmerung betrieben. Dass sie damit an eine sehr deutsche Tradition anknüpften, wurde (von Musikern wie Blixa Bargeld sehr bewusst) jedoch wieder überhöht. Nach dem Krautrock wurde so ein zweiter Gründungs- und Unabhängigkeitsmythos des Deutschpop erzeugt.Dass Deutschpunk und Neue Deutsche Welle allen Ernstes zur „neuen nationalen Jugendkultur“ hinaufgeschrieben wurden, passte dann in die Stimmung eines Nationalismus light – auch wenn viele Bands es sicherlich ganz anders gemeint hatten. Auf das letzte nützliche Feindbild des Pop, Helmut Kohl, folgte, guter Witz, Sigmar Gabriel als Pop-Beauftragter.Von der immer erhofften und immer verfehlten Pop-Lockerheit blieb am Ende im Mainstream nur die Lockerheit, mit der man nationalisierte Sprache und nationalisierte Musik zusammenbrachte. Es blieb dabei: Das einzige Mittel, die Sprache vor ihrer Nationalisierung zu bewahren, ist ihre bewusste Zerstörung. Diskursrock erwies sich hier als vorerst letztes Aufbäumen, beschrieb er doch in deutscher Sprache das Misslingen der Sprache im Rock. Diskurspop und Hamburger Schule trugen ja schon in ihren Namen die reflexive Distanz. Nicht mehr nur fremd in der eigenen Sprache, fremd in der eigenen Musik, sondern sogar fremd in der eigenen Befremdung. Aber beide Begriffe sind auch extrem cool. Sie zeugen von einer gewissen Abkühlung der Verzweiflung darüber, dass Pop und Deutsch niemals miteinander zu versöhnen sind, weil Pop in Deutschland eine faschistische Inszenierung ist. Konzerte von Freiwild, Andreas Gabalier, aber auch Helene Fischer offenbaren es nun ziemlich deutlich. Der Soundtrack eines entsublimierten Wir.Deutschsein ist die BotschaftDer Mainstream des Pop in Deutschland, ein paar Blicke auf die Charts belegen es, ist vollkommen nationalisiert. Unter den Top Ten befinden sich aktuell sieben deutschsprachige Alben – darunter Helene Fischers Farbenspiel und Von Liebe, Tod und Freiheit der Volksmusikerband Santiano – sowie ein Sampler von Xavier Naidoos Show Sing meinen Song. Eine Flucht in die Sphären des „ausländischen“ Pop ist nicht mehr so ohne Weiteres möglich; die einzige Ausweichmöglichkeit scheint ein musikalisches Nerd-Tum mit immer neuen und weiteren Verzweigungen.„Wo Pop sich einem locker zwischen Lichterkette und Brandanschlag swingenden Gemeinschaftsgefühl verpflichtet fühlt, kann er keine Parallelgesellschaft mehr sein. Er wird zum Integrationsangebot für deutsche Popkulturschaffende, denen wohl auch weiterhin der Zugang zu den weltumspannenden Rezeptions- und Anerkennungsnetzwerken verbaut sein wird: Wer außer Deutschen sollte sich schon Filme von Sönke Wortmann ansehen oder Platten von Kettcar hören? Immerhin die Deutschen lieben sie, und das ist Grund genug, im Gegenzug auch die Deutschen wenigstens ein bisschen zu lieben“, so fasst es Frank A. Schneider zusammen.Deutschland, Pop geworden, braucht keine Politik mehr. Aber Deutschland ist zugleich absolut pop-unfähig. Deswegen ist der nationale Wohlfühlkuschelindiepop nichts anderes als Propaganda für das zufriedene unglückliche Leben in einer Mitte, der schon alles egal ist, Hauptsache, man hat seine Freunde, sein Milieu, seine Werte, seine Familie, seine Heimat. Das Deutschsein ist nicht mehr das Problem von Deutschpop, sondern seine Botschaft. Natürlich machen Nazis, Halbnazis, Liberale, Sozialdemokraten, Ökos, Linke et cetera immer noch einen Unterschied, aber lange keinen so großen, wie sie vielleicht meinen. Sie alle wollen ins Wir, in die Heimat, wollen Geborgenheit. Was uns einst vor diesem Deutschland rettete, das stößt uns nun nur noch tiefer hinein. Deutschpop sei Dank.P.S.: Nein, Quatsch. Es gibt immer noch gute Musik, und manches davon ist wirklich incredibly strange und nicht-identitär. Es hat nur nichts mit Deutschpop zu tun. Sondern ist so richtig schön widerspenstig und gibt sich den politischen und ästhetischen Wonnen der Verkrampfung hin.Placeholder infobox-1
×
Artikel verschenken
Mit einem Digital-Abo des Freitag können Sie pro Monat fünf Artikel verschenken. Die Texte sind für die Beschenkten kostenlos. Mehr Infos erhalten Sie hier.
Aktuell sind Sie nicht eingeloggt. Wenn Sie diesen Artikel verschenken wollen, müssen Sie sich entweder einloggen oder ein Digital-Abo abschließen.