Vom Wesen der Parteipolitik
Aus der Sicht des einzelnen Politikers ist Politik die Durchsetzung von Interessen, aus der Sicht des außenstehenden Beobachters ist sie Interessenausgleich. Selbst wenn man einen fairen Interessenausgleich definieren könnte, läuft sie freilich nicht auf einen solchen hinaus, weil verschiedene Gruppen der Gesellschaft verschieden starken Einfluss ausüben können. Ein politisches System ist jedoch nur so lange stabil, wie die benachteiligten Gruppen ihre Benachteiligung entweder nicht bemerken oder im gegebenen Maße gerade noch akzeptieren.
In Deutschland wird der Interessenausgleich durch die Betätigung von Parteien erzielt. Über den Einfluss der einzelnen Parteien entscheiden allgemeine Wahlen. Historisch sind Parteien als Vereinigungen zur Durchsetzung der gemeinsamen Interessen einer gesellschaftlichen Gruppe entstanden. Angesichts der Diversität und Komplexität der heutigen Gesellschaft müsste es sehr viele Parteien geben, wenn dem noch so wäre, und die Koalitionsbildung wäre sehr schwierig.
Parteien eines solchen Zuschnitts würden aber auch aus einem tieferen Grund kein stabiles politischen System ergeben. Wenn klar auf der Hand läge, welche Partei wessen Interessen vertritt, so würde das allgemeine Wahlrecht im zeitlichen Mittel zu einem Interessenausgleich führen, der sich an der zahlenmäßigen Zusammensetzung der Bevölkerung orientiert. In unserem noch immer sehr produktiven Wirtschaftssystem sind die Einflussmöglichkeiten (wirtschaftliche Macht) und Einkommen jedoch sehr ungleich verteilt. Es müsste also zu einem Konflikt zwischen den politischen und wirtschaftlichen Machtverhältnissen kommen. Dieser Konflikt kann dadurch vermieden werden, dass die Parteien den Wähler darüber täuschen, wessen Interessen sie in welchem Maße vertreten.
Im Allgemeinen sind Menschen leicht zu täuschen. Schwierig ist es hingegen, eine große Gruppe von Menschen über lange Zeit mit den gleichen Mitteln zu täuschen. Weil die Verbindung eines kapitalistischen Wirtschaftssystems (Euphemismus: Marktwirtschaft) mit dem allgemeinen Wahlrecht nun aber der Täuschung bedarf, muss sich das politische System fortentwickeln. Unter Entwicklung darf man hier keinen Fortschritt verstehen- Veränderung genügt. Wo die Täuschung offenbar geworden ist, muss aber eine solche Veränderung unbedingt auch stattfinden, um die Stabilität des Systems zu erhalten.
Die Volkspartei
Das beste derzeit „am Markt befindliche“ Täuschungssystem ist die Volkspartei. Sie gibt vor, die gemeinsamen Interessen sehr großer Teile der Bevölkerung, am liebsten des ganzen Volkes zu vertreten. Insofern es solche gemeinsamen Interessen gibt, kann ihr das durchaus auch gelingen. Diese Politikfelder sind aber ohnehin unstrittig und, mit der Ausnahme der Außenpolitik, uninteressant. Politik findet vor allem dort statt, wo es Gegensätze zwischen den Partikularinteressen verschiedener Gruppen der Gesellschaft, also des Volkes, gibt. In einer Volkspartei muss der Ausgleich zwischen diesen Interessen notwendigerweise innerparteilich stattfinden.
Wenn die innerparteiliche Demokratie ideal funktioniert und die Zusammensetzung der Mitglieder in etwa diejenige der Wähler widerspiegelt, löst die Volkspartei den Konflikt zwischen einer ungleichen Macht- und Ressourcenverteilung in der Wirtschaft und dem allgemeinen Wahlrecht zunächst einmal nicht. Dieser Konflikt kann dann durch das Kaufen der Mandatsträger, etwa über Wahlkampfspenden, gelöst werden, wie in den USA. Vornehmer ist es, den Konflikt durch eine „gelenkte“ innerparteiliche Demokratie zu lösen, in der ein enger Machtzirkel die Politik bestimmt. Die Wirtschaftsvertreter müssen dann nur noch diesen Machtzirkel kultivieren, auch wieder plump durch Wahlkampfspenden oder weniger plump dadurch, dass der Machtzirkel ungleich häufiger mit hochrangigen Vertretern der Wirtschaft diniert, als er mit Leuten aus anderen gesellschaftlichen Kreisen zu Abend isst. Diese Verflechtung zwischen wirtschaftlicher und politischer Macht kann auch institutionalisiert werden. Die http://trilateral.org/download/files/TC_list_11_15.pdf Trilaterale Kommission ist ein Beispiel einer solchen Institutionalisierung.
Das Konzept der Volkspartei darf man nicht zu Ende denken, denn wenn eine Partei die Interessen der gesamten Bevölkerung vertreten und ausgleichen kann, braucht es auch nur eine. Man könnte höchstens argumentieren, dass es eine orangene und eine lilafarbene braucht, damit die politische Landschaft nicht zu sehr verfilzt. Die orangene Volkspartei und die lilafarbene würden allerdings, zu Ende gedacht, die gleiche Politik betreiben. Die Wahl würde sich darauf beschränken, welche Personen diese Politik in der Öffentlichkeit erklären, sofern sie wenigstens das täten.
Die Krise der Volksparteien
Es dürfte unstrittig sein, dass die seit Jahrzehnten bestehenden Volksparteien in mehreren europäischen Ländern, zuletzt auch in Deutschland, in eine Krise geraten sind. Es lohnt sich, die historischen Umstände zu betrachten, um zu erkennen, ob nur die jeweiligen Parteien verrottet sind, oder ob das Konzept der Volkspartei sich überlebt hat.
In Deutschland hatte die SPD spätestens nach ihrer Abkehr vom Marxismus und die CDU von Anfang an den Anspruch, Volksparteien zu sein. Gleichwohl waren sie zunächst keine "zu Ende gedachten" Volksparteien. Sie unterschieden sich sichtlich voneinander und vertraten verschiedene Interessen. Die CSU ist ein Sonderfall, denn sie verstand sich von Anfang an als zu Ende gedachte Volkspartei und hat kontinuierlich eine absolute Mehrheit der bayrischen Wähler davon überzeugen können, dass sie diesem Anspruch gerecht wird. Dementsprechend ist Bayern tatsächlich die beste Annäherung an einen Einparteienstaat, die im Rahmen des Grundgesetzes erreicht werden kann.
Das Zu-Ende-Denken der SPD als Volkspartei begann mit der Regierungsübernahme durch Gerhard Schröder 1998. Gleich am Anfang wurde die bisherige Friedenspolitik der SPD kassiert. Deutschland beteiligte sich unter Missachtung der UN-Charta und des eigenen Grundgesetzes an einem Angriffskrieg. Damit ging die SPD in der Außen- und Militärpolitik nicht nur in Richtung der CDU/CSU, sondern sogar über den Konsens innerhalb dieser Parteien hinaus. Fortan waren die SPD und die CDU auf diesem Politikfeld ununterscheidbar. Daran änderte auch die Irak-Kriegs-Scharade vor Schröders Wiederwahl nichts. Hier wurde nur die Öffentlichkeit getäuscht. Deutschland beteiligte sich mit AWACS-Besatzungen und mit in Kuweit in der Reserve stehenden Einheiten zur ABC-Abwehr auch an diesem Krieg.
Die zweite Regierung Schröder gab mit der Agenda 2010 die Vertretung der sozialen Belange von Arbeitern und Angestellten durch die SPD auf. Schröder wandte sich auch gegen die Reform der Vermögenssteuer, die seit 1997 in Deutschland nicht mehr erhoben wird, obwohl ein damaliges Urteil des Verfassungsgerichts keineswegs deren Abschaffung sondern nur deren Reform verlangt hatte. Strittig war nur, dass Grundbesitz und andere Vermögenswerte zuvor unterschiedlich besteuert wurden. Eine Reform, um diesen Unterschied zu beseitigen und die Vermögenssteuer wieder zu erheben, hätte schon durch die erste Regierung Schröder in Gang gesetzt werden müssen. Das Nichtstun in dieser Frage war ein Verrat an der eigenen Klientel. Damit war sie ein Schritt weg von einer Vertretung von Partikularinteressen und hin zu einer zu Ende gedachten Volkspartei.
Auf einem Politikfeld allerdings wahrte das „rot-grüne Projekt“ der Schröder-Regierungen einen Abstand zu CDU und CSU, nämlich in der Gesellschaftspolitik. Dieser Punkt ist so wesentlich, dass man den Beginn der „Berliner Republik“ und das Ende der „Bonner Republik“ auf den Machtwechsel von Kohl zu Schröder 1998 datieren sollte. Die Miefigkeit der Bonner Republik auf diesem Gebiet kann wohl nur ermessen, wer in der DDR aufgewachsen ist und 1990 plötzlich von den kleinbürgerlichen 1950er-Jahre Vorstellungen der westdeutschen Gesellschaft zur Rolle der Frau überrascht wurde. Die Berliner Republik ist tatsächlich toleranter, weltoffener und familienpolitisch moderner als die Bonner.
Diesen Unterschied zwischen SPD und CDU hat dann allerdings Angela Merkel kassiert, durchaus gegen den Willen einer Mehrheit in ihrer eigenen Partei. Als Musterschülerin Helmut Kohls stellte sie alle einflussreichen Konkurrenten in der CDU kalt und tat dann aus einer unanfechtbaren Machtposition, was sie für richtig hielt, ohne viel zu fragen. Das tat sie in Kohls Stil aber zu dessen großem Verdruss, denn seine politischen Meinungen teilt sie nicht.
Merkel hatte gute Gründe. Tatsächlich sah es eine Zeit lang so aus, als ob es für die damaligen gesellschaftspolitischen Vorstellungen der CDU und für deren eng national definiertes Bild davon, wer ein Deutscher sein könne, keinen Wählernachwuchs mehr gäbe. Die Sache lief auch zunächst gut. Zwar waren CDU und SPD nun endgültig ununterscheidbar geworden, aber davon profitierte die CDU und die SPD litt.
Unterscheidbar war nach wie vor die CSU, obwohl sie ebenfalls eine zu Ende gedachte Volkspartei ist. Dieser Unterschied allerdings beruht auf dem Unterschied zwischen Bayern und dem Rest der Bundesrepublik. Er hat dazu geführt, dass die Bruchlinie in der Großen Koalition nicht zwischen CDU/CSU und SPD verläuft, sondern zwischen CSU und CDU/SPD.
Strategisch war freilich die Beseitigung der letzten Unterschiede zwischen CDU und SPD und das begleitende Gerede von alternativloser Politik ein schwerer Fehler. Den Wählern wurde die Täuschung offenbar, auf deren Unsichtbarkeit die Stabilität des Systems beruhte. Die AfD hat die Instabilität nicht erzeugt, nicht einmal Merkels Handeln in der Flüchtlingskrise hat das getan, obwohl viele Kommentatoren das zu denken scheinen. Der kometenhafte Aufstieg der Piratenpartei 2011/2012 und deren ebenso kometenhaftes Verschwinden waren ein frühes Anzeichen dieser Instabilität. Die AfD erlebte ihren ersten Aufstieg nicht als Alternative in der Flüchtlingspolitik sondern in der Geldpolitik. Einen wesentlichen Anteil an ihrem Zulauf hat der Umstand, dass sie überhaupt eine Alternative darstellt, ziemlich unabhängig von den politischen Inhalten.
Die Volksparteien sind am Ende, weil sie zu Ende gedacht wurden.
Warum wird die Linkspartei nicht als Alternative wahrgenommen?
Die Linkspartei hat sich nie als Volkspartei verstanden, obwohl sie Erbin einer Partei ist, die sich in einem anderen System als die Volkspartei verstand und zwischenzeitlich in einigen der 1990 hinzugekommenen Bundesländer Wähleranteile erzielte, mit denen sich die SPD noch als Volkspartei versteht.
Die Linke hat im Gegensatz zur AfD das Problem, in einigen Bundesländern in der Regierungsverantwortung zu stehen oder gestanden zu haben. Es hat sich gezeigt, dass sich dadurch auch nichts ändert. Das allein wäre noch kein Problem, weil jeder versteht, dass die Partei in Koalitionen Zugeständnisse machen muss, aber sie hat gar kein alternatives Programm. Wenn Sie die Führung der Linkspartei fragen, was sie in der Bundesrepublik ändern würde, falls die Partei plötzlich die absolute Mehrheit hätte und was das dann für die Menschen ändern würde, so werden Sie keine Antwort bekommen. Die Partei weiß es nicht.
Die AfD weiß es. Die AfD akzeptiert, dass eine solche Festlegung bedeutet, dass man eben nicht für das ganze Volk wählbar ist, vielleicht nicht einmal für eine Mehrheit. Die AfD hofft, nur noch nicht für eine Mehrheit wählbar zu sein.
Die Linkspartei wird von vielen inzwischen als etablierte Partei wahrgenommen und das nicht zu Unrecht. Viele ihrer Politiker verhalten sich wie etablierte Politiker anderer Parteien. Ja, es gibt Salon-Bolschewismus in der Linkspartei, aber Salon-Bolschewismus ist im kapitalistischen System durchaus akzeptiert, solange er im Salon bleibt.
Und, ach ja, der Obmann der Linkspartei im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages, Stefan Liebich, gehört zur https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Mitgliedern_der_Atlantik-Br%C3%BCcke Atlantik-Brücke e.V. Etablierter kann man kaum sein, nur ein Mitglied in der Trilateralen Kommission bräuchte man vielleicht noch.
Zwischen Skylla und Charybdis
Das schwache Abschneiden der CDU bei den Landtagswahlen im März wurde weitgehend mit Merkels Verhalten in der Flüchtlingskrise erklärt und mit der Stellung, welche die Spitzenkandidaten zu diesem Verhalten eingenommen hatten. Es wurde in Bezug auf die „richtige Haltung“ in der Flüchtlingskrise auch verschieden interpretiert, denn die CDU hat nach rechts an die AfD, aber auch nach „Pro-Flüchtling“ an die Grünen verloren.
Das Problem geht aber viel tiefer als nur bis zur Flüchtlingskrise und die Verluste nach beiden Seiten sind, ja nun, die zwei Seiten der gleichen Medaille. Auf den Rand der Medaille aufgeprägt ist der Satz: Das Konzept der Volkspartei ist gescheitert.
Viele Wähler der Grünen und noch mehr potentielle Wähler der Grünen sind konservativ. Der Öko-Spießer ist, wie jeder Spießer, ein Konservativer. Zum Teil hat es einfach damit zu tun, dass die Politiker und Anhänger der Grünen in die Jahre gekommen sind und mit den Jahren wird man nun mal konservativer (frau auch). Das Konservative ist aber eigentlich von vornherein in der Technikfeindlichkeit angelegt, im Traum vom eigenen Öko-Bauernhof oder wenigstens Landhaus und das Spießige darin, die Konsumption lokaler Produkte zur Ideologie zu erheben.
Die schlauen Schwaben und Badener hatten zuerst erkannt, dass die Grünen die zeitgemäße Version der CDU sind. Zugegebenermaßen war es in Berlin schwerer zu erkennen, wegen des Personals der Grünen, das dort herumläuft. Aber sie können es auch in Berlin sehen, im Stadtbezirk Prenzlauer Berg, oder ein Stück außerhalb im Brandenburgischen auf dem Landgut Borsig. Wenn die CDU nicht um die Öko-Konservativen kämpft, so wird sie diese an die Grünen verlieren.
Die Politik der CDU ist nicht mehr konservativ. Man könnte sogar sagen, sie ist weniger konservativ, als es selbst manchem Öko-Spießer angenehm wäre. Vor allem ist sie aber für diejenigen CDU-Wähler nicht konservativ genug, die niemals die Grünen wählen würden. Für diese gibt es ein Angebot und das Angebot ist die AfD. Die Idee, die 68er seien an allem schuld, hat nicht die AfD erfunden. Diese Idee hat ihren Ursprung in Kreisen, die der CDU (und CSU) nahe standen und zum Teil noch stehen. Viele dieser Leute denken, Merkel habe 68er Ideen in der CDU Vorschub geleistet. Nennen wir die Anti-68er Bismarck-Konservative, Leute deren Idealbild von Deutschland Preußen ist. Wenn die CDU nicht um die Bismarck-Konservativen kämpft, wird sie deren viele an die AfD verlieren.
Die Frage ist nun, ob die CDU-Führung unter diesem Umständen am Konzept einer Volkspartei festhalten kann, oder ob sie sich für eine der beiden Richtungen entscheiden muss. Mit anderen Worten: Gibt es zwischen Skylla und Charybdis eine so breite Fahrrinne, dass ein so großes Schiff wie die jetzige CDU passieren kann?
Ich glaube das nicht. Wahlen werden nicht mehr in der Mitte gewonnen. Andererseits wird die CDU kaum die Grünen in der Gunst der Grün-Konservativen überflügeln und kaum die AfD in der Gunst der Bismarck-Konservativen, es sei denn, diese Parteien machen in Zukunft schwere Fehler. Das wissend, wird die CDU versuchen, in der Mitte zu bleiben. Wenn Deutschland nicht in eine große Krise gerät, werden ihr dort längerfristig um die 15-20% Wähler verbleiben.
Quo vadis CSU?
Für die CDU ist die AfD eine Bedrohung von zweien, für die CSU ist sie eine existentielle Bedrohung. Ein nicht unerheblicher Teil der CSU-Wähler und selbst der CSU-Politiker dürfte insgeheim, in manchen Fällen auch offen, nicht weit von den Positionen der AfD entfernt sein. Die Bismarck-Tümelei in der AfD schützt etwas, weil Preußen in Bayern nicht unbedingt populär ist, aber auf eine lang anhaltende Wirkung dieses Schutzes wird sich die CSU-Führung nicht verlassen wollen. Andererseits muss die CSU wenig Rücksicht auf Öko-Konservative nehmen. Bayern ist weniger vegan, weniger Yoga und weniger versponnen als Prenzlauer Berg.
Die CDU mag in der Mitte bleiben wollen und müssen, die CSU darf der AfD rechts keinen Raum lassen. Vielleicht nicht gleich Minarett-Verbot (käme auf eine Meinungsumfrage an) und EU-Austritt (obwohl, obwohl), aber im Großen und Ganzen darf die AfD nicht als eine Alternative gesehen werden, die viel nationaler und konservativer ist als die CSU.
Die entsprechende Position zu vertreten, wird CSU-Politikern nicht schwerfallen. Sie liegt ihnen, war nur bisher nicht opportun. Das Problem ist die Unglaubwürdigkeit dieser Position innerhalb einer Fraktionsgemeinschaft und gemeinsamen Regierung mit der CDU. Dieses Problem hat nur zwei mögliche nachhaltige Lösungen. Die eine liegt in der Hand der CDU und lautet Ablösung von Angela Merkel, Aufgabe der Öko-Konservativen als potentielle Wähler und Angleichung an die CSU. Die andere liegt in der Hand der CSU und ist die Aufgabe ihrer bundespolitischen Optionen zugunsten einer Stabilisierung ihrer Position in Bayern. Wenn es nicht anders geht, wird die CSU lieber diese Lösung wählen als die absolute Mehrheit in Bayern zu verlieren.
Hat die AfD denn gar keine Probleme?
Die Hoffnung von SPD und CDU auf eine Implosion der AfD bei ihrem Parteitag hat sich nicht erfüllt. Die CSU hat diese Illusion vermutlich nie gehabt. Die SPD- und CDU-Führung müssen diese Hoffnung wohl gehabt haben. Anderenfalls sind sie miese Strategen, denn ohne diese Hoffnung hätten sie in den vergangenen Monaten ganz anders handeln müssen.
Die AfD hat sich konsolidiert. Sie hat eine zu stark anti-amerikanische Positionierung (NATO-Austritt) vermieden, die zu ihrer Zersetzung durch US-Dienste geführt hätte. Sie hat sich auf ein Programm geeinigt, dass den Journalisten und anderen Politikern extrem erscheint, nicht aber denjenigen, die sie gewählt haben oder laut Meinungsumfragen wählen würden. Die Programmfestlegung hatte kaum Einfluss auf die Umfragewerte, was auch die Hoffnung obsolet macht, die AfD habe nur davon profitiert, dass sie sich in vielen Fragen eben noch nicht festgelegt hatte.
Der Parteitag war auch eine Demonstration dessen, dass die Parteiführung organisieren und Einigkeit herstellen kann. All das ist unter allem an Störfeuer geschehen, das die nicht gerade wenigen politischen Gegner der AfD abgeben konnten (bis auf inhaltliche Argumente halt). Nach all dem ist nicht zu erwarten, dass der AfD ein Kollaps der Wählergunst bevorsteht, wie zuvor den Piraten, zumal sie auf absehbare Zeit nicht mit den Schwierigkeiten des Regierens konfrontiert werden wird.
Mittelfristig wird die AfD wohl bei 15-20% Wähleranteil landen. Jede größere Krise könnte allerdings den „Sockelanteil“ erhöhen und äußere Ereignisse, wie etwa Wahl- und Abstimmungserfolge EU-kritischer oder EU-feindlicher Kräfte im Ausland könnten die Drift zu höheren Werten beschleunigen. Selbst wenn es aber 30% wären und die AfD damit stärkste Partei würde - was man nicht ausschließen kann, nicht einmal für die Bundestagswahl 2017 - so wäre das noch keine Katastrophe, weil niemand, gerade auch die CSU nicht, mit ihr koalieren würde. Längerfristig könnte die CSU versucht sein, aus der CDU/CSU-Gemeinschaft in eine AfD/CSU-Gemeinschaft unter ähnlichen Bedingungen lokaler Trennung zu wechseln, aber ich will hier den Teufel nicht an die Wand malen. Auch das würde bundesweit kaum zu einer absoluten Mehrheit reichen.
Die AfD wird die öffentliche Diskussion und das gesellschaftliche Klima beeinflussen, zumal es ohnehin in Deutschland wie auch in anderen westlichen Ländern einen „backlash“ gegen postmoderne Gesellschaftskonzepte gibt. Für „Gender Mainstreaming“ etwa gibt es nicht annähernd eine Mehrheit in der Bevölkerung und die AfD wird das ausnutzen. Sie wird Einfluss unter den Angehörigen von Sicherheitsorganen gewinnen, wie auch bei einigen Vertretern der Wirtschaft. Die Wirtschaftsverbände werden früher oder später versuchen, die AfD zu „kultivieren“, schon als Rückversicherung. Ein Teil der Medien wird weniger AfD-feindlich werden. Wenn mich nicht alles täuscht, ist ein Teil der Journalisten der FAZ schon auf dem Weg. Das wird zunächst den Wähleranteil der AfD erhöhen, weil es die „Stigmatisierungs-Barriere“ niedriger macht.
Dennoch werden die Bäume der AfD nicht in den Himmel wachsen, sofern es nicht zu einer schweren Krise kommt. Die Verabschiedung eines Parteiprogramms hat die AfD auch angreifbarer gemacht. Was zuvor fast völlig unterblieben ist, die inhaltliche Auseinandersetzung, kann jetzt stattfinden und die AfD kann ihr viel schwerer ausweichen als zuvor. Die Zukunft wird nicht nur Erfolge AfD-ähnlicher Kräfte im Ausland bringen, sondern auch Rückschläge für diese Kräfte.
Nicht zuletzt steht die AfD selbst vor einer schwierigen strategischen Entscheidung, die sie irgendwann treffen muss und auf ihrem Parteitag wohlweislich vermieden hat. Will die AfD koalitionsfähig werden und unter welchen Bedingungen würde sie mit wem koalieren? Oder will sie alles auf die eine Karte setzen, dass sie ihre politischen Vorstellungen erst dann umsetzen kann, wenn sie eine absolute Mehrheit erzielt? Der eine wie der andere Weg birgt große Risiken. Man sollte Frau Petry, Frau Storch, Herrn Gauland, Herrn Meuthen und Herrn Höcke immer wieder danach fragen, wie sie sich das vorstellen.

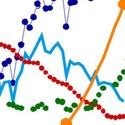




Was ist Ihre Meinung?
Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.