Die am wenigsten widerwärtige Wahl
Der Begriff des „LOP factors“ stammt von Tony Schwartz, der in den 1970er Jahren Fernsehspots für US-amerikanische Politiker entwarf, unter anderem für den 1976 siegreichen Präsidentschaftskandidaten Jimmy Carter. Einer breiteren Öffentlichkeit wurde er durch Vance Packards Buch „The People Shapers“ bekannt. LOP ist der „least objectionable politician“ in einem Wahlkampf, also diejenige Person, gegen die am wenigsten Einwände bestehen. Wenn man das in die emotional aufgeheizte Sprache der heutigen Medienlandschaft übersetzt, so kommt der „am wenigsten widerwärtige Politiker“ heraus. Im diesjährigen Präsidentschaftswahlkampf haben beide Lager ihre Strategie fast völlig darauf abgestellt, den Gegenkandidaten oder die Gegenkandidatin als das absolut Widerwärtige darzustellen. Das Ergebnis ist, dass einer breiten Öffentlichkeit innerhalb und außerhalb der USA nun beide Kandidaten als unakzeptabel erscheinen.
Was immer am 8. November geschehen wird, die USA werden danach von einer Person geführt, die einer Mehrheit der Bevölkerung als nicht vertrauenswürdig gilt. Man kann das daraus schließen, dass Hillary Clinton im Rennen gegen Trump fast durchgängig geführt hat und dennoch in einer CNN-Umfrage im Juli 2016 von 68% der Befragten nicht als vertrauenswürdig und ehrlich angesehen wurde. Wie die Washington Post am 25. Juli berichtete, war dieses Umfrageergebnis kein einmaliger Ausreißer. Nur eine deutliche Minderheit (im Juli 31% laut CBS und 38% laut CNN und Gallup) hatte eine vorteilhafte Meinung von Hillary Clinton. Zwar fiel die Veröffentlichung dieser Umfragen mit dem einzigen Zeitpunkt zusammen, an dem Trump im Mittel mehrerer Umfragen in der Wählergunst vorn lag, aber Clintons Wähleranteil ist in gegenwärtigen Umfragen nur 2% höher als damals. Die Kandidatin wird von einer deutlichen Mehrheit abgelehnt. Der Kandidat von einer noch größeren.
Kongress und Präsident(in)
Die USA sind keine Diktatur. Der Präsident oder die Präsidentin ist mit weit reichenden Vollmachten ausgestattet, aber der Kongress hat ebenfalls weit reichende Möglichkeiten der Machtkontrolle. Gegenseitige Blockaden von Präsidenten und Kongress hat es in den letzten drei Legislaturperioden wiederholt gegeben. In der Regel führten sie zu großen Vertrauensverlusten in die Regierung der USA sowohl innerhalb des Landes als auch im Ausland. Fast unabhängig vom Wahlausgang am 8. November ist mit einer weiteren Zunahme solcher Blockaden zu rechnen.
Gegenwärtig halten die Republikaner 54 und die Demokraten 45 Sitze im Senat. Von den 36 Sitzen, für die am 8. November ebenfalls Neuwahlen anstehen, halten die Republikaner 24. Gegenwärtig ist nicht auszumachen, ob die Demokratische Partei eine Senatsmehrheit erringen wird. Falls Clinton die Präsidentschaftswahl gewinnt, genügen den Demokraten dafür insgesamt 50 Sitze, weil bei einem Unentschieden die Stimme des Vizepräsidenten entscheidet. Es ist aber nahezu gleich wahrscheinlich, dass die Republikaner eine knappe Senatsmehrheit behalten.
Im Repräsentantenhaus stehen alle 435 Sitze zur Neuwahl an. Hier aber erscheint es nach den Umfrageergebnissen nahezu ausgeschlossen, dass die Demokratische Partei eine Mehrheit erringt. Eine Präsidentin Clinton würde sich also sicher einer republikanischen Mehrheit im Repräsentantenhaus und möglicherweise zudem einer republikanischen Mehrheit im Senat gegenübersehen.
Das Verhältnis eines Präsidenten Trump zum Kongress dürfte kaum weniger belastet sein. Das Establishment der Republikanischen Partei hat während der Vorwahlen und selbst während des Wahlkampfes gegen Hillary Clinton wiederholt mit Trump gefremdelt. Wäre sich die Partei in der Unterstützung Trumps wenigstens nach dessen Kandidatenkür einig gewesen, so hätte Clinton wohl nicht die Spur einer Chance auf den Wahlsieg gehabt. Das weiß Trump und er hat das mehrfach durchblicken lassen. Für ihn ist das Verhältnis also belastet. Dass es auch für die Abgeordneten belastet ist, darf man ganz sicher schließen. In seinem Buch „Great Again. Wie ich Amerika retten werde“ (deutsche Übersetzung), zitiert Trump auf Seite 82 Mark Twain mit den Worten „Mal angenommen, Sie sind ein Idiot, und mal angenommen, Sie sind Kongressmitglied – aber ich wiederhole mich.“ Wer so etwas als Präsidentschaftskandidat in das Buch schreibt oder schreiben lässt, das als sein Wahlprogramm gilt, der darf wohl mit Fug und Recht selbst als Idiot bezeichnet werden.
Verschwörungstheorien auf beiden Seiten
In den deutschen Medien gilt es als Binsenweisheit, dass Trump Verschwörungstheorien anhängt. Nun ist das nicht in jedem angeführten Fall richtig. So ist zum Beispiel Trumps Misstrauen gegenüber den US-Leitmedien berechtigt. Es ist kein Geheimnis, dass die New York Times frontal gegen Trump kämpft und dabei ein, sagen wir, eher loses Verhältnis zu Wahrheit und journalistischer Redlichkeit pflegt. Auch war der Versuch plump, Trump dazu zu bewegen, dass er eine sofortige Anerkennung des ausgezählten Wahlergebnisses bereits vor der Wahl zusichert und nach seiner Weigerung zu behaupten, noch nie habe ein Kandidat die Gültigkeit einer Wahl in den Raum gestellt. Es war der Demokrat Al Gore, der 2000 eine wiederholte Auszählung der Stimmen in mehreren Wahlkreisen des Staates Florida gerichtlich erzwang. Diese Wahl wurde letztendlich durch das Oberste Gericht entschieden, das bei einem Vorsprung von nur 537 Stimmen für George W. Bush im Staat Florida die Nachauszählung verbot.
Gleichwohl ist offensichtlich, dass Trump mehr Verschwörungen gegen sich vermutet, als es gibt und dafür blind ist, dass ihm die Ablehnung vieler Leute einfach aufgrund seines eigenen Verhaltens entgegenschlägt. Das ist keine Verschwörung, sondern ganz normales menschliches Verhalten.
Ironischerweise trifft genau das Gleiche auf Hillary Clinton zu und zwar bereits seit den Zeiten, in denen Bill Clinton Präsident war. Die Beiden haben sich auf verschiedene Weise wiederholt anstößig verhalten und dann die Reaktionen darauf als „rechte Verschwörung“ dargestellt. Vermutlich glauben sie daran.
Der neueste Fall, in dem es um den FBI-Direktor geht, verdient nähere Betrachtung. James Comey hat völlig korrekt gehandelt. Er selbst hatte zuvor dem Kongress bezeugt, dass die FBI-Untersuchungen bezüglich der E-Mail-Affäre von Hillary Clinton abgeschlossen seien. Dann gab es zunächst völlig unabhängige Untersuchungen im Fall des demokratischen Kongressabgeordneten Weiner, der zu unappetitlich ist, um an dieser Stelle näher diskutiert zu werden. Bei diesen Untersuchungen sind viele E-Mails von Clinton auf einem Laptop aufgetaucht, den Weiner und dessen Partnerin Huma Abedin gemeinsam benutzt hatten. Huma Abdein ist eine Beraterin und die vermutlich engste Vertraute von Hillary Clinton. Da Clinton die E-Mails von ihrem eigenen Server gelöscht und damit eine nähere Untersuchung verunmöglicht hatte, müssen diese neu aufgefundenen E-Mails zunächst einmal überprüft werden, weil ja ein Anfangsverdacht gegen Clinton im Raum stand, der damals nicht bewiesen werden konnte. Das erforderte eine Wiedereröffnung der Untersuchung und einen Durchsuchungsbefehl, weil das FBI die in der Weiner-Untersuchung aufgetauchten E-Mails sonst nicht als mögliches Beweismaterial im Fall Clinton hätte in Betracht ziehen dürfen. Comey hatte gar keine Wahl: Die Untersuchung musste wiedereröffnet werden und die Vorsitzenden der entsprechenden Kongress-Komitees mussten auch darüber informiert werden.
Genau das und nichts weiter hat Comey getan. Daraufhin haben Clinton und das demokratische Lager mit dem FBI eine der am meisten respektierten amerikanischen Institutionen angegriffen. Das ist eine Idiotie ähnlichen Ausmaßes wie das Mark-Twain-Zitat in Trumps Buch. Und es zeigt, dass Clinton der neuerlichen Untersuchung eben nicht gelassen entgegensieht. Genau das nämlich hätte sie sagen müssen und nichts weiter: Dass sie der Untersuchung sehr gelassen entgegen sieht. Dabei hätte Huma Abedin an ihrer Seite sein sollen. Offenbar sieht aber das Clinton-Lager Huma Abedins Benutzung von Weiners Laptop und die Entdeckung der E-Mails als Problem an. Das lässt eher vermuten, dass der Inhalt dieser E-Mails problematisch ist.
Der verlorene Wahlkampf
Diesen Wahlkampf verliert nicht nur einer der Kandidaten. Diesen Wahlkampf hat die ganze USA verloren. Zwar geht es bei jeder Wahl zuerst einmal um die Macht, aber in einer Demokratie geht es normalerweise eben auch um eine Selbstvergewisserung der Gesellschaft, in welche Richtung sie in der näheren Zukunft gehen will. Im Idealfall wird zwischen verschiedenen Zukunftsentwürfen entschieden. Die Zukunftsentwürfe von Clinton und Trump sind zwar fast diametral entgegengesetzt, aber darüber wurde kaum diskutiert und das wird die Entscheidung einer Mehrheit der Wähler nicht bestimmen.
Je länger dieser Wahlkampf andauerte, je stärker wurde er zu einer Herabwürdigung der Persönlichkeit des Gegners. Jeder zivilisierte Mensch weiß heutzutage, dass man in Auseinandersetzungen nur das Verhalten des Widerparts angreifen darf, nicht aber dessen Persönlichkeit. Letzteres verunmöglicht jede Übereinkunft und belastet das gegenseitige Verhältnis auf Dauer. Es verwundert wohl niemanden, dass Trump in diesem Sinne unzivilisiert ist. Die erschreckende Beobachtung in diesem Wahlkampf war, dass das Gleiche auf Hillary Clinton und auf viele ihrer stärksten Unterstützer zutrifft. Damit will ich nichts gegen Michelle Obama gesagt haben, die ich unabhängig von ihrer Unterstützung Clintons schätze und die das Herz auf dem rechten Fleck hat.
Auf jeden Fall hat diese Schlammschlacht die Diskussion über Zukunftsentwürfe völlig verdrängt. Hinzu kommt, dass der Zukunftsentwurf Clintons auch von Teilen des demokratischen Lagers grundsätzlich abgelehnt wird, so wie derjenige Trumps von Teilen des republikanischen Lagers. Im Ergebnis hat sich die Gesellschaft der USA eben nicht darüber verständigt, in welche Richtung sie gehen will, sondern bestenfalls darüber, welche von zwei ungeliebten Personen das kleinere Übel ist. Das ist keine gute Grundlage, um Probleme anzugehen.
Solche Probleme gibt es, zum Beispiel in der Infrastruktur und in der Schulbildung. Sie sind gravierend und sie sind beiden Lagern bewusst. Das Land muss sich über die Wege verständigen, auf denen man diese Probleme angeht, denn die Meinungsverschiedenheiten zwischen den Lagern betreffen nicht die Diagnose, sondern die Frage, welche Therapie hilft. Angesichts der Mehrheitsverhältnisse erfordert das Kompromisse. Solche Kompromisse zu finden, wird in dem gründlich vergifteten Klima nach dieser Wahl kaum möglich sein.
Paradoxerweise demonstriert dieser Wahlkampf das, was der vermutlich unterliegende Kandidat von Anfang an behauptet hat: Das Versagen des politischen Establishments gegenüber den Herausforderungen, vor denen die USA heute steht.
Niemand sollte das mit Schadenfreude sehen, auch diejenigen nicht, die der imperialen Außenpolitik der USA seit jeher kritisch gegenüber stehen. Die USA werden relativ gesehen ohnehin schwächer, weil andere Mächte, wie etwa China, stärker wachsen. Eine interne politische Abwärtsspirale wäre fatal, zumal eine innenpolitisch frustrierte Präsidentin Clinton dazu neigen könnte, ihr Glück in einer für die USA möglichst günstigen Aufteilung Syriens zu suchen. Clinton hat ausweislich ihrer Wahlkampfführung wohl kaum so viel Augenmaß, dass sie im Vorhinein erkennen wird, ob sie dadurch auf gefährliche Weise mit Russland aneinander gerät. Clintons außenpolitische Visitenkarte ist der gegenwärtige Zustand Libyens. Das verheißt nichts Gutes.
Eine Wahlempfehlung
Bei dieser Wahl wird nichts Gutes herauskommen. Dennoch will ich mich nicht um eine Empfehlung herumdrücken und diese lautet, Jill Stein zu wählen. Dagegen wird gern ins Feld geführt, es helfe Trump, weil es vor allem aus Clintons Lager Wähler abziehen würde. Ich halte dieses Argument für plausibel, aber politisch gesehen trotzdem für falsch.
Auf die Dauer ist es fatal, dass sich US-Wahlen auf die Kandidaten zweier Parteien reduzieren, die mittlerweile beide nicht mehr in der Lage sind, akzeptable Kandidaten aufzustellen. Zudem könnte ein Präsident Trump paradoxerweise der bessere Wahlausgang sein als eine Präsidentin Clinton, obwohl er zweifellos noch ungeeigneter für das Amt ist als sie. Der Grund dafür liegt in der Machtbeschränkung des Präsidenten oder der Präsidentin durch andere Institutionen. Der politisch unerfahrene Trump wird keine seiner extremeren Positionen durchsetzen können. Clinton hingegen kennt jeden Trick und Kniff, den es in Washington braucht, um die Gegenseite auszumanövrieren und hat große Netzwerke. Sie wird vom System schlechter kontrolliert werden, als es bei Trump der Fall wäre.
Das beste Ergebnis wäre freilich ein Präsident Tim Kaine, nachdem Clinton gewählt wurde und aus rechtlichen Gründen innert nützlicher Frist, wie der Schweizer schreibt, zurückgetreten wäre. Dieser Ausgang ist allerdings hochgradig unwahrscheinlich.
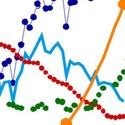




Was ist Ihre Meinung?
Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.