Manuskripte brennen nicht.
Mikhail Bulgakow, Der Meister und Margarita
Dies ist die Geschichte eines mathematischen Artikels, der zunächst vom Mathematical Intelligencer zur Veröffentlichung angenommen worden war, dann aber dort nicht veröffentlicht wurde, ohne dass dem Autor wissenschaftliche Gründe für die Rücknahme der Entscheidung mitgeteilt wurden. Der Artikel wurde schließlich im New York Journal of Mathematics publiziert, dort aber schnell wieder entfernt und durch einen anderen Artikel mit den gleichen Seitennummern ersetzt. Datenbanken zur Literatursuche sind untereinander uneinig, ob es den ersten Artikel noch gibt. Das Web of Science von Clarivate Analytics (nicht kostenfrei zugänglich) und Google Scholar finden ihn noch, während Scopus (auch kostenpflichtig) ihn nicht kennt, wohl aber denjenigen, der ihn auf den gleichen Seiten ersetzt hat. Google Scholar verweist auf den Server des New York Journal of Mathematics, auf dem eine PDF-Datei des Artikels offenbar noch liegt. Was ist hier geschehen?
Die Perspektive des Autors Theodore Hill, emeritierter Mathematikprofessor des Georgia Tech, ist auf Quillette beschrieben, wo sich auch ein Link zu Dokumenten befindet, die seine Version belegen. Kurz zusammengefasst ist es so gelaufen. Theodore Hill hatte sich mit Sergei Tabachnikov, einem aktivem Mathematikprofessor an der Pennsylvania State University, zusammengetan, der Hills Theorie unterfütterte. Nachdem das Manuskript vom Mathematical Intelligencer angenommen worden war, veröffentliche Tabachnikov einen Vorabdruck auf seiner Webseite (durchaus üblich). Daraufhin kam es zu einer Kontroverse mit der Unterorganisation von Women in Mathematics (WIM) an der University of Pennsylvania, die den mathematischen Artikel als potentiell sexistisch ansah. Der Artikel enthielt eine Danksagung an die National Science Foundation (NSF) der USA. Diese meldete sich alsbald mit dem Verlangen, dass die Danksagung entfernt werde, weil der Artikel keinen Bezug zu Tabachnikovs gefördertem Projekt habe. Später stellte sich heraus, dass dieses Verlangen der NSF auf einen Brief zweier Professorinnen der Pennsylvania State University zurückging. Der Mathematical Intelligencer, von einer Professorin der University of Chicago und ihrem Vater kontaktiert, zog die Akzeptanz des Manuskripts zurück. Schließlich bekamen Tabachnikov und ein weiterer Kollege, der Simulationen des Modells durchgeführt hatten, kalte Füße und zogen ihre Namen zurück.
Einer der Herausgeber des New York Journal of Mathematics, der von der Geschichte Wind bekommen hatte, bat Hill dann an, ein revidiertes Manuskript doch dort einzureichen. Es gab eine weitere Begutachtungsrunde, weitere kleine Korrekturen und am 6. November 2017 wurde der Artikel dort veröffentlicht. Drei Tage später war er wieder verschwunden und noch ein paar Tage danach übernahm ein Artikel von Kumar, Sahni und Sing die Seiten, die zuerst Hills Artikel innegehabt hatte. Wieso kann ein relativ simples Modell, dessen mathematische Plausibilität sogar für Laien nachvollziehbar ist, zu einer derartigen Kontroverse führen?
Das Problem ist der Bezug des Modells zur Variabilitätshypothese, die besagt, dass viele Eigenschaften bei den männlichen Vertretern einer Spezies eine höhere Variabilität aufweisen als bei den weiblichen. Weiter unten werde ich diskutieren, warum diese Hypothese Gegenstand ideologischer Kämpfe ist. Darwin hat sie in der Diskussion einer ganzen Reihe von Beobachtungen verwendet, nicht aber erklärt, wieso die Evolution zu einem solchen Ergebnis führen sollte. Erst vor wenigen Jahren wurde die stärkere sexuelle Konkurrenz unter männlichen Tieren, wie man sie bei vielen Säugetieren tatsächlich beobachtet, als mögliche Ursache angesehen. Hier setzt Hills Modell an.
Weibliche Säugetiere tragen den Löwinnenanteil des reproduktiven Aufwands und erhöhen daher ihre Fortpflanzungschancen durch die Qualität ihrer Partner. Männliche Säugetiere tun das vorzugsweise über die Quantität. Mit anderen Worten, weibliche Säugetiere sind selektiver in ihrer Partnerwahl. Die Eleganz von Hills Ansatz besteht nun darin, diesen Gedanken mittels minimaler Grundannahmen zu formalisieren und dann zu zeigen, dass daraus evolutionär tatsächlich eine höhere Variabilität der Eigenschaften beim männlichen Geschlecht resultiert. Wenn die Weibchen ihre Partner unter den Besten auswählen und zwar unter weniger als 50%, so erhöht das die Variabilität der Eigenschaften bei den Männchen. Umgekehrt, und das ist auch als Hypothese neu, wenn die Männchen bei der Partnerinnenwahl mit mehr als 50% des Eigenschaftsspektrums zufrieden sind, verringert das evolutionär die Variabilität der Eigenschaften bei den Weibchen. So weit, so gut, so plausibel und mathematisch mit wenigen zusätzlichen Annahmen beweisbar.
Das Problem tritt auf, weil die Variabilitätshypothese auch für kognitive Eigenschaften des Menschen getestet worden ist und durch empirische Daten gestützt wird. Wenn sie darauf zutrifft, folgen zwei Dinge. Erstens gibt es mehr männliche Idioten. Dieser Befund dürfte unkontrovers sein, besonders unter Frauen. Zweitens gibt es dann aber auch mehr männliche Genies. Das ist für die wenigsten Menschen von Interesse, weil es ohnehin wenige Genies gibt. Es ist aber hochrelevant für diejenigen, die Quotenregelungen für intellektuell anspruchsvolle Spitzenpositionen fordern. Wenn nämlich die Variabilitätshypothese für kognitive Eigenschaften des Menschen richtig ist, so wird sich bei Chancengleichheit keine Gleichverteilung von Männern und Frauen auf diesen Positionen einstellen. Im Umkehrschluss folgt: Wenn eine solche Gleichverteilung durch eine Quote erzwungen wird, herrscht keine Chancengleichheit mehr. Weil dagegen logisch nicht anzukommen ist, müssen QuotenbefürworterInnen die Variabilitätshypothese ohne Ansehen empirischer Daten verwerfen. Die Hypothese gilt, zumindest bezogen auf menschliche kognitive Eigenschaften, als sexistisch und deshalb im Wortsinne als undiskutabel.
Nun kann ich verstehen, dass einige Frauen in der Mathematik und den Naturwissenschaften empfindlich sind, wenn diese Hypothese diskutiert wird. Zu viele von ihnen haben irgendwann mal den dummen Spruch gehört: „Lass das sein, das ist nichts für Dich, Du bist ein Mädchen.“ Dieser dumme Spruch wird nicht klüger, wenn die Variabilitätshypothese zutreffen sollte. Erstens ist Statistik nur im Grenzfall großer Zahlen anwendbar. Wenn ich in einem Jahrgang etwa 20 Studentinnen und 40 Studenten in einem Fach prüfe, in dem Verständnis stark mit mathematischer Intelligenz korreliert, kann die brillanteste Leistung durchaus von einer Studentin erbracht werden (das habe ich tatsächlich schon erlebt). Das widerlegt die Hypothese noch nicht, die Zahlen sind zu klein. Zweitens reden wir in den allermeisten Fällen nicht über Fähigkeiten weit außen im positiven Flügel der Verteilung (Genies). Man erwartet nicht zu weit vom Mittelwert entfernt nur eine leichte Schieflage der Verteilung, nichts, was ein Individuum irgendwie beunruhigen sollte. Drittens haben Frauen, die sich weit außen im positiven Flügel befinden, in der Regel auch keine Probleme – zumindest keine anderen als Männer in der gleichen Situation. Wenn eine sehr viel schneller denken kann als die meisten anderen Menschen, so reicht ihre Beobachtungsgabe in aller Regel aus, das auch zu erkennen. Das wir nichtdestotrotz weniger Frauen in der Mathematik, den Naturwissenschaften, der Informatik und der Technik haben, als intellektuell dafür geeignet wären, trifft sicher zu. Ein großer Teil des Problems dürfte allerdings darin liegen, sie für diese Fächer zu interessieren. Sie können mit ihrem Intellekt ja auch etwas Anderes anfangen – und sollten das dürfen. Soweit zur ideologischen Abschweifung, die leider nötig war.
Im Folgenden nehme ich an, dass ein Artikel wie derjenige von Hill tatsächlich einen Einfluss auf die ideologische Debatte hätte. Das ist etwas weit hergeholt, denn Hill diskutiert nicht im Detail die empirische Evidenz für die Variabilitätshypothese (die zitiert er nur, um das Problem einzuführen). Er stellt die Frage, ob ihr Zutreffen auf irgendwelche Eigenschaften irgendwelcher Spezies evolutionär durch Selektivität bei der Partnerwahl erklärbar ist. Das ist in seinem Modell der Fall. Man könnte nun die Modellannahmen kritisieren, andere Modellannahmen suchen, unter denen dem vielleicht nicht so ist und aus all dem könnte man etwas lernen. Das wäre Wissenschaft. Und das wird nicht stattfinden, denn für einen aktiven Mathematiker grenzt es an professionellen Selbstmord, sich diesem Thema zuzuwenden.
Soll man also, aus ideologischen Gründen, auf die Untersuchung bestimmter Fragen selbst auf einem abstrakten Niveau verzichten? Soll jede Fragestellung, die irgendeinen Bezug zum Identitätsverständnis bestimmter Gruppen hat, Anathema für die Wissenschaft sein? Soll man dieses Prinzip auf Umwelt- und Gesundheitsfragen ausdehnen, auf die Geschichtswissenschaft, die Soziologie, die Literaturwissenschaft und auf mathematische Modelle in all diesen Gebieten? Was bleibt dann noch übrig?
Freiheit ist die Freiheit zu sagen, dass 2 + 2 = 4 ist. Wenn das zugestanden wird, folgt daraus alles Andere.
George Orwell, 1984
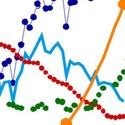




Was ist Ihre Meinung?
Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.