Politiker bestimmter Richtungen berufen sich gern darauf, dass ihre Entscheidungen der Wissenschaft folgen und daher alternativlos sind. Umgekehrt beruft sich eine bestimmte Sorte von Wissenschaftlern gern darauf, dass sie sehr viel größeren politischen Einfluss haben sollten als andere Bürger, weil sei im Gegensatz zu diesen wissen würden, was die richtigen Entscheidungen sind. Diese Symbiose zwischen Großpolitikern und Großwissenschaftlern ist letzthin etwas in Verruf gekommen, nachdem sich herausgestellt hat, dass einige auf dieser Basis gefällte Entscheidungen wohl doch nicht so gut waren. Ganz sicher waren sie nicht intellektuell unanfechtbar. Hier versuche ich zu ergründen, was Wissenschaft und Politik einander zu sagen haben. Meine Thesen sind, dass zwischen Politik und Wissenschaft ein Spannungsfeld bestehen muss, wenn eine Gesellschaft nicht stagnieren soll und dass Wissenschaftler sich nicht als Hohepriester einer Staatsreligion eignen. Zunächst definiere ich, wie ich die Begriffe im Titel meines Blogbeitrags verstehe.
Wissenschaftlichkeit
Wissenschaftlichkeit ist wesentlich unpolitisch. Sie besteht darin, unbeeinflusst von anderen Interessen nach der Wahrheit auf einem bestimmten Gebiet zu suchen. Dabei ist bereits verstanden, dass man sich dieser Wahrheit nur annähern kann, also niemals im Besitz der absoluten Wahrheit ist. Eine solche interesselose Suche ist natürlich immer nur ein Ideal. Wissenschaftler sind Menschen, die soziale Anerkennung und ein materiell gutes Leben anstreben, wie andere Menschen auch. Es ist aber wichtig, dass dieses Ideal als Ideal bestehen bleibt und dass es die Spielregeln bestimmt, nach denen Wissenschaftler ihr allgemeinmenschliches Streben in der Wissenschaft verwirklichen können.
Warum ist Wissenschaftlichkeit in diesem Sinne unpolitisch? Praktische Politik erfordert ein ausdauerndes Festhalten an bestimmten Ideen. Wenn ein Politiker bemerkt, dass eine von ihm bislang verfolgte Idee möglicherweise oder sogar ganz bestimmt falsch ist, wird er das in der Regel nicht äußern, zumindest nicht gleich. Es ist eine komplexe Abwägung, ob er wider besseres Wissen weiter an der Idee festhält, sie langsam verschwinden lässt oder, in einzelnen Fällen, doch einen plötzlichen Schwenk vollzieht. Die Hauptdeterminante dieser Abwägung ist die Frage des Machterhalts. Eine solche Abwägung ist dem Wissenschaftler untersagt. Eine Idee wider besseres Wissen zu verteidigen ist in der Wissenschaft Fehlverhalten, so wie es Fehlverhalten ist, einen Fehler nicht einzuräumen, den man erkannt hat. Schon daraus ergibt sich ein Spannungsfeld zwischen Politik und Wissenschaft – im Allgemeinen und in der einzelnen Person.
Was die einzelne Person betrifft, so besteht ein Interessenkonflikt zwischen der Rolle als Wissenschaftler und der Rolle in der Politik. Wissenschaftler sind häufig politische Menschen und dürfen das natürlich auch sein. Problematisch wird es aber, wenn sie eine politische Agenda verfolgen, die mit ihrer eigenen wissenschaftlichen Arbeit verquickt ist. Diese Versuchung ist auf manchen Arbeitsgebieten, wie etwa in der Klimaforschung, groß. Das Verfolgen einer politischen Agenda ist mit ergebnisoffener Forschung unvereinbar.
Dennoch hat gute, ergebnisoffene Forschung der Politik etwas zu sagen. Sie gelangt zu Ergebnissen, welche in der Regel auf ihrem Gebiet die zum gegebenen Zeitpunkt beste verfügbare Annäherung an die Wahrheit sind. Diese Ergebnisse – und ihre Unsicherheit – der Gesellschaft so verständlich wie möglich zu kommunizieren, ist Aufgabe der Wissenschaft. Aus diesen Ergebnissen gesamtgesellschaftliche Schlussfolgerungen zu ziehen und dabei verschiedene Interessen gegeneinander abzuwägen, ist Aufgabe der Politik. In den Diskussionen darüber hat der Wissenschaftler als politischer Mensch die gleiche Stimme wie jeder andere politische Mensch auch – nicht mehr und nicht weniger.
Szientismus
Der Szientismus sieht die Dinge anders als ich sie im vorhergehenden Abschnitt dargestellt habe. Er geht davon aus, dass die wissenschaftliche Methodik auf die Politik anwendbar ist. Wenn dem so wäre, so ließen sich richtige politische Entscheidungen berechnen oder argumentativ ermitteln und wären dann tatsächlich alternativlos. Natürlich verbleibt gerade mit einer wissenschaftlichen Methode eine gewisse Unsicherheit, die im Idealfall quantifiziert werden kann. Es ließe sich jedoch die wahrscheinlich beste Entscheidung ermitteln und diese müsste dann getroffen werden.
Dieses Programm hat sich offensichtlich bisher nicht verwirklichen lassen. Wer selbst einmal Politik betrieben hat, wenn auch nur in kleinem Rahmen, und wenigstens rudimentär zur Reflektion neigt, weiß, dass dieses Programm weltfremd ist. Das liegt schon daran, dass am Ende einzelne Menschen entscheiden und dass das Verhalten einzelner Menschen nicht mit nützlicher Sicherheit vorhersagbar ist. Interessant wäre allerdings, ob sich das Programm verwirklichen ließe, wenn eine künstliche Intelligenz (KI) die Entscheidungen träfe. Das glaube ich aus zwei Gründen nicht, einem praktischen und einem theoretischen.
Der praktische Grund ist, dass Menschen, wie von Nietzsche betont, einen Willen zur Macht haben, zumindest ein großer Teil von ihnen. Sie würden eine KI als Instrument zum Machterwerb und Machterhalt begrüßen. Sie würden aber keinesfalls die Macht selbst, also die Entscheidungsbefugnis, an die KI abgeben wollen. Sobald Machtfragen involviert sind, versagt die wissenschaftliche Methode, wie oben angedeutet. Wenn mehrere KI im politischen Raum agieren würden, müssten zudem auch diese der Logik der Macht folgen, statt (nur) dem Ziel, optimale Entscheidungen zu treffen.
Nehmen wir an, dass der praktische Grund wegfällt. Dafür muss sich die Menschheit einigen, die Macht an eine KI abzugeben. Dann kommt der theoretische Grund zum Tragen. So, wie sich außer dem Baron Münchhausen niemand am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen kann, muss die KI bei der Berechnung der Entscheidungen von irgendetwas ausgehen. Die Menschheit muss sich also auch auf eine Liste von Zielen einigen, die sie der KI zusammen mit der Macht übergibt.
Ferner nehmen wir an, dass die KI sich strikt an diese Ziele hält, keine eigenen verfolgt und perfekt programmiert ist. Was nun geschehen wird, hängt davon ab, ob die Ziele konkret oder vage waren. Waren sie konkret, so wird sich nach einiger Zeit herausstellen, dass die Entwicklung einige Ziele obsolet gemacht hat und dass andere wichtige Bedürfnisse entstanden sind. Der Fall der vagen Ziele wurde schon von der griechischen Mythologie mit viel Vergnügen abgehandelt. Die Ergebnisse werden dann nicht annähernd den Erwartungen entsprechen.
Was nun geschieht, hängt davon ab, ob die Menschheit die Macht vollständig und endgültig an die KI abgegeben hatte. Wenn ja, endet es sowohl mit konkreten als auch mit vagen Zielen in Dystopien. Wenn nicht, wird die Menschheit neben der KI eine Machtstruktur und auch eine politische Struktur aufrechterhalten müssen. Beides ist nötig, um über die Aktualisierung der Ziele zu entscheiden. Diese Strukturen befinden sich dann wieder außerhalb der Gültigkeit des szientistischen Lösungsansatzes – und sie sind die eigentlich entscheidenden.
Politik
Politik ist die Kunst des Interessenausgleichs. Auch das ist ein Ideal, weil Politiker Machtinteressen verfolgen und um ihr materielles Wohlergehen besorgt sind, wie andere Menschen auch. Aber auch dieses Ideal muss als Ideal aufrechterhalten werden. Politik, die keinen Interessenausgleich mehr leistet, ist dysfunktional und führt auf die Dauer zum Sturz dieser politischen Klasse. Ohne Interessenausgleich zerfällt die Gesellschaft.
Zur Rechtfertigung ihres Machinteresses können die Politiker dem Umstand anführen, dass der Machtkampf der Politik inhärent ist. Interessengruppen werden versuchen, diejenigen Politiker von der Macht zu verdrängen, die anderen Interessengruppen dienen. Der Ausgleich funktioniert nur, wenn es auf allen Seiten standfeste Politiker gibt, die nicht so einfach aus ihren Positionen hinaus zu intrigieren sind. Funktionierende Politik ist daher notwendig ein ständiger Kampf, in dem auch notwendig nicht immer nur die gleiche Seite siegen kann.
Das Verhältnis von Politik und Wissenschaft
Wegen der grundsätzlich verschiedenen Funktionsweise beider Sphären gibt es ein Spannungsfeld zwischen Politik und Wissenschaft. Gute Politik ist durch Wissenschaft gebunden, aber nicht determiniert. Wenn etwa ein Wissenschaftler unwiderlegbar vorrechnet, dass eine bestimmte Art der Energieversorgung nicht wie geplant funktionieren kann, so darf die Politik nicht an diesem Plan festhalten. Sie muss aber durchaus nicht einem Alternativvorschlag folgen, den vielleicht eben dieser Wissenschaftler gemacht hat. Sie kann den Plan anpassen, so dass er doch aufgeht oder sie kann etwas ganz Anderes tun, das die Energieversorgung sicherstellt.
Dieses Beispiel lässt sich erweitern. Ganz gleich, was die Wissenschaft herausfindet und zusammen mit der Unsicherheit dieser Aussage in den politischen Prozess einspeist, es gibt immer Alternativen, um damit umzugehen. Diese Alternativen sind für verschiedenen Interessengruppen von Vorteil oder Nachteil. Die Entscheidung muss also wiederum durch Interessenausgleich ausgehandelt werden. Für dieses Aushandeln sind Wissenschaftler in aller Regel nicht überdurchschnittlich befähigt. Die meisten sind auch in machtpolitischen Fragen nicht sehr bewandert. Zumindest Letzteres muss man Politikern zugestehen – sie sind in ihren Positionen, weil sie wenigstens das konnten. Was ihnen in der Regel fehlt, ist Sachverstand. Um diesen Mangel auszugleichen, brauchen sie Experten, die in vielen, aber nicht allen Fällen Wissenschaftler sind.
Dieses Wechselspiel kann nur funktionieren, wenn beide Seiten ihre Beschränkungen kennen und nicht zu arrogant sind, auf die jeweils andere Seite zu hören. In letzter Zeit scheint es daran in westlichen Gesellschaften auf beiden Seiten zunehmend zu fehlen. Ziemlich viele Wissenschaftler fühlen sich zu Hohepriestern einer neuen szientistischen Religion berufen. Ziemlich viele Politiker setzen bei sich selbst einen generalistischen Sachverstand voraus, den sie nicht annähernd besitzen.
Die Sache ist sogar noch komplizierter. Um überhaupt sinnvoll miteinander kommunizieren zu können, müssen Vertreter beider Seiten wenigsten etwas Einblick in den jeweils anderen Bereich haben. Ein Politiker braucht eine ausreichende Intelligenz, eine ausreichende Allgemeinbildung und hinreichenden praktischen Verstand, um Aussagen eines Experten in Frage stellen zu können. Er muss den Experten mit gegenläufigen Aussagen anderer Experten konfrontieren und dann feststellen können, welcher Experte die besseren Argumente hat. Diese Eigenschaften erwirbt niemand, der schon als Berufspolitiker anfängt, also selbst immer nur Machtfragen, aber nie Sachfragen bearbeitet hat.
Umgekehrt muss ein Wissenschaftler die Bedingungen des politischen Kampfes wenigstens in Grundzügen verstehen, um an Politikern nicht vorbeizureden. Kommunikation hat immer auch eine psychologische Komponente. Ein Politiker wird blockieren, wenn er das, was ihm mitgeteilt wird, als eine Bedrohung seiner Machtposition empfindet. Es ist auch kontraproduktiv und steht dem Wissenschaftler nicht zu, den Politiker steuern zu wollen. Der Grundtenor erfolgreicher Kommunikation ist der Folgende. Wir haben etwas gefunden, das für Ihre Entscheidungsfindung sehr wahrscheinlich relevant ist. Das ist unser Ergebnis und das ist die Unsicherheit unseres Ergebnisses. Wir denken, dass deshalb dies und jenes geschehen könnte, wenn man nichts unternimmt. Der gute Politiker wird dann darlegen, was politisch in welchem Zeitraum umsetzbar sein könnte und nachfragen, ob die Wissenschaft die jeweiligen Auswirkungen abschätzen kann. Wenn man auf diese Weise im Gespräch bleibt und sich am besten nach der Abstimmung gemeinsam an die Öffentlichkeit wendet, kann wissenschaftsbasierte Politik funktionieren, ohne Szientismus zu sein. Von solchen Zuständen sind wir derzeit weit entfernt.
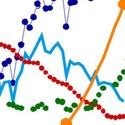




Was ist Ihre Meinung?
Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.