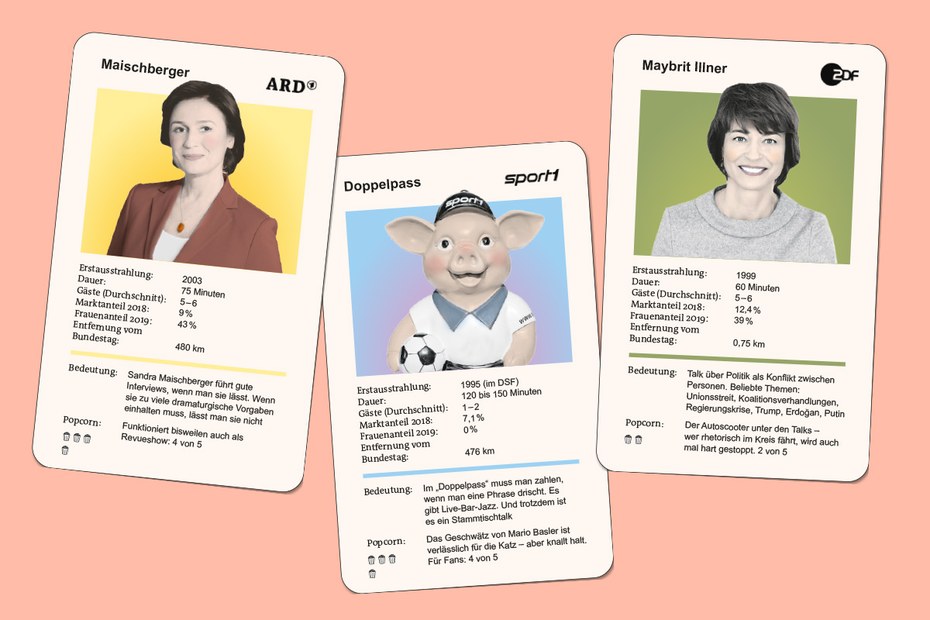Früher versuchte ich jeden Sonntag, möglichst pünktlich von der Arbeit nach Hause zu kommen, um Anne Will nicht zu verpassen. Das lag nicht nur an der Begeisterung für die Moderatorin, sondern auch daran, dass ich mir einbildete, an politischen Debatten teilzuhaben. Mittlerweile ist mir klar geworden, dass von echter Debatte kaum die Rede sein kann. Statt Teilhabe gibt es eine Inszenierung von Politik.
Doch ich blieb hartgesottene Zuschauerin. Bis kürzlich vor der Europawahl 2019 selbst ich eine Wahlarena vorzeitig beenden musste: Die Einspieler über andere europäische Länder kannten nur Klischees, die Reaktionen auf den AfD-Kandidaten Jörg Meuthen waren hilflos, ebenso die Moderation, die Antworten der anderen Spitzenkandidaten im besten Fall fa
n im besten Fall fachlich richtig. Das war das Gegenteil von politischer Bildung oder von Unterhaltung.An die letzten wenigen Highlights sei schnell erinnert: Jutta Ditfurth klärt bei Maischberger nach dem G-20 Gipfel in Hamburg 2017 über den Unterschied zwischen Gewalt und Protest auf und fächert nebenher Wolfgang Bosbach aus der Sendung; Michael Prütz von der Deutsche Wohnen & Co Enteignen-Kampagne brüskiert im März 2019 bei Maischberger eine Unternehmerin mit realen Enteignungsvorhaben; die Kassiererin Maurike Maaßen hält Martin Schulz bei Anne Will vor der Bundestagswahl 2017 nicht für glaubwürdig und kündigt an, was später für die SPD folgen sollte. Zugegeben, es sind nur wenige Momente, und sie dienen denen, die bereits politisiert sind. Mit Aufklärung hatte das ehrlicherweise nicht viel zutun.Doch wie könnte es anders gehen? Zunächst: Die technologische Entwicklung wird auch das Talkshow-Format früher oder später sozial revolutionieren. Im Moment versucht sich das Fernsehen mit einer Art Mischform zu retten, nämlich indem Folgen von Sendungen auch live gestreamt oder im Nachhinein noch angesehen werden können.Doch die Folgen selbst verlaufen noch nach den alten Regeln des Fernsehens. Manchmal kommt es vor, dass auch Tweets oder Fragen der Zuschauer vorgelesen werden – von der Redaktion vorsortiert. Interaktion ist nicht möglich. „Randgäste“ aus der Bevölkerung lockern das Geschehen auf, wirklich teilnehmen dürfen sie aber nicht. Sie wirken wie Statisten, die eingeblendet werden, um die Repräsentanz des Volkes wenigstens zu suggerieren.Dabei bieten die schon jetzt bestehenden Formen des Internets genau das: Teilhabe in Echtzeit und ohne redaktionellen Filter. Zumindest in der Theorie. Es wären ja Talkshows denkbar, die nicht nur „normale“ Menschen unter den regulären Gästen hätten – das wäre ja schon ein Schritt! –, sondern in denen auch Kommentare und Fragen von allen gestellt werden können.Mehr Stimmen aus dem AlltagDas käme dem Brecht’schen Ideal des epischen Theaters nahe, in dem das Publikum aufgefordert wird, mit den Inhalten zu interagieren. Wie Brecht die vierte Wand des Theaters durchbrechen wollte, wäre das auch für Talkshows eine Möglichkeit. Nicht das Einfühlen mit den Schicksalen von armen Menschen wäre das Ziel, sondern die ernsthafte Debatte über Gründe und Auswege – mit den Betroffenen selbst als Experten gleichrangig neben Armutsforschern oder Politikerinnen.Ähnliche Vorstellungen zu linken Medien im weiteren Sinne hatte Walter Benjamin, der für das Radio Hörerinnen vor Augen hatte, die die Konsumentenhaltung ablegen und selbst mitdenken.Mit Brecht entwickelte er Konzepte für Radiosendungen nach diesem Leitsatz. Das damals neue Medium sollte genutzt werden, um auch junge Menschen für schwierige Themen zu begeistern. Wir können diese Sendungen heute leider nicht hören, uns aber die gleiche Richtschnur für Podcasts oder Talkshows auf Youtube legen.Es würde bedeuten, die Talkshows wirklich zu demokratisieren. Natürlich müsste auf die inhaltliche Vorbereitung einer Redaktion und die Auswahl von Gästen nicht verzichtet werden. Natürlich braucht es Experten und politisch streitbare Figuren.Ebenso braucht es geschulte Moderationen, die ein Gespräch leiten, wenn es auszufasern droht. Doch warum sollten nicht möglichst viele darüber abstimmen dürfen, was besprochen wird? Vielleicht kämen neben tagesaktuellen Themen auch allgemeine Fragen auf, die sich bisher keine Redaktion zu stellen wagte?Nun ist unter den gegebenen Bedingungen der Sendeanstalten solch ein Format kaum denkbar. Man würde wohl um die „Neutralität“ fürchten. Ebenso fürchtet man den Streit, weil Demokratie als Einhegen von radikalen Meinungen verstanden wird. Dass man so den Rechten beim Aufstieg hilft, ist nur ein Teil des Problems. Man drückt sich vor politischer Äußerung, und dann tut man es doch ständig. Viel besser wäre es, auch die Moderationen von ARD und ZDF machten transparent, wo sie politisch selbst stehen.Die technische Revolution rückt damit ein weiteres Problem in den Fokus: das der Produktion selbst. In öffentlichen-rechtlichen Fernsehanstalten sind es formal alle Beitragszahler, die bestimmen, doch im Aufsichtsrat sitzen auch Staatsvertreter. Das führte manches Mal zu merkwürdigen Entscheidungen.Daneben die privaten Sender, die sich längst von Bildung verabschiedet haben und reine Unterhaltung betreiben. Es geht immerhin um den Profit, und der kommt nicht durch lange Diskussionen um ein Klimagesetz zwischen Experten, Aktivisten und den am meisten Betroffenen. Ausnahmeerscheinungen wie Alexander Kluge, der auch mit privaten Sendern Formate entwickelte, die einem höheren Anspruch gerecht zu werden versuchten, oder legendäre, aber lange zurückliegende Gespräche zwischen Günter Gaus und Gästen wie Hannah Arendt oder Rudi Dutschke machen nicht wett, dass weder öffentliche noch private Produktionen sich vom Konsumentenfernsehen verabschieden.Vielleicht müssen also auch die Produktionsmittel demokratisiert werden. Kleinere linke Medienformate wie Means TV oder Novara Media machen es vor: Sie warten nicht, bis linke Inhalte es auch in die bisherigen Sendungen schaffen würden, sondern produzieren ihre Sendungen einfach selbst. Dadurch kommen Stimmen zu Wort, die im Mainstream meist als Klischee dargstellt werden („Die Kassiererin“, „die Putzfrau“).Ebenso existieren bereits jetzt tiefgehende Gespräche als Livestream, die kommentiert werden können. Als deutsche Beispiele könnte der Aufwachen-Podcast um Tilo Jung gelten, der die Bundespressekonferenzen wie niemand vor ihm politisiert.Projekte wie diese stecken noch in den Kinderschuhen, aber sie zeigen auf, wie es gehen könnte. Dass sich diese Formate „von den Rändern her“ entwickeln, ist kein Zufall: Es war nie einfacher, auch als Underdog mit wenigen Mitteln eine Sendung zu produzieren, die potenziell Millionen Menschen erreicht. Das bietet sowohl aufklärerischen Projekten wie anti-demokratischen Demagogen ganz neue Möglichkeiten. Umso wichtiger, sie nicht den Rechten zu überlassen und selbst kreativ zu werden.Dazu müssen die Stimmen aus dem Alltag auf die Bühne gehoben werden. Es müssen aber auch möglichst viele Menschen in die Lage versetzt werden, an Talkshows nicht nur teilzuhaben, sondern über Inhalte und die Form mitzuentscheiden, sie selbst zu produzieren. Einen größeren Dienst könnte man der Demokratie nicht erweisen.Placeholder authorbio-1