Menschlich aussehende Maschinen, die in Zukunft die Redaktionen bevölkern und in atemberaubender Geschwindigkeit Texte produzieren? Der Begriff Robo-Journalismus könnte vor dem inneren Auge solche Bilder entstehen lassen. Dass die Realität damit jedoch wenig zu tun hat, berichten Podiumsgäste beim Mediensalon des Deutschen Journalistenverbands Berlin, der Deutschen Journalistinnen- und Journalisten-Union und meko factory – dieses Mal zu Gast im Vodafone Institut. Unter der Überschrift "Macht Künstliche Intelligenz Journalisten bald arbeitslos?" wird diskutiert, in welchen Bereichen "algorithmischer " oder "automatisierter Journalismus" sinnvoll ist – und welche Auswirkungen er auf die Zukunft journalistischer Arbeit haben kann.
"Roboterjournalismus wird von uns natürlich sehr kritisch gesehen", stellt Renate Gensch von der dju zu Anfang fest. Sie berichtet, dass Nachrichtenagenturen wie AP in Zukunft immer stärker auf automatisierte Technologien zur Nachrichtenproduktion setzten. Die Vorteile: "Sie sind billiger, produktiver, machen keine Flüchtigkeitsfehler und streiken nicht."
Klassische Bereiche: Sport, Wetter, Finanzmarkt
Werden Roboter Journalistinnen und Journalisten in Zukunft also ersetzen? "Ich finde, dass uns der Begriff Robo-Journalismus in die Irre führt", sagt Sissy Pitzer, Medienjournalistin und Moderatorin, beim BR Hörfunk zuständig für das MedienMagazin. Mit vermenschlichten Robotern hätten die aktuellen Entwicklungen überhaupt nichts zu tun. Stattdessen gehe es darum, dass Datenmengen automatisch aufbereitet werden und Journalistinnen und Journalisten als Grundlage dienen. "Das ist eine Form, die ich begrüßen würde", erklärt sie.
Der "Faktor Mensch" sei selbst bei automatisiertem Journalismus nicht wegzudenken, sagt Sonja Peteranderl, die vor Kurzem für das Medienmagazin "Journalist" einen Artikel über Robo-Redaktionen geschrieben hat. Sie berichtet, dass die USA bei diesem Thema insgesamt schon viel weiter seien. "In Deutschland ist die Adaption eher zäh." Sinnvoll seien automatisierte Anwendungen dort, wo mit großen Datenmengen gearbeitet werde, die ausgewertet werden müssen. Themengebiete, bei denen bereits mit automatisierten Verfahren gearbeitet wird, sind Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung, Wetter oder auch Sport – Bereiche also, die mit Daten und Zahlen zu tun haben. Statt Journalistinnen und Journalisten zu ersetzen, fungiere die Software beispielsweise im Agenturgeschäft als "unsichtbarer Helfer." Sie könne sehr schnell Finanzmarktdaten durchkämmen und automatisch Leadsätze vorschlagen, die dann von der Redaktion ausgesucht und bearbeitet werden. Das spare den Redakteurinnen und Redakteuren Zeit und Arbeit. Sonja Peteranderl berichtet, dass auch kleinere Medien solche Systeme nutzen, um beispielsweise Wetterdaten zu regionalisieren oder hyperlokale Sportberichterstattung anzubieten.
Feinstaubradar liefert aktuelle und lokale Infos
Jan Georg Plavec, Redakteur im Ressort Multimedia/Reportage bei der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten, stellt ein Beispiel seines Medienhauses vor: Der "Feinstaubradar", bei dem Nutzerinnen und Nutzer online einsehen können, wie hoch die Feinstaubbelastung in bestimmten Wohngebieten ist. Dafür werden Wetterdaten und Daten von Hunderten Feinstaubsensoren, die Privatleute aufgehängt haben, genutzt. Das bedeutet: Die Nutzerinnen und Nutzer helfen selbst bei der Datenerhebung. Aus diesen Daten generiert eine Software automatisch Texte und liefert morgens eine Vorhersage und abends einen Bericht darüber, wie verschmutzt die Luft wirklich war.
Bei diesem Beispiel wird automatisierter Journalismus also genutzt, um zusätzliche Angebote zu schaffen und nicht, um Redakteurinnen und Redakteure zu ersetzen. Beim "Feinstaubradar" seien die Texte als automatisch generiert gekennzeichnet, betont Plavec. Statt von Robo-Journalismus würde er eher von "Textautomatisierung" sprechen. Denn die Frage sei, ob man solche Texte überhaupt als Journalismus bezeichnen könne.
Für die Zeitung sei das Projekt erst einmal ein Test, um mit der Technik warm zu werden, sagt Plavec. Um den finanziellen Mehrwert sei es nicht gegangen. Zwar schalte inzwischen eine Gemeinde im Allgäu Werbeanzeigen für Ausflüge an die frische Luft, aber das sei nicht geplant gewesen.
Mensch und Maschine spielen zusammen
Sissy Pitzer sieht solche Projekte auch als Chance für Verlage, neue Geschäftsfelder zu entwickeln. "Dann kann man mit solchen Daten wahnsinnig spannende Sachen machen."
Ambivalenter hingegen scheinen andere Einsatzfelder wie beispielsweise das Verfassen von Polizeimeldungen – was laut den Podiumsgästen auf bestimmten News-Portalen schon passiere. Sissy Pitzer warnt davor, die Berichte von der Polizei automatisch zu bearbeiten und zu veröffentlichen. Was wäre beispielsweise in der Silvesternacht in Köln passiert, fragt sie und nennt so ein Beispiel, bei dem die Interpretation durch Redakteurinnen und Redakteure wichtig gewesen sei.
Andererseits könnten durch die zunehmende Automatisierung Kollegen entlastet werden, die jeden Tag mühsam Randspalten füllen müssen, sagt Jan Georg Plavec. Aber: Könnten Verlage darin die Gelegenheit sehen, Stellen abzubauen?
Dass in Zukunft ein Großteil der Texte auf Websites von Online-Medien automatisch generiert wird, hält Plavec für realistisch. Dabei werde es sich aber um bestimmte, weniger sichtbare Themen wie beispielsweise das Wetter handeln. "Ich glaube nicht, dass die Automatisierung den Journalismus komplett abschafft", betont auch Sonja Peteranderl. Sissy Pitzer sagt, dass es immer eine Kombination von beiden Bereichen sein wird. "In dem Moment, in dem etwas interpretiert werden muss, brauche ich tatsächlich den Menschen."
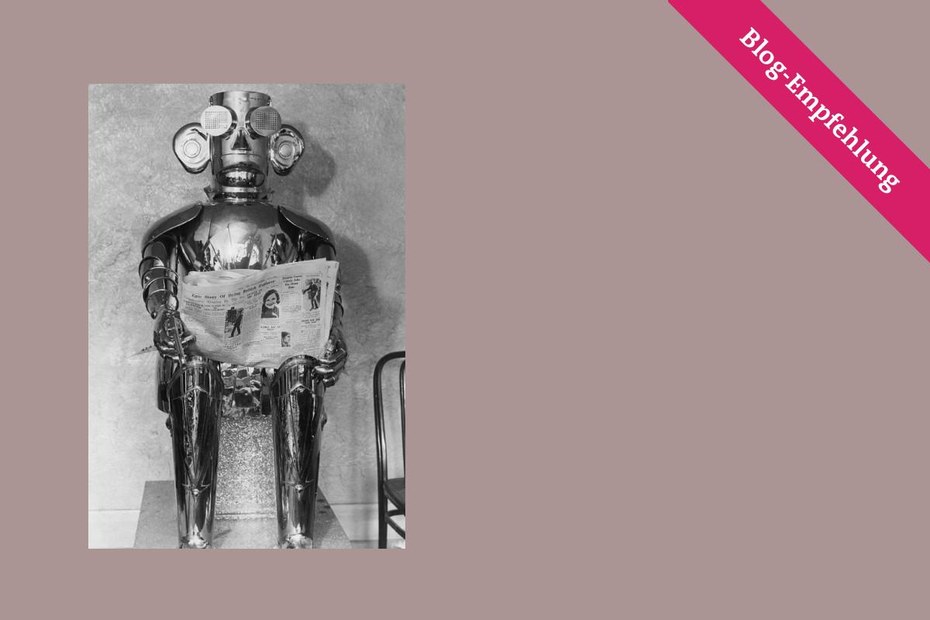




Was ist Ihre Meinung?
Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.