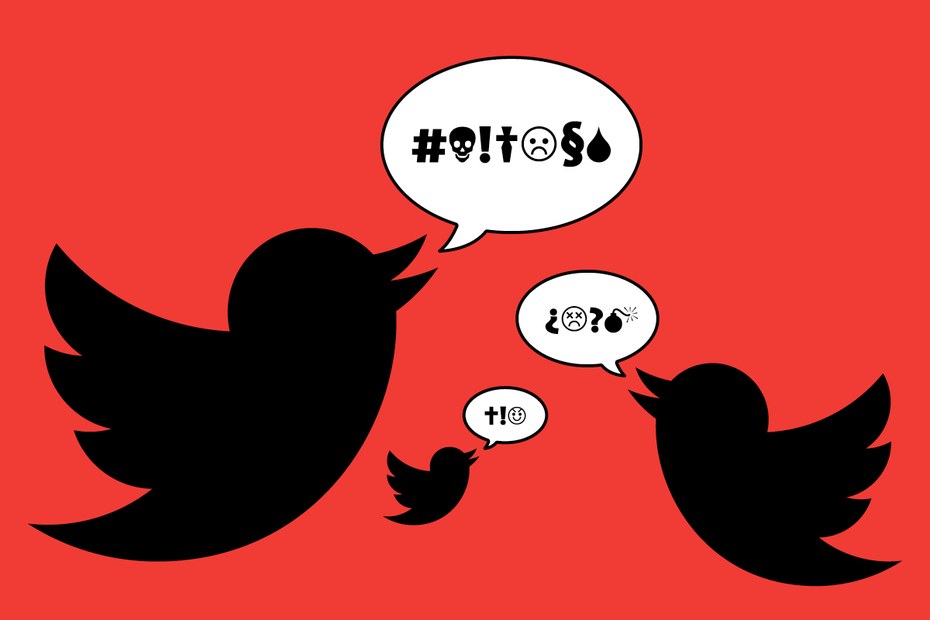Robert Habeck begründete seinen Ausstieg bei Facebook und Twitter damit, die Sozialen Medien würden ihn „aggressiver, lauter, polemischer und zugespitzter“ machen. In keinem anderen Medium gebe es „so viel Hass, Böswilligkeit und Hetze“ wie auf Twitter, so der Bundesvorsitzende der Grünen. Das musste die ZDF-Journalistin Nicole Diekmann am eigenen Leib erfahren: Nachdem sie „Nazis raus.“ als Neujahrsgruß getwittert hatte, überzogen rechte Nutzer sie mit Mord- und Vergewaltigungsdrohungen.
Eines der selbstgesteckten Ziele von Facebook war, die Welt offener und verbundener zu machen. Die euphorische Aufbruchstimmung ist einem Kater gewichen. Der Internetpionier Jaron Lanier warnt gar, dass Soziale Medien in ihrer aktuellen Form
ellen Form die negativen Seiten der Menschen verstärken.Eigentlich geht es hier um SexWarum gerade in Sozialen Medien Hass, Sexismus und politische Extrempositionen so florieren, versucht Angela Nagle in ihrem Buch Die digitale Gegenrevolution zu erklären.Rechter Hass im Netz komme in der überwältigenden Mehrheit der Fälle von männlichen Nutzern, meint Nagle. Dass das so ist, sei auch eine Folge der Kulturkämpfe der 1960er. Die sexuelle Revolution habe zwar viele aus „den Fesseln liebloser Ehe und selbstloser Pflichterfüllung der Familie gegenüber“ befreit. Für Männer habe sich damit aber ein Ungleichgewicht mit schwerwiegenden Folgen ergeben – gegenüber anderen Männern: Der „Niedergang der Monogamie“ bedeute „für eine Elite von Männern eine größere sexuelle Wahlfreiheit (…), für eine beträchtliche männliche Bevölkerungsschicht am unteren Ende der Hackordnung jedoch zunehmend weniger Sex“.Die „harte Rhetorik“ vor allem gegen Frauen und Nichtweiße versteht Nagle als psychologische Kompensation solch sexueller Ohnmacht. Sie hat sich in der „manosphere“ und ihren diversen Online-Foren umgeschaut, wo aggressiver Antifeminismus und chauvinistischer Maskulinismus vorherrschen. Frauen seien dort bloße Sexobjekte, die es zu unterdrücken und sexuell zu erobern gelte.Der gemeinsame Nenner zwischen Incels (unfreiwillig zölibatär lebenden Männern), Alpha-Männern, Pick-up-Artists und der Neuen Rechten ist für die Autorin eine Politik der Transgression: Die gezielte Überschreitung kultureller Regeln und Grenzen sei allgegenwärtig. Nagle sieht die neuen Rechten der Alt-Right und Alt-Light dabei in einer Tradition, die sich von den Schriften de Sades über Figuren wie Georges Bataille und die rebellische Ablehnung feminisierter Konformität im Nachkriegsfilm bis zu den „Male rampage“-Filmen der 1990er wie Fight Club oder American Psycho nachzeichnen lasse.Die aggressive Rebellion sei für diese Männer ein nihilistisches „Abwerfen des Über-Ich“, ein Ausbruch aus gesellschaftlichen Konventionen. Die neurechten Grenzüberschreitungen hätten mehr mit der antirepressiven Kulturpolitik der 60er gemein als mit klassischen Konservativen, gegen die sich diese Politik richtete. Daher ist Donald Trump für Nagle auch kein konservativer, sondern ein Alt-Right-Präsident.Das Gegenstück zur überschreitungswütigen, brutal männlichen Netz-Rechten findet Nagle in Gruppierungen, die sich von traditionell linken Fragen wie Verteilungsgerechtigkeit und Klassenkampf abgewandt hätten. Sie sammelt diese unter dem Oberbegriff „Tumblr-Liberalismus“. Hier lasse sich eine Hypersensibilität gegenüber vermeintlichen Angriffen auf die eigene Identität beobachten. Selbstgeißelung als „Privilegierte“ und Mobbing von Kritikern seien an der Tagesordnung.Große Teile der Linken hätten sich in eine „intellektuell völlig stillgelegte Welt“ zurückgezogen, in der radikaler Konformismus herrsche, der jedes Ausscheren mit einem Scherbengericht ahnde. „Jahrelange Online-Hass- und Schmutzkampagnen sowie Säuberungsaktionen gegen andere – auch und insbesondere gegen andersdenkende und freigeistige Linke – haben unerhörten Schaden angerichtet“, schreibt Nagle. Ein veritabler „brain drain“ sei die Folge: Kritiker schwiegen oder ließen sich einspannen – aus Angst vor dem großen Shitstorm aus den eigenen Reihen.Das ist doch ein Witz, oder?Es stellt sich die Frage, ob alle Beispiele, die Nagle anführt, ernst gemeint sind. In einigen Foren wird diskutiert, ob die Autorin vielleicht rechten Trollen auf den Leim gegangen sei, die mit vermeintlich authentischen Diskussionen gezielt Befremden bei Nichteingeweihten auslösen wollten. So listet Nagle zum Beispiel eher exotisch klingende Gender-Identitäten auf, die man im Netz finden würde, darunter „faegender“: ein Geschlecht, das sich mit Jahreszeiten, Sonnenwenden und Mondphasen ändere. Außerdem nennt Nagle im Zusammenhang mit dem „Tumblr-Idealismus“ die „Body Integrity Identity Disorder“: Wer darunter leide, lasse sich Körperteile entfernen, um als behindert zu gelten. Diese Beispiele sagen laut Nagle „etwas über das größere Thema fluider Identitäten aus, das diese Kultur“ durchziehe. Was jedoch genau dieses „Etwas“ ist, das lässt sie offen. Dass sie kaum Quellen angibt (was ihr auch schon den Vorwurf des Plagiats eingebracht hat), erschwert die kritische Auseinandersetzung mit ihrem Text.Für manche ist Nagle eine transphobe Sozialkonservative, andere loben sie als mutige Binnenkritikerin innerhalb der Linken. Wer verstehen will, woher der rechte Hass im Netz kommt, findet in ihrem Buch eine mögliche Antwort.Placeholder infobox-1Placeholder authorbio-1