Ich bin 19 Jahre alt, als ich mich eine erschütternde Erkenntnis trifft: Ich bin ein Mann. Zur Vorbereitung meines anstehenden Freiwilligendienstes muss ich an einem Seminar teilnehmen. Es geht um das kommende Jahr, Politik, Selbstorganisation. Sprich: Es wird ausgiebig debattiert. Nach einer dieser Diskussionsrunden nimmt mich einer der Teamer – so hießen die Betreuer des Seminars, damit es möglichst antiautoritär klingt – beiseite und weist mich auf etwas hin: „Leander, weißt du, dass du sehr häufig Leute unterbrichst?“ Ich nicke konstruktiv schuldbewusst. Ja, das weiß ich, wird mir öfter gesagt, fällt mir selber auf. Ich will das schon lange bessern. „Und weißt du, wen du besonders häufig unterbrichst?&
Sei dein Mann
Patriarchat Ich kam aus der Provinz und ihrem stumpfen Rollendiktat. Dann befreite mich der Feminismus
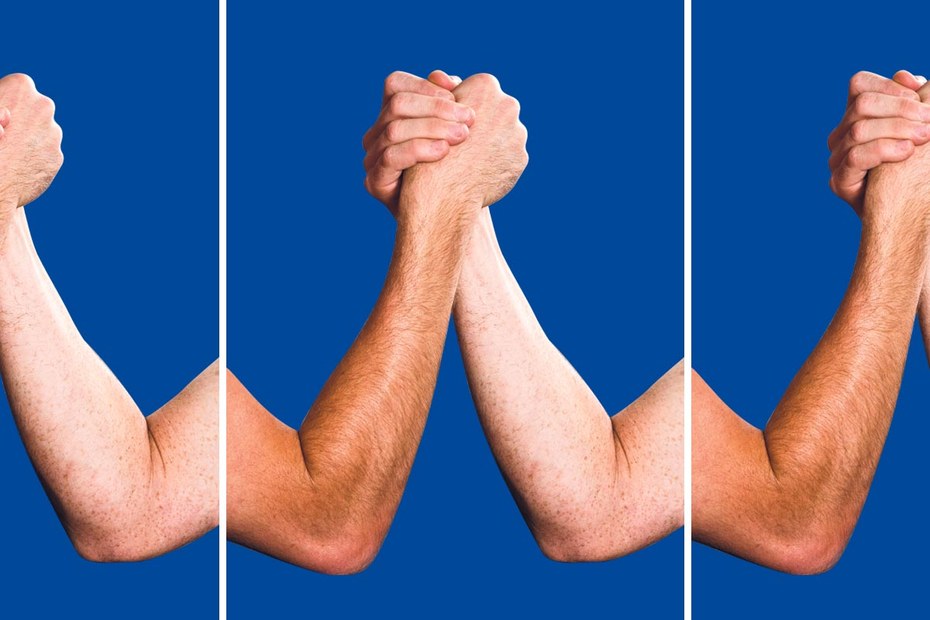
Montage: der Freitag, Material: iStockphoto
t?“ Ich stutze, ziehe die Schultern hoch. Da bin ich überfragt. Ich denke an bestimmte Personen, vielleicht irgendeinen Kerl, den ich für besonders blöd halte – denn dass ich den meisten intellektuell überlegen bin, daran habe ich damals keinen Zweifel. Dann sagt er es mir und es trifft mich wie der Schlag: „Frauen.“Ich, einer der Frauen unterbuttert? Sie nicht für voll nimmt, ihr Rederecht unterschlägt und sich auf ihre Kosten profiliert? Ich, ein Macho, der glaubt, sich intellektuell nur mit Männern messen zu müssen? Kurz: ich, ein Mann, wie er im Buche steht? Das konnte nicht sein. Nicht, dass es je Zweifel daran gegeben hätte, welchen Geschlechts ich bin. Nein, ein Mann bin ich, außer Frage. Aber offenbar bin ich ein Mann-Mann. Also genau das, was ich nie sein wollte. Doch dafür muss man offenbar nicht Steaks grillen, Feinripp tragen, Fußball gucken und Frauen schlagen. Zum Mann-Mann wird man gemacht.Aufgewachsen bin ich in einer kleinen Großstadt im Süden der Republik, bekannt für ihren Kirchturm und ihr Autobahnkreuz. Und einen Zungenbrecher, der jedem einfällt. Die Menschen dort sagen „I“ statt „Ich“ und „sch“ statt „s“. Außerdem sagen sie „Grüß Gott“. Die Stadt lebt von Industrie und High-Tech-Forschung, es gibt sogar eine Universität, aber ohne Geistes- und Sozialwissenschaften. Die Kaufkraft ist überdurchschnittlich, die Arbeitslosigkeit unterdurchschnittlich. Man arbeitet als Facharbeiter und Ingenieur, in der Forschung oder im öffentlichen Dienst. Die Leute wählen CDU und grün, aber man gibt sich gern mondän, sodass meine zugezogene Familie Teil des sozialen Geflechts werden konnte. Wir lebten in Einfamilienhäusern. Meine Geschwister und ich gingen auf eine Schule in privater Trägerschaft. So eine mit besonderer Pädagogik. Wir machten Abitur. Geldnöte hatten wir – soweit ich weiß – nie wirklich. Das ist wohl das, was man eine behütete Kindheit nennt.Wie ein schwuler FreundDas Milieu, in dem ich groß wurde, tickt politisch zwischen alter SPD und neuen Grünen, ohne dass es je explizit um Politik gegangen wäre. Aber dass Kinder Sprachen und Instrumente lernen, ist wichtig, genauso wie Reisen ins Ausland. Ein ernsthaftes Problem mit Homosexualität hat hier kaum jemand, aber auf dem Schulhof geht „schwul“ als Beleidigung durch. Genau wie „behindert“ und „pussy“. Jungs deklamieren „witzige“ Reime wie: „Nach dem Essen sollst du rauchen oder eine Frau missbrauchen. Hast du beides nicht zur Hand, bohr ein Loch und fick die Wand.“ Beim Straßenfest sitzen Deutsche, Türken und „Jugos“ einträchtig bei Bier und Dönerspieß zusammen. Aber die Annahme, dass es einen Zusammenhang zwischen Anatolien und Asozialität gibt, kann durchaus mehrheitsfähig sein. Latente Misogynie, latente Xenophobie, bei gleichzeitig zur Schau gestellter (und oft praktisch gelebter) Liberalität – wir hätten uns wahrscheinlich alle als „vollkommen normal“ bezeichnet.Die Männer, denen ich als Kind begegnete, waren meist Väter. Mein eigener, Freunde der Familie, die Väter meiner Freunde. Wenn Väter sich unterhielten, ging es meistens um die Arbeit (in der Regel irgendetwas Technisches), Autos oder die Zeit bei der Bundeswehr. Wenn Mütter sich unterhielten, standen sie dabei erstaunlich häufig in der Küche. Es ging um Schulangelegenheiten, die Kinder, vielleicht Urlaubsziele. Dass jeder Mensch „seinen eigenen Weg“ finden soll, würden hier die meisten unterschreiben. Die Forschung weiß inzwischen: Viel mehr als die Werte, die Eltern haben, zählt für die Sozialisation der Kinder der Lebensstil, den sie ihnen vorleben. Und der bedeutete in meinem Fall: Es ist alles so in Ordnung, wie es ist.Mit Beginn der Pubertät beginnen auch die Probleme. Das ist für alle Menschen eine fürchterliche Zeit. Der Körper wird unförmig, an den unmöglichsten Stellen sprießen plötzlich Haare, der Stimmbruch setzt ein. Man versteht weder sich selbst noch sein Umfeld mehr. Man hat plötzlich ein Geschlecht. Als Kind machst du, was du willst. Jetzt schießen unsichtbare Barrieren aus dem Boden. Jungs sind „so“, Mädchen „so“. Und plötzlich war ich raus.Mein bester Kindheitsfreund, mit dem ich gerade noch Anakin Skywalker und Obi-Wan Kenobi gespielt hatte, hörte plötzlich Gangsta-Rap, machte wie blöd Kampfsport und sprach in einer Art und Weise über Frauen, die mich abstieß. Alle anderen Jungs interessierten sich natürlich auch für Sport. Und für kleine, benzinbetriebene Autos mit Fernsteuerung, große Mengen Alkohol, merkwürdige Musik und – natürlich – Frauen. Letztere behandelten sie in meinen Augen meistens schlecht. „Was Männer halt so machen“, dachte ich. Das Problem war nur: Ich war auch ein Mann – und fand all das ganz furchtbar.Es ist nicht so, als hätten meine Eltern oder sonst wer mir jemals vorgeschrieben, wie ich zu sein hatte. Wir waren ja liberal. Niemand hat je gesagt: Wenn du keinen Sport machst, bist du kein richtiger Mann. Niemand hat je gesagt: Wenn du nicht vor der Volljährigkeit schon ein Poesiealbum voller Frauen vorweisen kannst, die du „gebumst“ hast, bist du kein richtiger Mann. Oder: Wenn du dich nicht für Technik interessierst, bist du kein richtiger Mann.In der Schule war ich ein Sonderling, gemobbt wurde ich jedoch nie. Ich war ein guter Schüler, hatte Freunde, war respektiert. Allein, wenn die „coolen“ Sachen anstanden, war ich nie dabei. Da gab es zweifelsohne einen Zusammenhang: Mannsein und Coolsein waren irgendwie das Gleiche. Und beides führte zum bitter notwendigen – allein dieser Begriff! – „Erfolg bei Frauen“. Ich hatte nichts davon. Nicht das Männliche, nicht das Coole und demnach auch nicht den Erfolg. Zwar war ich viel von Frauen umgeben, doch für die war ich – so hat es jemand mal allen Ernstes ausgedrückt – „wie ein schwuler Freund“. Das war zwar schmeichelhaft, aber ich konnte es natürlich nur als vernichtendes Urteil über meine Geschlechtlichkeit auffassen. Ich habe eine Zeit lang ernsthaft darüber nachgedacht, ob ich nicht schwul sei. Für den Jugendlichen, der ich war, konnte es keinen anderen Schluss geben: Das Problem war ich. Und wenn ich nicht so war wie die anderen, musste ich etwas Anderes sein. Aber homosexuell? Absurd! War ich nicht pausenlos todunglücklich in Mädchen in meinem Umfeld verknallt?Es wäre übertrieben, sämtliche pubertären, inneren Konflikte sowie alle bis heute andauernden Spannungen auf diese Frage des Geschlechts zu reduzieren. Wie sehr mir diese Diskrepanz zwischen dem, was ich war, und dem, was ich glaubte sein zu müssen, zu schaffen machte, wurde mir erst völlig gewahr, als ich feststellte, dass es gar nicht so sein musste. Mit 16 Jahren haute ich für ein Jahr aus der provinziellen Enge meiner Jugend ab. Weg vom Autobahnkreuz, weg vom Kirchturm.Fußball, Saufen, FrauenIch ging zum Schüleraustausch nach Buenos Aires. In den Gastfamilien dort hatte ich das unwahrscheinliche Glück, auf Jungs zu treffen, die mir nicht unähnlich waren: intellektuell und musisch veranlagt, kein großes Interesse für „typische“ Männerbeschäftigungen wie Fußball, Saufen und Frauenbelästigen. Wir hörten Tschaikowski und Pink Floyd, spielten die ganze Nacht lang argentinische Kartenspiele und redeten ohne Ende. Es war großartig. Nur die Frauenfrage blieb. Denn als Austauschschüler hat man die absurde Erwartung, ein ausschweifendes Sexualleben führen zu müssen (dass dabei eine gehörige Portion rassistischer Stereotype über „Latinas“ eine Rolle spielten, steht auf einem anderen Blatt). Ich war jedoch vollkommen verkrampft. Wenn es nun mitunter heißt, der Feminismus habe das Flirten kaputtgemacht, dann steckt darin ein Körnchen Wahrheit. Denn sehr, sehr viele junge Männer lernen, dass Flirten schlicht übergriffiges Verhalten ist (und viele Frauen leider auch). Zugegebenermaßen rührten meine Hemmungen in solchen Fragen weniger von einem ausgeprägten politischen Bewusstsein, sondern eher von der panischen Angst, zurückgewiesen zu werden. Wenn ich mir jedoch vergegenwärtige, wozu mich Jungs und Männer, die mich ermutigen wollten, alles aufforderten, muss ich im Nachhinein sagen: Ich schäme mich, sie dafür nicht zurechtgewiesen zu haben.Später dann, im Studium, fand ich für all dieses Unbehagen endlich das Vokabular: Patriarchat, Vergewaltigungskultur, Frauenhass. Und: Feminismus. Denn ich verstand nicht nur, dass, was ich empfunden hatte, mit vermittelten gesellschaftlichen Zwängen zu tun hatte, sondern dass ich teilweise auch völlig falsch darauf reagiert hatte. Ich musste nicht aufhören, ein Mann zu sein. Ich musste nur anfangen, der Mann zu sein, der ich sein wollte. Ernsthaft Feminist zu werden und das Wort nicht nur wie ein Schmuckstück vor mir herzutragen, bedeutete für mich eine große Befreiung. Heute trage ich Bart und trinke durchaus gern. Dann kann ich auch Lieder grölen. Nur sind es keine Lieder, die Gewalt gegen Frauen verherrlichen, sondern eher die Internationale. Ich kann einen Mann umarmen oder sogar küssen, ohne dafür ausgelacht zu werden. Das ist kein Widerspruch. Männer, hört die Signale!Reise ich heute zurück in die Provinz meiner Kindheit, stelle ich fest, dass sich die Welt langsamer verändert als ich selbst. Da sind Männer noch Männer. Doch auch sie müssen eines Tages begreifen, dass der Fall des Patriarchats kein Fall der Männer ist. Ganz im Gegenteil: Er ist unser aller Befreiung.
×
Artikel verschenken
Mit einem Digital-Abo des Freitag können Sie pro Monat fünf Artikel verschenken. Die Texte sind für die Beschenkten kostenlos. Mehr Infos erhalten Sie hier.
Aktuell sind Sie nicht eingeloggt. Wenn Sie diesen Artikel verschenken wollen, müssen Sie sich entweder einloggen oder ein Digital-Abo abschließen.