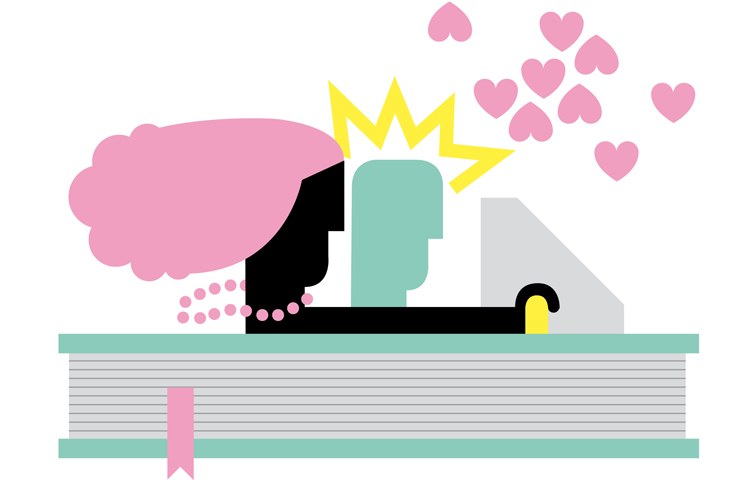Das Büro, in dem Klaus Bittermann seinen Ein-Mann-Verlag Edition Tiamat betreibt, sieht großbürgerlicher aus als erwartet. Bücherregale decken die Wände des lichtdurchfluteten Zimmers fast komplett ab. Bittermann trägt weißes Hemd zum beigen Jackett, er hat nur noch ein paar wenige weiße Haare, aber die Figur eines Langstreckenläufers. Seit 1979 ist er Verleger. Seine Edition Tiamat, in deren Backlist etliche Titanic-Autoren, Essayisten wie Wolfgang Pohrt und Eike Geisel, der Marxist Robert Kurz und der Philosoph Guy Debord stehen, ist eine der wichtigsten Inspirationsquellen für verschiedene Fraktionen der linken Szene. In seinem Blog schreibt der Verleger unter der Rubrik Blutgrätsche aber auch über die Fußballbundesliga.
Bi
Klaus Bittermann seinen Ein-Mann-Verlag Edition Tiamat betreibt, sieht großbürgerlicher aus als erwartet. Bücherregale decken die Wände des lichtdurchfluteten Zimmers fast komplett ab. Bittermann trägt weißes Hemd zum beigen Jackett, er hat nur noch ein paar wenige weiße Haare, aber die Figur eines Langstreckenläufers. Seit 1979 ist er Verleger. Seine Edition Tiamat, in deren Backlist etliche Titanic-Autoren, Essayisten wie Wolfgang Pohrt und Eike Geisel, der Marxist Robert Kurz und der Philosoph Guy Debord stehen, ist eine der wichtigsten Inspirationsquellen für verschiedene Fraktionen der linken Szene. In seinem Blog schreibt der Verleger unter der Rubrik Blutgrätsche aber auch über die FuXX-replace-me-XXX223;ballbundesliga.Bittermann hat in seinem Verlag nun wieder einen eigenen Roman veröffentlicht, Sid Schlebrowskis kurzer Sommer der Anarchie und seine Suche nach dem Glück. Nach drei Krimis, die er in den 90er Jahren geschrieben hat, ist es sein vierter Roman, hinzu kommen Feuilletonbeiträge und Prosaskizzen, Letztere erfassen zumeist Alltagsszenen aus Berlin-Kreuzberg. Sid Schlebrowskis kurzer Sommer ist die temporeiche und berührende Geschichte eines Roadtrips zweier Teenager im Jahr 1980. Der Plot qualifiziere den Roman einerseits als Jugendbuch, sagt Bittermann. Er könne „aber auch von Leuten gelesen werden, die sich mit einer gewissen Melancholie an die 80er Jahre erinnern wollen“.Ex-Boxer, aktiver AlkoholikerMelancholisch sein kann Bittermann nicht nur als Schriftsteller, sondern auch als Gesprächspartner. Ich frage ihn nach den großen, vergessenen Feuilletonisten der 80er und 90er, deren Bücher er verlegt hat. Schnell gerät er ins Schwärmen für die scharfsinnigen Literaturkritiken von Christian Schultz-Gerstein, für die Essays von Lothar Baier und und Eike Geisel: „Eike war einer der wenigen, die das Problem des Antisemitismus nicht nur schematisch angegangen sind, sondern wirklich durchdacht haben.“ Dagegen erscheint ihm das Feuilleton von heute substanzlos: „Anfang der 90er wurde in den Feuilletons über große gesellschaftliche Themen wie den ersten Golfkrieg, den jugoslawischen Bürgerkrieg und die Wiedervereinigung ausführlich debattiert. Wenn man das mit heute vergleicht – etwa mit dem Aufruhr um Böhmermanns Gedicht – sieht man, dass die Anlässe für Debatten viel beliebiger geworden sind.“Sid, der Protagonist von Bittermanns Roman, ist 17 Jahre alt. Er hat sich selbst nach dem Sex-Pistols-Bassisten Sid Vicious benannt. Zu Beginn des Romans scheint Sid nicht viel vom Leben zu erwarten. Er wird von seinem Vater, einem ehemaligen Boxer und noch aktiven Alkoholiker, übel misshandelt. Die Mutter hat gelegentlich psychotische Anfälle. Unter seinen Lehrern sind alte Nazis. Genug Gründe, von zu Hause abzuhauen, hat er. Er tut es spontan und ohne Plan. An der nächsten Ecke begegnet er Nancy, die ihn im Auto mitnimmt. Sie ist 16 Jahre alt und flieht vor ihrer adligen Familie. Sie ziehen selbstbewusst in ein Münchner Luxushotel, obwohl sie kein Geld haben. Sie stehlen in Designermodeläden. Unter glücklichen Umständen gelangen sie nach Italien. Dort prellen sie in Hotels die Zeche oder leben von Diebesgut, das sie von anderen Hotelgästen „expropriiert“ haben, wie sie es liebevoll marxistisch nennen.Was man als Leser gern wüsste: Schlafen die beiden miteinander? Bittermann sagt: „Ich habe das offengelassen. Man kann aber davon ausgehen. Für die Geschichte ist es nicht wesentlich.“ Davon unabhängig können wir uns die beiden Protagonisten als ein attraktives Paar vorstellen.Nancy nimmt Sid die Angst, die ihm von seinem Vater über Jahre eingeprügelt worden ist. Sie wiederum beneidet ihren Freund, weil er gute Gründe hat, seinen Vater zu hassen. Sie würde ihren Vater auch gern hassen. Nur ist das schwierig, weil er so viel Verständnis für sie aufbringt.Am Ende werden Nancy und Sid von der Polizei gefasst, unmittelbar nachdem sie im Radio von der Ermordung John Lennons erfahren. Nach der Verhaftung werden sie getrennt und verlieren sich aus den Augen. Hier liegt die einzige Schwäche des Plots. Dass sie sich über zehn Jahre nicht finden, obwohl beide intensiv nacheinander suchen, wirkt allzu konstruiert und unplausibel.Hausbesetzer heuteSid bricht nach der Entlassung aus der Haft die Schule ab und zieht nach Westberlin, um sich der Wehrpflicht zu entziehen. Er gerät in die Hausbesetzerszene, wo sein Leben fortan zwischen exzessivem Alkoholkonsum und dem Versuch, zeitgenössische Philosophie zu lesen, vor sich hin dümpelt.Wie schaut der Autor Klaus Bittermann auf die Hausbesetzerszene heute in Berlin? Was gerade in der Rigaer Straße passiere, verfolge er kaum, sagt er. Und im Hinblick auf die Berichte von Anwohnern: „Die leben nach dem Motto: Es gibt nur uns, und alle anderen Leute sind Idioten. Diese Haltung war in den 80er Jahren …“ – Bittermann bricht ab, denkt nach – „… wahrscheinlich war sie auch schon so. Wobei die Hausbesetzer damals ein ganz anderes Milieu vorfanden. Ich bin 1981 hierhergezogen. Die Leute waren zum Teil wirklich unerträglich. Da hat damals etwa ein Polizist a. D. gewohnt, der türkische Hausbewohner aus dem Fenster rassistisch beschimpfte, wenn die ihre Musik zu laut hörten. Da das wirklich keine sympathischen Nachbarn waren, war die konfrontative Haltung der Szene damals zumindest verständlich. Solche Leute gibt es hier aber nicht mehr. Heute sind die Einwohner von Kreuzberg oder Friedrichshain ein bisschen aufgeklärter und nicht mehr so reaktionär.“ Früher waren also auch die Hausbesetzer besser.Placeholder infobox-1Placeholder link-1