Wer Wasser in den Wein gießt, kann es nicht wieder heraus schütten. Was übrig bleibt, ist für alle Zeit verdorben. Um so mehr sollte bedacht werden, was ausgelöst – womöglich heraufbeschworen – wird, wenn russische Sportlerinnen und Sportler exemplarisch – um nicht zu sagen – drakonisch bestraft und ohne jede Ausnahme für die Olympischen Spiele in Rio gesperrt werden. Da gibt es kein Herumgerede – von der Tragweite her wäre das ein eminent politischer Vorgang und eine Zäsur für Olympia. Sicher, es geschähe nicht das erste Mal, dass eine ganze Sportnation bzw. ein ganzes Land um des politisch-symbolischen Effekts willen verbannt bliebe. Nur sollte man wissen, welche historischen Vergleiche fällig sind, werden die Umstände erinnert, die zu solcher Relegation führten.
Die Olympische Bewegung hat vom Strafmaß des kategorischen Platzverweises in ihrer über hundertjährigen Geschichte des öfteren Gebraucht gemacht und ist damit alles in allem verantwortungsvoll umgegangen. Wenn gravierende Gründe vorlagen, schien dieses äußerste Mittel opportun und sollte stets als politische Entscheidung verstanden werden, um Schaden von Olympia und vom Sport abzuwenden.
Deutschland und Südafrika
Nach dem Ersten Weltkriege etwa hielt sich das IOC an das Urteil der Versailler Konferenz von 1919 über die Schuldigen am zwischen 1914 und 1918 stattgefundenen Weltenbrand und Zivilisationsbruch, der 17 Millionen Menschenleben gefordert hatte. Deutschland, Österreich, Ungarn, Bulgarien und die Türkei – allesamt Kriegsverbündete – erhielten ausdrücklich keine Einladung zu den Sommerspielen von Antwerpen 1920. Auch beim olympischen Fest des Sport 1924 in Paris musste eine deutsche Equipe fernbleiben – erst 1928 in Amsterdam wurde wieder ein Startrecht erteilt.
Mehr noch, es sollte ein Jahrzehnt nach dem Weltkrieg ein Zeichen der Versöhnung sein, dass schon am Rande der Wettkämpfe von Amsterdam erste Überlegungen laut wurden, die Spiele von 1936 an Berlin zu vergeben, was schließlich durch eine IOC-Entscheidung von 1931 zum Auftrag an das deutsche NOK wurde. Wie dann die NS-Führung damit umging, wird gerade in diesem Tagen zum 80. Jahrestag der Spiele auf dem „Reichssportfeld“ erinnert.
Nach dem Zweiten Weltkrieg – im Bewusstsein der im Namen Deutschlands seit 1933 gegen Menschheit und Menschlichkeit begangenen Verbrechen – waren 1948 bei den Olympischen Sommerspielen in London deutsche Athleten zu unerwünschten Personen erklärt worden, was einem Ausschluss gleichkam. Es ist in diesem Zusammenhang alles andere als eine Fußnote der Geschichte, sondern gleichfalls ein Politikum, dass 1952 bei den Helsinki-Spielen der DDR das Startrecht für eine zweite deutsche Mannschaft im Namen des zweiten deutschen Staates verwehrt blieb, weil die Bundesrepublik für sich in Anspruch nahm, Deutschland allein zu vertreten und ein exklusive Startrecht zu haben. (Zwischen 1956 und 1968 gab es dann vorübergehend eine „gemeinsame Mannschaft“, deren Medaillengewinner bei Siegerehrungen Beethoven hören und auf die olympischen Ringe auf schwarz-rot-goldenem Tuch blicken durften.)
Noch 1960 bei den Spielen von Rom hatte der amerikanische IOC-Präsident Avery Brundage, der einen persönlichen Anteil daran besaß, dass die USA Berlin '36 wegen der Diskriminierung jüdischer Sportler nicht boykottierten, eine rein weiße Mannschaft aus Südafrika zugelassen. Als sich das vier Jahre später für Tokio erneut abzeichnete, rang sich das IOC zum Verstoß Südafrikas aus der olympischen Familie durch. Dieses Verdikt wurde erst zurückgenommen, als das rassistische Regime am Kap Anfang der 1990er Jahre abdankte, so dass in Barcelona 1992 erstmals wieder ein südafrikanisches Team auftrat, bei dem auch schwarze Sportler zum Aufgebot gehörten.
Coe und Bach
Warum dieser Exkurs? Weil nicht zuletzt der Umgang mit Südafrika zeigt, welche genuin politischen Motive bisher zu einer Relegation führen konnten. Wird nun das Russland vorgeworfene Staatsdoping in den Katalog der Ausschlussgründe aufgenommen, ist ein Präzedenzfall geschaffen.
Angesichts der Kommerzialisierung des Sports und der sich daraus ergebenden Verführung zur irregulären Leistungssteigerung kann die olympische Bewegung daran zerbrechen und die olympische Idee irreversiblen Schaden nehmen. Dopingfälle, die den internationalen Sport weiter flankieren dürften, werden fortan die Frage aufwerfen, inwieweit das „russische Beispiel“ als Handlungsmuster in Betracht kommt, ob die nationalen Sportverbände oder die betreffenden Staaten selbst genauso sanktioniert werden müssen, wie das jetzt Russland widerfahren soll.
IAAF-Präsident Sebastian Coe sieht im Urteil des Sportgerichtshofes Cas vom 21. Juli über einen kompletten Ausschluss russischer Leichtathleten für Rio keinen Grund „für ein triumphales Statement“. Es steht für eine Minderheit, wer im Augenblick die Contenance wahrt. Es schäumt vor allem Deutschland vor Selbstgerechtigkeit und Straflust, als hätte es die Dopingfälle seit 1990, die Doping-Sünder Dieter Baumann und Katrin Krabbe (Leichtathletik), Alexander Leipold (Ringen), Roland Wohlfarth (Fußball), Johann Mühlegg (Skilanglauf), Ludger Beerbaum (Springreiten), Jan Ullrich (Radsport) oder Evi Sachenbacher-Stehle (Biathlon) nicht gegeben.
Aber es bestehen medial und darüber hinaus keinerlei Hemmungen, das ganz große Wort zu führen. Selbst Landsmann Thomas Bach wird als „Putin-Freund“ madig gemacht und kann sich von diesem Stigma nur befreien, wenn er die Russen ohne Wenn und Aber rauswirft. Entweder er tut es oder er ist als IOC-Präsident beim Eignungstest durchgefallen. Von massivem Druck zu sprechen, wäre zu wenig – Nötigung trifft es besser. Bach steht quasi unter Bewährungszwang: Entweder er lässt vom IOC Russland zum Paria des Weltsports stempeln oder er hat versagt.
Es geht schon nicht mehr darum, ob Wasser in den Wein gehört, sondern nur noch wie viel.
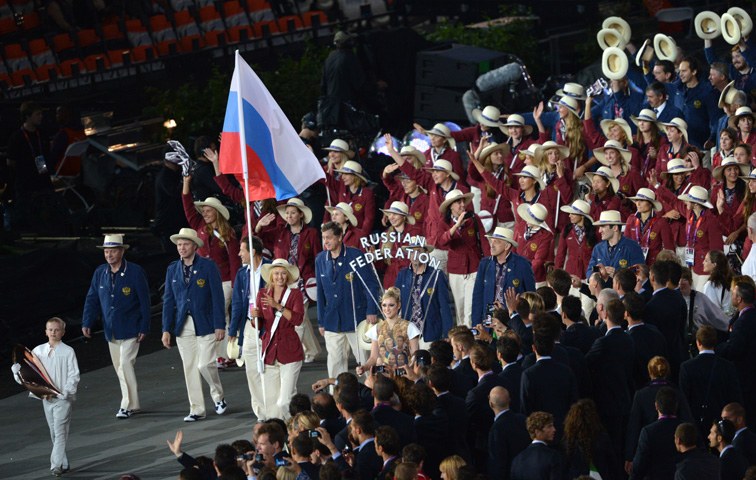






Was ist Ihre Meinung?
Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.