Ein gutes Jahrzehnt hat sie gehalten. Die sogenannte Qualitätsserie hat nicht nur das TV revolutioniert – und die bis 2000 geltenden Sehgewohnheiten gleich mit. Nicht wenige sind dem neuen Format im Lauf der Nuller-Jahre geradezu verfallen. Dem extensiven, ziellosen Erzählen. Der Story pur. Den (vielen) Helden und (zugegeben: weniger vielen) Heldinnen mit ihren Schatten- und auch Lichtseiten. Wie etwa Don Draper, den melancholisch-geheimnisumwitterten Werbeprofi. Der uns Nerds und Serienjunkies nicht nur lehrte, wie man Lucky Strike-Zigaretten raucht. Sondern uns auch zeigte, wie man sie professionell vermarktet. Oder Walter White, dem Bildungsbürger als Drogenhändler. Dem wir – Gesetz hin, Gesetz her – die Daumen drückten, dass der nächste Meth-Deal glatt über die Bühne geht. Getreulich begleiteten wir den Vorstadt-Mobster Toni Soprano zu seinen Psychotherapie-Sitzungen, flunkerten mit ihm zusammen seiner Tochter gutgemeinte Lügenmarchen vor und seiner Frau Carmella halbgare Entschuldigungen (die gleichfalls nicht immer stimmten). Und, auch das war zu Startzeiten eines weiteren Serien-Hoffnungsträgers drin: hielten im Knast Händchen mit der gelegenheitslesbischen Drogenkurierin Piper Chapman.
Von Dramedy zu plattem Klamauk: die Netflix-Serie »Orange Is The New Black«.
Die Kanonisierung der letzten Helden
Künstlerisch ist das Erzählformat Qualitätsserie fast fünfzehn Jahre rund gelaufen. Die Klassiker unter den Klassikern – The Wire, Mad Men und Die Sopranos – sind erfolgreich abgeschlossen. Einsortiert und blankpoliert stehen die Box-Sets hoch oben im Genre-Regal der Hall of Fame. Ebenfalls dort einsortiert: Breaking Bad – in derselben Liga spielend, im Rückblick gesehen allerdings der Spätkömmling. Die letzte der richtig Großen, welche die Kanonisierung unbeschadet in trockene Tücher brachte. Mehr noch: Medien-Studierende der Zukunft werden Breaking Bad als wesensbildenden Einschnitt betrachten – als Schnittmarke, welche das Genre in ein »davor« und ein »danach« aufteilt.
Die Verramschung des Genres hat längst begonnen. Aber woran erkennt man sie? Gute Seismographen, was den Trend anbelangt, sind die beiden letzten noch laufenden Meilensteinen der alten Garde: die Fantasy-Saga Game of Thrones und das Politdrama House of Cards. Game of Thrones geht im Juli in die siebte Staffel – inklusive gebührender Vorab-Berichterstattung in den Medien, zum Beispiel bei stern.de. Vordergründig hat die Serie in den letzten Staffeln zugelegt. Waren bei den ersten dreien die Mittel noch knapp und die Hauereien eher Gefechte denn echte Schlachten, scheut Auftraggeber HBO mittlerweile keine Ausgaben, um den finalen Kampf um die Thronfolge auf Westeros angemessen in Szene zu setzen. Ungeachtet dessen haben die Serienmacher den Spagat zwischen oppulenten Bildern und dem düsteren Ernst des Inhaltes weitestgehend halten können. Im Gegenteil: Was die Charakterzeichnung anbelangt, wurde GoT sogar von Staffel zu Staffel besser.
Nun dreut das Finale. Sieben soll eine Doppel-Sieben werden – mit reduzierter Folgenanzahl und definitivem Finale 2018. Festgelegt sind die Serienmacher dabei nicht nur durch die Vorlage von George R. R. Martin. Ebenso mitzubedenken ist mittlerweile das Schicksal der beiden Publikums-Favoriten – der exilierten Drachenkönigin Daeneris Targaryen und Jon Schnee, dem selbstlosen Soldaten der guten Sache. Was für die Serie letztlich heißt: Bis 2018 wird es zwar noch einiges an Kabale (sowie spektakulären Schlachten) geben. Auf ein Zuschauer-zufriedenstellendes Happy End für Daeneris und Schnee darf allerdings schon jetzt gewettet werden – unabhängig davon, wie Buchautor Martin sein Feuer-und-Eis-Epos zu beenden gedenkt.
Vom Trump-Effekt eingeholt: die Politserie »House of Cards«.
Während Game of Thrones unweigerlich einem massenkompatiblen Finale zudriftet, wurde House of Cards, der zweite unter den noch laufenden Klassikern, von der Realität eiskalt erwischt – genauer: dem Trump-Effekt. Auch hier kann man den Serienmachern wenig vorwerfen. Die Underwoods und ihr Drang nach Macht waren einfach zu offensichtlich am Modell Clinton angebaut. Dass Hillary Clinton scheitern würde und die USA mit Trump einen Präsidenten bekommen, der die schlimmsten Szenarien von HoC überbietet, konnte niemand voraussehen. Doch wie geht HoC damit um? Staffel fünf, gerade angelaufen, dreht sich um den »Krieg gegen den Terror« – ein aktuelles Thema also. Angesichts des Inpeachments, welches als Möglichkeit derzeit über der Karriere von Donald Trump schwebt, sind selbst die Versuche der Underwoods, aus der Übergangs-Präsidentschaft eine dauerhafte zu machen, eher Trockenübungen aus der Old School-Ära der Politik. Unabhängig davon stellt sich die Frage, welche Höhen den beiden Protagonisten noch bleiben für eine sechste, siebte, achte Staffel. Die Weltherrschaft? Selbst wenn es so wäre, bliebe die Frage mitzubedenken: Ist nicht die Realität – mal rein nach Gefühlseindruck – letztlich unwahrscheinlicher als der beste Serien-Plot?
Die beiden noch laufenden Klassiker haben immerhin eines gemein: eine hohe Fallhöhe. Ebenso die Gewissheit, dass sie (höchstwahrscheinlich) die Kurve kriegen werden, um ihren Platz im Kanon dauerhaft zu behaupten. Umgekehrt zeigen GoT und HoC allerdings den Fluch des nach oben offen gehaltenen Staffel-Konzepts: Ein schlüssiger Schluss, ein nachvollziehbares Ende ist im Konzept ein nachrangiger Punkt – jedenfalls, so lange die Masse nach »mehr« schreit. Ein Zustand, der zunehmend die Handlungsplanung erfolgreicher Produktion bestimmt. Anders gesagt: Waren die Macher der Sopranos, von Mad Men und Breaking Bad noch frei, ihre Geschichten selbstbestimmt einem schlüssigen (oder auch: überraschenden) Ende entgegenzuführen, sitzt den heutigen Produktionen das Verkaufskalkül der auftraggebenden Sender im Nacken. Staffel für Staffel und Folge für Folge.
Zurück zum Bügel-TV?
Beispiel Netflix. Einerseits hat sich Netflix – neben dem US-amerikanischen Pay-TV-Kanal HBO – zu der Adresse schlechthin für anspruchsvolle Serien gemausert. Das Problem allein ist der Nachschub. Genauere: dessen Güte. Seit das Thema Qualitätsserie es in Uniseminare und Bücherregale geschafft hat, produzieren die einschlägigen Auftraggeber zwar Serien, als ob es kein Morgen mehr gäbe. Ebenso unverhohlen versuchen jedoch alle, den Erfolg kommerziell erfolgreicher Produktionen zu kopieren. Folge: Kaum ein Neustart, der nicht verglichen wird mit einem der handelsüblichen Götter im Olymp. Die Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland, in Sachen Serie anerkanntes Schlusslicht, beherrschen die Kunst des Marketing-Geklappers sogar in zweifacher Hinsicht. So werden maue Eigenproduktionen nicht nur stetig mit Breaking Bad, House of Cards oder andern Größen verglichen. Meister sind ARD & Co. auch in der Kunst, das frühere Format des Mehrteilers unter neuem Label zu vermarkten. Neueste Wortschöpfung hier: Miniserie. Die praktische Umsetzung: Entweder offerieren die Sender gleich alten Wein in neuen Schläuchen wie bei der ARD-Produktion Charité. Oder ein der Unkonventionalität verdächtiger Neustarter wird erstmal an der kurzen Leine gehalten – wie die Sky-Produktion 4 Blocks.
Ob öffentlich-rechtlich oder privat: Der Qualitätsknick bei den einschlägigen Anbietern resultiert nicht allein aus dem derzeitigen Überangebot. Fast alle Medienwissenschaftler und Journalisten, die sich mit dem Phänomen Qualitätsserie beschäftigen, heben in ihren Publikationen das freie, kreative Spiel von Trial & Error hervor, dass zu den überragenden Meilensteinen von vor zehn, fünfzehn Jahren geführt habe. Unbehelligt von den Sendern, so Alan Sepinwall, der Autor von Die Revolution war im Fernsehen, konnten die Macher experimentieren. Kreativ sei die Szene um das Jahr 2000 herum ein wahres El Dorado gewesen. Da Qualitätsserie eine Nische gewesen sei für ein anspruchsvolles, cineastisch geprägtes und jüngeres Publikum, hätten die Sender fast alles genommen, was die Produktionsfirmen produzierten. Das Ergebnis, historienfest auf den Punkt gebracht: ein neues Goldenes Zeitalter des TV, dass in den Nuller-Jahren über die Zuschauer hereingebrochen sei.
Qualität macht sich nicht bezahlt: »Bloodline« wurde nach drei Staffeln eingestellt.
Auch der Branchennachwuchs hat sich des Themas längst angenommen. Allerdings sind die Dinge zwischenzeitlich im Fluss. Insbesondere Netflix mit seiner Marktforschung ist maßgeblich daran beteiligt, das ausgerufene Goldene Zeitalter final zu Grabe zu tragen. Einerseits heimste der kalifornische Streaming-Anbieter viel Lob ein – speziell auch für seine nicht auf den US-Markt fokussierte Programmpolitik. Im Ergebnis setzt jedoch auch Netflix knallhart auf Massenpublikum. Beispiel Bloodline: Einerseits wartete das Familiendrama mit der Fehlkonstruktion auf, dass bereits die erste Staffel zu viel Plot-Pulver verschoss. Trotz dieses Konstruktionsfehlers jedoch hielt sich die Serie beachtlich. In Sachen anspruchsvoller Unterhaltung mit Tiefgang (und ohne zuviel Tote oder Brutalität) zeichnete sie ein Terrain ab, dass für den neuen Typ Serie durchaus als beispielhaft gelten kann. Nichtsdestotrotz beendete Netflix das Experiment nach drei – volumentechnisch zudem immer weiter reduzierten – Staffeln.
Für das künstlerische Herunterfahren einer (einstmals) guten Serie ist Netflix’ Knast-Dramedy Orange Is The New Black geradezu das Lehrbuch-Beispiel. Während Bloodline, vom Auftraggeber bereits abserviert, eisern weiter auf Hochniveau blieb, erfuhr die beim Massenpublikum ankommende Knastserie einen Total-Relaunch, bei dem kein Stein auf dem anderem blieb. Von Staffel zu Staffel rutschte OITNB weiter ab in Richtung Banalität und Klamauk. Speziell die Logiklöcher der Serie haben sich zwischenzeitlich zu wahren Kratern ausgeweitet. Die Hauptfigur, die ursprünglich eine Kurzzeitstrafe absitzen sollte, gehört nach fünf Staffeln Litchfield-Knast mittlerweile zum Inventar.
Irgendeine Erklärung für diesen Umstand? Fehlanzeige. Gewöhnungsbedürftig sind auch die krassen Genre-Schlenker, für die OITNB – je nach Sichtweise – berühmt oder berüchtigt ist. So startet Staffel fünf zwar mit einer ausgewachsenen Häftlings-Meuterei. Draußen indess ist dieser Umstand nicht weiter der Rede wert – mit der Folge, dass sich die aufständischen Protagonist(inn)en unbeschwert weiter durch die einzelnen Folgen durchkalauern. Möglich, dass auch hier ab Serienmitte wieder echte Handlung ins Spiel kommt. Für Zuschauer indess, die ernsthaftere Konfliktkonstellationen erwarten, dürfte Orange Is The New Black endgültig verbrannt sein – ungeachtet der Tatsache, dass Mainstreammedien wie Spiegel Online weiter an der Lobberichterstattung über die Serie festhalten.
Während es bei Orange Is The New Black vier Staffeln brauchte, um die Serie auf Massengeschmack zuzurichten, kommt der Nachschub Marke Serie 3.0 direktaus der Verkaufsabteilung. Neu im Visier der Netflix-Marketingstrategen: junge, potenziell gebildete und entsprechend zahlkräftige Zuschauer(innen). Entsprechend stark winkt der Sender mit den Lifestyle-Attributen der zeitgemäss-modernen political correctness. Gleich zwei Sitcoms sind auf diesen neuen Markt abgestellt. Gutes Wedding, schlechtes Wedding ist eine deutsche Produktion, die bereits beim rbb lief. Dear White People ist nach einem ähnlichen Muster gestrickt – mit dem Unterschied, dass das Political-Correctness-Dauergealbere dieser Produktion im Edelholz-Interieur einer amerikanischen Eliteuni angesiedelt ist. Wass würde Toni Soprano wohl dazu sagen? Vermutlich wenig. Und stattdessen lieber ein Nickerchen am Swimmingpool machen.
Ausverkauf, oder: Die Menge macht’s
Ob diese Zielgruppen-Designprodukte ihr Publikum finden? Massentauglichkeits-Tests sind bei den großen Playern mittlerweile Standard. Die härtesten absolviert bekanntlich amazon. Bis 2015 hielt sich der Buch-Gigant aus Seattle in Sachen anspruchsvoller Eigenproduktionen vollends bedeckt. Zwischen Anspruchs- und Massenpublikum verpuffte so auch der einzige Testlauf in Sachen Ambitions-Fernsehen: die schwüle Nazi-Science Fiction The Man In The High Castle. Auch bei amazon ist es so, dass in der Masse durchaus qualitiativ Besseres zu finden ist – beispielsweise die Noir-lastige Anwaltsserie Goliath oder das Sektendrama The Path. All diesen Versuchen haftet allerdings das Odium an, halbherzig gestartete Versuchsballons zu sein. Dass Goliath sich – trotz Schauspieler-Ass Billy Bob Thornton – dauerhaft etabliert, wird aktuell wohl niemand annehmen. Und auch The Path wird – sofern kein Wunder geschieht – den Lauf nehmen, der aktuell den meisten Produktionen auf die Stirn geschrieben ist: hoffnungsvoll gestartet, dann alsbald versackt.
Das Problem: The Path, Bloodline und Goliath markieren die guten, herausragenden Produktionen der Jahre 2015 bis 2017 – nicht die Durchschnittsware. Den nötigen Vertrauensvorschuss mag ihnen allerdings kaum noch jemand geben. Nicht das irritierte Stammpublikum, dass mit Serien geflutet wird und kaum noch eine Chance hat, die Spreu vom Weizen zu trennen. Und nicht die Streaming-Kanäle mit ihren Standardisierungs-Bemühungen und ihrer Verheiz-Politik nach dem Motto »Wenn es nichts ist, wird der Vertrag nicht verlängert.« Programmpflege hat bei diesem Konzept irgendjemand vergessen.
Aus der Pflege aus steigen zunehmend auch europäische Produktionsfirmen und Auftraggeber aus. Beispiel: die schwedische Familiensaga Blutsbande – eine gelungene Adaption des Bloodline-Themas, die mit Ausstrahlung von Season drei in den finalen Exitus geschickt wurde. Novum hier: Die Hire-and-Fire-Geschäftspolitik der US-amerikanischen Streamingdienste wurde in diesem Fall auch von mit beteiligten Öffentlich-Rechtlichen mit exekutiert. Das Fazit jedenfalls ist angesichts der beschriebenen Gegebenheiten eindeutig: Die Ära der Qualitätsserie ist vorbei – aus Verflachungsgründen, wegen der Gier, mit dieser neuen Goldgrube das schnelle Geld zu machen, aus der aus all diesen Erscheinungen resultierenden Übersättigung des Publikums. Sicher: Vermutlich – sofern der Himmel nicht einstürzt – werden noch viele neue Serien in Produktion gehen. Ebenso sicher ist allerdings, dass mit den finalen Folgen von House of Cards und Game of Thrones eine Ära final zu Grabe getragen werden wird.
Was wird als Nächstes kommen? Möglicherweise steht YouTube in den Startlöchern, um die alte Ära mit neuen Angeboten zu beerben. Als Rückblick bleibt somit nur zu sagen: Es war eine schöne Zeit. Aber nun ist der Punkt gekommen, um Netflix & Co. langsam Adios zu sagen.
HINTERGRUND:
Alan Sepinwall: Die Revolution war im Fernsehen. Luxbooks, Wiesbaden 2014. 462 Seiten, 16 €. ISBN 978-3-893201-99-0.
Berthold Seeliger: I Have A Stream. Edition Tiamat, Berlin 2015. 304 Seiten, 16 €. ISBN 978-3-893201-99-0

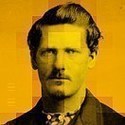



Was ist Ihre Meinung?
Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.