Teaser zur neuen Netflix-Serie Narcos. Titelsong: Tuyo von Rodrigo Amarante.
Der Boom der ambitionierten TV-Serien reißt nicht ab. Glaubte man, die letzte Staffel von Favorit XY habe die Grenzen des seriellen Erzählens endgültig ausgeschöpft, lauert die nächste Überraschung bereits in der nächsten DVD-Box oder beim nächsten Pay-TV-Anbieter. Bisweilen gelingen markante Brüche sogar innerhalb einer Serie. Lotete True Detective 1 etwa den Nihilismus des Neo-Noirs bis zum Grund aus, zeigt die aktuell laufende Staffel zwei, dass diese Form Geschichte auch mit einer völlig anderen Konstellation funktioniert.
Allerdings – ungeachtet der nicht abreißenden Erfolgsmeldungen muß man konstatieren, dass das epische Erzählen in Folgen und Staffeln zunehmend an seine Grenzen stößt. Ganz speziell gilt diese Regel für das Sub-Genre der Mafia-Epen. Ist nach dem Paten, Goodfellas, den Sopranos und Boardwalk Empire nicht jeder Aspekt ausgeleuchtet und jede Neuauflage zwangsläufig ein Neuaufkochen der alten Mythen? Es kommt darauf an. Während der US-amerikanische Pay-TV-Sender starz kürzlich mit der recht konventionell gemachten und handlungstechnisch vorhersehbaren Serie Power in die Startlöcher ging (Mitproduzent: der Rapper 50 Cent), legte Streaming-Anbieter Netflix Ende August eine Serie vor, deren Plot so spröde, so abwegig ist, dass sie mühelos auch als semifiktionale Doku reussieren könnte: Narcos – die Geschichte vom Aufstieg und Fall des kolumbianischen Medellín-Kartells. Und, natürlich, seines berühmtesten Epigonen: Pablo Escobar.
Koks, Macht, Politik
Obwohl Escobar und die kolumbianischen Koka-Kartelle seinerzeits auch hierzulande Schlagzeilen machten, ist die Geschichte erklärungsbedürftig. Netflix als auftraggebender Sender hat gleich in zweierlei Hinsicht den großen Spagat gewagt. Zum einen durch die Entscheidung für eine Bildästhetik, die von der gelackten Perfektion US-amerikanischer Produktionen ebenso weit weg ist wie von den visuellen Experimenten des europäischen Anspruchskinos. Farben, Styling, die Bildsprache sowie die schnelle, collagenhafte Schnittform orientieren sich vielmehr am expressiven Stil lateinamerikanischer Telenovela- und Filmproduktionen. Eine noch stärkere Abkehrung vom Serienmainstream ist der dokumentarhafte Erzählstil, welchen Serienschöpfer Chris Brancato und sein Team für die Escobar-Story in Szene gesetzt haben. Action gibt es zwar auch. Vorwärts getrieben wird die Geschichte allerdings durch massig Geschichts-Nachhilfeunterricht aus dem Off. Zusätzlich nicht unbedingt der Orientierung zuträglich: Alle spanischsprachigen Dialoge (also ungefähr drei Viertel) wurden in der Originalsprache belassen und sind mit Untertiteln unterlegt.
Was man in den ersten zwei, drei Folgen leicht als entschieden zu viel vom Guten wahrnimmt, ergibt im weiteren Verlauf der Serie zunehmend Sinn. Dafür allerdings muß man erst einmal Geduld aufbringen. Vor allem, da der – den Fortgang des Drogenkriegs stetig aus seiner Sicht erklärende – Off-Erzähler auch auf notorische Antihelden-Fans eher als Sympathiekiller denn als sinnstiftende Identifikationsfigur wirken dürfte. DEA-Agent Steve Murphy (gespielt von Boyd Holbrook) ist zwar – nach Pablo Escobar (gespielt von dem brasilianischen Schauspieler Wagner Moura) – die zweite Hauptfigur des Films. Doch bereits die ersten Szenen (die Murphy bei der polizeilichen Verfolgung harmloser Kiffer im Miami Beach der Siebziger zeigen) machen klar: Warm werden können mit diesem Typen allenfalls notorische Ronald-Reagan-Fans sowie Befürworter verdeckter US-Operationen.
Letztere sind in Narcos quasi allgegenwärtig. Bereits der Aufstieg Escobars vom mittelständischen Schmuggelrouten-Unternehmer zum Boss des mächtigsten Drogenkartells Lateinamerikas ist – wie die erste Folge verdeutlicht – eine Folge des Anti-Drogen-Kurses der 1973 an die Macht gelangten Pinochet-Junta in Chile. Als Partner für sein neues Geschäft rekrutiert Escobar einen chilenischen Fachmann mit einschlägiger Erfahrung. Die ersten Connections sind schnell aufgebaut. Zug um Zug sehen wir der Entstehung des späteren Medellin-Kartells zu. Escobars Motto, beim Schmuggel wie beim Drogenhandel: Silber oder Blei. Was übersetzt heißt: Wer sich nicht in das System der Patronage, der Bestechung und des Seitenwechsels einfügt, der wird ein böses Ende haben – mit oder ohne Familie.
Im Kolumbien der Achtziger Jahre sind Korruption, Gewalt und Verbrechen allgegenwärtig. Auch die politischen Ursachen, die wechselseitigen Akteure aus Politik, Polizei, Militär, Paramilitärs sowie ihre Gegenspieler in Form bewaffneter linker Gruppen sind in Narcos nicht ausgespart – im Gegenteil. Die US-Politik, die als weiterer Part im Anti-Drogen-Krieg auf den Plan tritt, macht die Angelegenheit letztlich nur schlimmer. Geschichts-Nachhilfeunterricht also, wenn auch auf sehr ambitionierte, neuartige Weise? Ja, auch. Allerdings: Spannend wird die Serie nicht wegen, sondern trotz der beiden Antipoden. Während der von Moura gespielte Serien-Escobar zunehmend die Jovialität und Exzentrik von Hitler mit der Paranoia von Stalin in einer Person konzentriert, schießt und irrlichtert sich DEA-Agent Murphy blind, aber putzmunter durch seine Karriere.
Where’s the Love? There’s Nothing. Beziehungen kommen in dieser Welt des Hilfst-du-mir-helfe-ich-dir nur als Interessen vor. Am ehesten sympathietauglich ist Javier Peña, ein kolumbianischer DEA-Mitarbeiter, der Murphy als Partner beigeordnet ist. Als die linke Guerilla M-19 reinfunkt, eine Angehörige der Gruppe – mit ihrem Gewissen im Unreinen – eine geplante Aktion an die Gringa-Krankenhauskollegin in Form von Murphys Frau verrät und um Schutz bittet, ist es Peña, der die Frau in Sicherheit bringt – vor seinem Kollegen, der Polizei und den Paramilitärs, mit denen die DEA aktuell zusammenarbeitet. Die in flapsig-überheblichem Ton vorgetragene Off-Erzählung Murphys dürfte für liberal eingestellte Zuschauer öfters hart an der Schmerzgrenze entlangschrammen. Insbesondere dann, wenn Murphy dem Publikum die diversen Windungen im US-Drogenkrieg zu erklären versucht: gestern noch mit aller Macht gegen die Narco-Kartelle, plötzlich dann – wir befinden uns Mitte der Achtziger – gegen linksgerichtete Guerilleros. Notfalls auch zusammen mit den Kartellen und Paras.
Jeder gegen Jeden – Folter, Mord und polizeiliches Waterboarding inklusive. Was über weite Strecken zu viel an Dokumentation, an unverschnörkeltem Realismus wird, kriegt im letzten Seriendrittel auch dramaturgisch seinen Sinn. Das Auslieferungsgesetz, auf das DEA und US-Konsulat in seltener Einmütigkeit dringen, scheitert. Der Escobar-Wahnsinn geht ins Finale. Der Drogenbaron kehrt nach Kolumbien zurück – allerdings unter Bedingungen. Die Bedingung: ein Privat-Knast, im Volksmund La Catedral genannt – unbeaufsichtigt, mit freiem Verkehr von Waren und Mensch von draußen nach drinnen (und umgekehrt). Doch die Politik ändert sich – langsam, unbemerkt. Das Problem: Escobar kriegen (und an die verhaßten Yankees ausliefern) – aber möglichst so, dass der blutige Krieg aus den Achtzigern nicht wieder auflebt. Das Ende der Serie soll an der Stelle nicht verraten werden. Das Ende der Geschichte ist allerdings bekannt: Bedroht von einer Gefängnisverlegung, ergriff Escobar die Flucht. Zwei Jahre später, 1993, erschoss ihn eine amerikanisch-kolumbianische Eliteeinheit bei einer Razzia in Medellín.
Mehr als die Summe der Teile
Fazit am Ende: Narcos ist nicht nur eine hochambitionierte Serienproduktion, eine Serie, die gegen das Spiel spielt. Der wilde Mix aus Off-Ton, dokumentarhaft erzählter Handlung, realistischer Straßenaction und Originalmaterial-Einsprengseln führt am Ende zu dem Ergebnis: die einzige Form, in der die Geschichte der kolumbianischen »Cocaine Cowboys« erzählbar ist – zumindest glaubhaft, zumindest in einem fiktionalen Format. Der Begriff ist ursprünglich zwar der Titel eines Dokumentarfilmes, der den Antidrogenkrieg auf US-amerikanischem Terrain beleuchtete. Das Glücksrittertum, die unwahrscheinlichen Profite, das Elend, der Tod, die Aufstiegsmöglichkeiten und die (politischen) Bewegungen, die das weiße Pulver in Bewegung setzte, ist mit dem cowboyhaften Agieren der US-Politik in den lateinamerikanischen Ländern gut auf den Punkt gebracht.Narcos, die fiktionale Neuauflage des Themas schließlich, hat die Thematik auf eine Weise eingefangen, die einerseits zwar »noch« unterhaltsam ist (in der Beziehung vergleichbar mit dem US-Serienmeilenstein The Wire), andererseits aber Information transportiert wie kaum eine Serie zuvor.
In dem Sinn ergibt auch die gewisse Spröde, der Verzicht auf die obligatorischen Love Stories, das betonte Desinteresse an Zwischenmenschlichem einen Sinn. (Was nicht heißt, dass es nicht vorkommt. Es ist nur nicht, wie sonst meist, unmittelbarer Handlungs-Transporteur.) Anders beschrieben: Nur in dieser abgerippten Form werden die politischen Zusammenhänge, der große, sich zeitgeschichtlich über anderthalb Jahrzehnte erstreckende Erzählstrang begreifbar. Im besten Fall erweckt Narcos Interesse – nicht nur für die »Home Story« eines in den Größenwahn abdriftenden Drogenbarons, sondern auch für das Land, in dem sich all dies abspielte (und, in modifizierter, etwas abgemäßigter Form, noch immer abspielt).
Ein Fact, der dazu sicherlich beiträgt, sind die großartigen Bilder – von Kolumbien, der Landschaft dort, den Städten, den Menschen. Für die Serienlandschaft bedeutet Narcos zweierlei: Zum einen, dass die globalisierten Medienmärkte enger zusammenrücken – TV-Zuschauer inklusive. Drogenkrieg ist zwischenzeitlich nicht nur eine mediale Option. Er rückt uns – siehe jüngstes Beispiel Mexiko – auch via Nachrichten unmittelbar auf die Pelle. Auch die Sehgewohnheiten ändern sich. Will heißen: Selbst bei kommerziellen Produktionen sind sie nicht mehr so zwangsläufig wie früher auf eine hollywoodhafte Ästhetik fixiert.
Vom Erfolg seiner neuen Serie dürfte schließlich auch auf Auftraggeber Netflix ein warmer Scheinwerferschein abstrahlen. Der Sender hat prompt reagiert: Eine zweite Staffel ist bereits in Auftrag gegeben. Dicht an den Fersen: die Konkurrenz: Interesse an halbfiktional-authentischen Geschichten aus der Welt der internationalen Kartelle verrät der Erfolg einer weiteren Produktion jüngeren Datums: Gomorrah – eine italienischen Serie, die ihre Pay-TV-Phase gerade hinter sich hat und Ende September auf DVD erscheint. Wenn man so will: Die internationale Welt des (organisierten) Verbrechens bleibt weiterhin Thema – auch und gerade in der Popkultur. Und ihrem derzeit wohl innovativsen Format.
Eine Welt zum Abschalten? Biedermeierliche Vorgartensiedlung-Idylle herrscht lediglich bei den Öfffentlich-Rechtlichen. Seit die ARD die vielgelobte und mit Preisen überschüttete Dominik-Graf-Serie Im Angesicht des Verbrechens einstellte, sind die deutschen TV-Zuschauer vollends auf Tatort-Hausmannskost zurückgeworfen. Verpennt? Desinteressiert? Egal – anderes Thema. Fact ist, dass HBO – und nun auch Netflix – beim aktuellen Erzählformat, der ambitionierten Serie, mehr und mehr die Nase vorn haben. Wobei Netflix mit Narcos eine Serie hingelegt hat, die nicht nur ungewöhnlich ist, sondern trotz ihrer Spröde fesselnd, einzigartig und – im besten Sinn – politisch.
Narcos. TV-Serie. Bislang 1 Staffel mit 10 Folgen. Seit Ende August als Streaming-TV bei Netflix abrufbar.
Weitere Rezensionen:
»Narcos«: Der Aufstieg und Fall des Kokain-Fürsten Pablo Escobar (stern)
Die größte Waschmaschine der Welt (SPON)
Silber oder Blei (ray – Filmmagazin)
»Narcos« und »Hand of God«: Die Qual der Wahl (derStandard.at)
»Narcos«: Wo das Koks regiert (radio leverkusen)
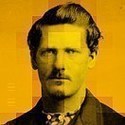




Was ist Ihre Meinung?
Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.