»Wir brauchen euch, ihr braucht uns nicht.« In ihrem – in der aktuellen Print-Ausgabe des Freitag dokumentierten und darüber hinaus auch online gestellten – Brief an die Westdeutschen thematisiert die aus dem Osten stammende Freitag-Redakteurin Jana Hensel ihr Unbehagen mit den Besserwessis – mit ihrer Arroganz, ihrer Macht, ihrem Geld und, vor allem, ihrem aufdringlichen Nicht-Bescheid-Wissen. Mit-Auslöser der Replik: eine launische, in beleidigt-selbstgerechtem Anklageton verfasste Polemik bei Zeit Online. Streit vor Festtagen? Normalfall, könnte man sagen. Vor allem, wenn es um das Dauerthema Ossis versus Wessis geht. Denn: Ungeachtet dem obligatorischen Kreuzen journalistischer Federn und ungeachtet dem an der Grenze zur Pöbelei angelegten Biermann-Auftritt anlässlich der Mauerfall-Gedenkstunde im Deutschen Bundestag ist und bleibt der 9. November Chefsache. Und der Fall der Berliner Mauer – Punktum, Basta – zentrales Element in der Feier-Agenda der Berliner Republik.
Noch Fragen? Nein? Sehr gut. Denn: Ungeachtet aller Widersprüche, Peinlichkeiten und laufenden Kampagnen wird auch im November 2014 an schwarzrotgoldenem Lametta nicht gespart. Zwar deklarierten die beiden deutschen Regierungen in ihrem letzten gemeinsamen Akt nicht den 9. November, sondern den 3. Oktober zum Tag der Deutschen Einheit. Doch selbst für beinharte Einheitsenthusiasten ist der Oktobertermin zweite Wahl – Pflichtermin, komplett unsexy. Bedeutungstechnisch markiert der 1990 aus der Taufe gehobene Staatsfeiertag das Inkraftsetzungsdatum einer juristischen Vereinbarung – des Beitritts der DDR zur Bundesrepublik Deutschland. Mental bot er mit seinem staubtrockenen Anlass einen Vorgeschmack – allerdings weniger auf Friede, Freude & Völkerverständigung, sondern auf das Selbstverständnis der sich neu sortierenden Politikelite. Bereits die Terminwahl war eine nicht gerade bagatellartige Geschichtsklitterung. Anders als etwa der Nationalfeiertag der Franzosen kennzeichnete er nicht einen Anfangspunkt (im Fall Frankreich: den Sturm auf die Bastille), sondern einen am Reißtisch entworfenen diplomatischen Schlussakt. Darüber hinaus kehrte er ein turbulentes Fast-Jahr unter den Teppich – elf Monate, die viele Abzweigungen in sich bargen und durchaus auch hätten anders verlaufen können. Last but not least: Selbst die bürgerlich-konservative FAZ sah sich gezwungen, das sonderbare Datum ihrer Leserschaft zu erklären. Vielsagende Dachzeile des FAZ-Artikels: »Wie erkläre ich es meinem Kind?«
Mythen und Realitätsschocks
So ist bis heute der 9. November der Tag, auf den sich die Emotionen fokussieren. Anders als der 3. Oktober hat er zumindest die Kraft der Bilder auf seiner Seite. Allerdings sprechen die Bilder längst nicht mehr die Wahrheit. Man muß nicht von »brauchen« reden, wie Jana Hensel in ihrem Brief an die Westdeutschen. Je länger die Zeit voranschreitet, desto stärker legt sich das Grau der Wirklichkeit über die historische Einheitsszenerie. Die mental-geografische Spaltung in Ossis und Wessis mag nicht so krass sein wie das Gefälle zwischen Nord- und Süditalien. Fakt ist allerdings: Statt blühender Landschaften hat die Wiedervereinigung weiten Teilen Ostdeutschlands Verödung gebracht, hohe Arbeitslosigkeit, Westflucht sowie das mit jedem neuen Anlass sich fortfressende Gefühl, in der Gesamtrepublik nicht angekommen zu sein. Menschen zweiter Klasse – auf längere Sicht ging sowas selten gut. Für Negativschlagzeilen sorgen auch die hässlichen Seiten der Wiedervereinigung: der Neonazismus, Rassismus und Rechtspopulismus, die in weiten Teilen der östlichen Bundesländer an Breite, manchmal sogar die Oberhohheit gewonnen haben. Ebenso – auf der anderen Seite – eine Regionalpartei, die vom politischen Establishment der Republik nach Kräften ausgegrenzt wird.
Der Gründermythos von der »friedlichen Revolution in der DDR« schert sich erstaunlich wenig um die Realität, die danach kam. Ähnlich wie bei einer Ehe, an der (wirtschaftlich) zu viel hängt, als dass sie geschieden werden dürfte, beschwört man auch in Deutschland stetig den alten Liebestraum. Faustregel: Die Dosierung des staatsoffiziellen Pathos erfolgt umgekehrt proportional zu den beschissenen Zuständen. Die Menschen, die auf der Mauer feierten, die ausgelassenen Szenen, das improvisierte Pathos – je weiter die Zeit voranschreitet, desto stärker werden die Mauerfall-Tage mit einem Weichzeichnungs-Softschleier überlegt. Sicher – die Bilder lügen nicht. Allerdings legen sie sich wie ein alles überdeckender Zuckersirup über die tatsächliche Entwicklung. Als Staatseliten-gelenktes Grundrauschen übersteuert das Mauerfall-Datum darüber hinaus zwei andere Scheidemarken der jüngeren deutschen Geschichte: a) die bis heute gern als »Kristallnacht« verharmlosten Novemberpogrome 1938, b) die Ausrufung der ersten deutschen Republik am 9. November 1918.
1989 – 1938 – 1918: Alle drei Ereignisse hatten Folgen, welche die kollektive wie individuelle Entwicklung zwischen Rhein, Oder, Nordsee und Alpen auf recht nachhaltige Weise prägten. 1918 war das Geburtsjahr des Scheiterns der ersten deutschen Demokratie. Scheidemann und Liebknecht riefen die Republik aus; zwei Monate danach schmiss man die Leiche von Rosa Luxemburg in den Berliner Landwehrkanal. Der Pakt der bürgerlichen Demokraten mit den wilhelminischen Eliten brachte bekanntlich nur einen kleinen Aufschub. Grosso modo führte er ziemlich geradlinig in jenen deutschvölkischen Furor, der sich im November 1938 auf unübersehbare Weise manifestierte und erst nach einem Weltkrieg mit über 50 Millionen Toten sein Ende fand. 1989 ist das große Kontrastdatum. Der (inoffizielle, wenn man so will: ungefragt ausgeborgte) Ehrentag der widerborstigen, zivilcouragierten DDR-Bevölkerung gilt, was die Geschichte der Bundesrepublik anbelangt, allgemein als der große, entscheidende Cut. Die alte Bundesrepublik ging zu Ende, ein größeres, unbestimmt bleibendes Deutschland nahm seinen Anfang. Die West-Linke hat es kommen sehen. Aber waren die Ereignisse, die Wahrnehmungen so einheitlich?
Die Linke und die Wiedervereinigung
Auch die Heimatgeschichte der Westlinken hat ihre Lecks. Die offizielle Geschichtsschreibung verweist vor allem auf Oskar Lafontaine, den frühen Einheitsskeptiker, sowie die Grünen, die sich (zunächst) gleichfalls einheitskritisch positionierten. Im linksradikalen Jahreskalender markiert der 9. November die Geburtsstunde der Radikalen Linken – ein Zusammenschluss, aus dem später die antideutsche Strömung hervorging. Sicher: Einheitsskepsis war im westlinken Mileu massig vorhanden – hinweg über alle Schattierungen und Ausprägungen. Skepsis, Befürchtungen und Vorbehalte speisten sich aus unterschiedlichen Quellen. Ein wesentlicher Strang war die reservierte, kritische Haltung zum östlichen Staatssozialismus-Modell generell. Ebenso die zu Honeckers Zuckerbäckerrepublik – wobei man sich nicht so recht entscheiden mochte, ob man mehr die autoritären Strukturen ablehnte oder allgemein das Spießige, Kleinbürgerliche, Stickige im selbsternannten Arbeiter- und Bauernstaat. Profan lautete die Gretchenfrage im November 1989: »Geht uns das was an?« Ja? Nein? Die westdeutschen Bewegungen hatten ihre eigene Biografie des Scheiterns hinter sich. Gescheitert war insbesondere die Friedensbewegung. Ebenso gescheitert war die sozialliberale Entspannungspolitik sowie ihr wesentlicher Träger, die SPD. Nach sieben moralgewendeten Kohl-Jahren, nach Pershing-Stationierung, Reagan, dem SDI-Aufrüstungsprogramm und Gorbatschows Glasnost-Experimenten entstand plötzlich etwas Neues, etwas Unvorhergesehenes.
Wie damit umgehen? Im Grunde wurde die westdeutsche Restlinke durch die Ereignisse durcheinandergewirbelt, ohne dass sie wußte, wie ihr geschah. Rückblickend markiert 1989/90 das Ende der alten Grünen Partei. Jutta Ditfurth, Thomas Ebermann und ihre linken Wegbegleiter sagten der Partei endgültig Adios. Salopp gesprochen war der ökosozialistische Waldmeister-Kirsche-Drops gelutscht. 1990 war das große Jahr der Neusortierung. Highlight: die beiden Nie-wieder-Deutschland-Demos – getragen von einem Spektrum, dass von den Autonomen bis zu (eher vereinzelten) Grünen reichte und mit seiner Losung programmatischen Bezug nahm auf ein Zitat von Marlene Dietrich. Virulent wurden die schlimmsten Befürchtungen, als sich tatsächlich Ansätze eines neuen völkischen Furors formierten. Ohne größere Unterbrechungen glitt die Phase der Wiedervereinigung über in die rassistischen Ausschreitungen, Anschläge und Mordbrennereien der frühen und mittleren Neunziger. Für die verbliebenen Linken bedeutete die unerwartet heftige völkische Mobilisierung eine Art Dauer-Ausnahmezustand: Hoyerswerda, Rostock; hinzukommend die flächendeckenden Areale ostdeutscher Neonazis – dies bestimmte zum großen Teil auch den Blick auf den neuen deutschen Osten des Landes. Aus Sicht westdeutscher Linksradikaler hatte »das Volk« in der DDR sich nicht nur an den kapitalistischen Drachen rangeschmissen. Zusätzlich vollzog es auch den klammheimlichen bis offenen Schulterschluss mit dem allerschlimmsten Feind – den Faschisten in Form der neonazistischen Banden in den ostdeutschen Dörfern, Klein- und Großstädten.
Nicht alle gingen den Weg, der später zu den Antideutschen führte. Kleingeschichtlich waren die Jahre 1990 ff. ein Riesen-Laboratorium in Sachen politisch-sozialer Experimente. Die Öffnung der Mauer tangierte nicht nur die große Politik und den großen Staat, sondern auch die kleinen Linken in Garmisch-Patenkirchen und Gera. Westliche WGs bekamen den ein oder anderen Ost-Zuwachs, in der wiedervereinigten Hauptstadt und den östlichen Bundesländern (vor allem den großen Städten) brachen Freiräume auf. Baufällige Häuser wurden besetzt, Jugendzentren entstanden, Antifa-Läden sowie neue politische Strömungen. Auch lebensgeschichtlich-sozial war plötzlich einiges offen. Ebenso politisch: Sollte die DDR ein eigenständiges Gebilde bleiben – vielleicht mit einer kapitalistisch-sozialistischen Mischwirtschaft, wie es Teile der Bürgerbewegten und SED-Reformer wollten? Falls Anschluss: Wie sollte er vonstatten gehen? Zusammenschluß? Beitritt? Bekanntlich wurden die Weichen durch die D-Mark gestellt. Flankiert durch neuerliche Montagsdemonstrationen und eine neue Losung. Nicht mehr: »Wir sind das Volk!« Sondern: »Wir sind ein Volk!«
Für die Westlinke (beziehungsweise ihren nicht in die SPD eingebundenen Teil) war die 1990er-Zeitenwende sicher ein Bruch. Andererseits aber auch ein Sowohl-als-Auch, eine galoppierend-verwirrende Mischung aus Geben und Nehmen, Ups und Downs. Einerseits war das Pickelhauben-Großdeutschland unübersehbar in den Bereich des Möglichen gerückt. Andererseits aber auch die einzig verbliebene Arbeiterpartei mit Massenanhang. So mischten sich in den Kater trotzige, kämpferische Töne. Stimmung: Wenn ihr im Osten einmarschiert, holen wir uns die Verstärkung in den Westen! Gregor Gysi avancierte zum Shooting-Star der neuen PDS – einer linkssozialistischen Partei, die Stück für Stück den Eierschalen der alten SED entglitt. Für noch Linkere beziehungsweise die marxistisch orientierten Strömungen gab es die eloquente Sarah Wagenknecht und ihre Kommunistische Plattform. Lapidares Fazit: Auf die Rest-Linke der alten BRD wirkte die PDS wie ein riesiger Magnet, ein Staubsauger. Mit der Folge, dass sich auch das grüne Spektrum substanziell umsortierte. Wer grün war und systemoppositionell, fand seine politische Heimat nunmehr nicht mehr in der rasch verbürgerlichenden Ökopartei. Sondern bei den – mehr oder auch etwas weniger geläuterten – Erben von Erich und Margot Honecker.
Die ersten 25 Jahre
Sicher waren die Post-Wiedervereinigungsjahre auch im linken Milieu nicht ausschließlich von Katzenjammer, Nie-wieder-Deutschland-Parolen sowie einhelligem Springen auf einen neuen geeigneten Massentransformator geprägt. Wie bereits angedeutet, fungierte die Einheit ebenso als großes soziales Laboratorium. West-Linke und Ökos zogen in den Osten, Ost-Linke in die großen Städte. Vor allem Berlin hat von der neuen Einheit auf geradezu unvergleichliche Weise profitiert. Erst nach 1990 entwickelte sich die Hauptstadt zu jenem Melting Pot, der er heute ist: eine dynamische Metropole, die einerseits dem Vergleich mit Paris, Moskau und London mühelos standhält, sich andererseits jedoch ihr widerborstiges Links-Sein bewahrt hat. Selbst die Regierenden der Hauptstadt wissen bis heute, wann es besser ist, den Ball flachzuhalten. Aktuelles Beispiel: der Volksentscheid für den Erhalt des Tempelhofer Felds. Sicher bietet Berlin auch die andere Seite – Filz, Bankenskandale, neoliberales Sozialdumping sowie seinen berüchtigten Endlos-Flughafen. Im Großen und Ganzen jedoch hat sich die Stadt ihren urbanen, tendenziell linken Charakter bewahrt. Fazit, da können süddeutsche CDU-Provinzfürsten lange abkotzen: Ihr habt die DDR eingesackt, wir dagegen die Hauptstadt.
Was wurde aus Zonen-Gaby? Das Titanic-Titelbild mit Gaby und der Gurke machte republikweit die Runde. Die Darstellerin? Zumindest eigenen Angaben zufolge eher ahnungslose Statistin denn bewußt handelnde Akteuse. Das Satiremagazin selbst ist zwischenzeitlich auch im Osten präsent – ebenso wie Bananen, Discounter von Lidl, Das Neue Blatt oder das World Wide Web. Politisch und sozial stehen die Zeichen auf Konsolidierung – allerdings auf unterschiedlichen Niveaus. Auch mental kommen sich Ossis und Wessis nur zögerlich näher. Die Buchtitel, welche sich den zwischendeutschen Befindlichkeiten widmen, dürften mittlerweile in die Hunderte gehen – konservativ geschätzt. Ranking der Vorurteile, Platz eins: Ossis heißen häufig Mandy, Cindy, Sandy, Enrico und Maik. Platz zwei: Wessis sind Besserverdiener. Womit news aktuell zumindest bei Punkt zwei nicht ganz daneben liegt.
Besserwessis versus Jammerossis: Mit der heterogenen Wirklichkeit im Land haben die gernverbreiteten Stereotypen wenig zu tun. So manche Ostlerin steht im Leben gestanden ihre Frau, so mancher Westler kriegt nichts, aber auch gar nichts gebacken. Die ritualhaft vollzogenen Novembergedenken verdecken, dass der Osten im Gesamtgefüge der Republik weitgehend in die zweite Reihe verwiesen wurde. Sicher – Merkel und Gauck kommen aus dem Osten. Geht es allerdings ans Eingemachte, fallen Politelite und souflierende Leitmedien in schlimmsten Fünfzigerjahre-Propagandafunk zurück. Motto: Der Rechtsstaat ist ein Rechtsstaat, weil die Rechte regiert. Sonst wäre er ja ein Linksstaat – und somit ein »Unrechtsstaat«. Die bundespräsidentbeförderte Feindbildmalerei in Sachen Linkspartei zerdeppert nicht nur weiteres Demokratie-Porzellan. Ziemlich ungeschminkt und brutal-neoliberal weist sie der ostdeutschen Bevölkerung ihren Platz zu. Die Message: Individuell mag man ausbrechen, aufsteigen können. Kollektiv bleibt dieser Weg verwehrt. Darüber hinaus legt sich die inquisitionshaft geführte Linkspartei-Debatte als schrille Dauerdissonanz unter die angestimmten Festtöne. Die friedliche Revolution, die Bürgerrechtler und der Fall der Mauer – letzten Endes sind sie doch nichts weiter als Staffage für einen Staat, der sich zunehmend elitärer, bürgerferner und postdemokratischer gebärdet.
Auch die Linken haben zwischenzeitlich ihre Lektionen gelernt. Die imperiale Dynamik des wiedervereinten Deutschlands erwies sich auch hier als wesentlicher Taktgeber. Die Grünen wandelten sich in weniger als einem Jahrzehnt zu einer biedermeierlich-neubürgerlichen Systempartei – Kriegseinsätze inklusive. Höhepunkt war sicher die grüne Zustimmung zu den Agenda-2010-Gesetzen – ein Eingriff, der Deutschland ähnlich nachhaltig umgemodelt hat wie der Fall der Mauer fünfzehn Jahre zuvor. Die SPD hat es im Zug ihrer Umwandlung in eine marktfreundliche Partei der Marke Tony Blair komplett zerlegt. Von den Wählern auf knapp die Hälfte einstiger Stärke zurückgestutzt, fungiert sie im Wesentlichen als Steigbügelhalter der Konservativen. Die einzig verbliebene sozialdemokratische Partei schliesslich hat aufgrund der Verwerfungen in Ost und West zwar an Stärke gewonnen. Aufgrund ihrer systemisch betriebenen Ausgrenzung verharrt sie jedoch weiterhin in der politischen Diaspora.
Was wurde aus denen, die die Dinge schon immer klarer gesehen haben? Sie sind – nach einer Zwischenstation bei politischer Abstraktion und Wertkritik – ungefähr da, wo die Grünen vor 25 Jahren standen. War die politische Kritik zu Zeiten der Jugoslawienkriege noch punktgenau, treffend und prägnant, orientierte sich das antideutsche Spektrum nach dem 11. September 2001 zunehmend an der Außenpolitik der USA – für die Zivilisation, gegen den islamischen Faschismus. Auch wenn die innerlinken Pirouetten an der Stelle nicht einzeln nachverfolgt werden können, bleibt ein Fazit ganz sicher: Die aktuellen linken Quer-Aufstellungen in Sachen Ukraine-Krise – hier antideutsche und grüne Putin-Basher, da Antiimperialisten mit Hang zu regressiv bis rechtspopulistischer Vereinfachung – haben sehr viel zu tun mit jener deutschen Entwicklung, die am 9. November 1989 in Gang gesetzt wurde.
Quo vadis?
Geschichte wiederholt sich nicht – und falls doch, dann als Farce. Sollte die Nichtwiederholen-Regel Gültigkeit besitzen, stolpert man derzeit über ganz schön viele Farcen, Flashbacks und Deja-vus. Den Ex-Kommunisten Biermann beispielsweise als klampfenden Staatskünstler anlässlich der Mauer-Feierstunde im Deutschen Bundestag. Oder die frommprotestantisch unterlegte Aufrüstungs- und Antilinke-Retorik von Joachim Gauck – bereits von der Physionomie her eine Zeitreise in die Achtziger. Hin zu Ronald Reagan, der einmal scherzhaft zu Protokoll gab, dass er in fünf Minuten die Sowjetunion pulverisiert. Man kann sich allerdings auch auf die Feiern kaprizieren – konkret: das nationale Wohlgefühl, den nationalen Zusammenhalt und das nationale Selbstverständnis, dass sie befördern sollen. Wie auch immer: Wer die derzeitigen Festlichkeiten zum Mauerfall betrachtet und sie mit der aktuellen Realität abgleicht, fühlt sich unwillkürlich an ein anderes, seinerzeit ähnlich überhöhtes Ereignis erinnert – das sogenannte Augusterlebnis 1914. Jenen Monat also, in dessen Verlauf der Kaiser keine Parteien mehr kennen wollte, sondern nur noch Deutsche. Zwei Jahre später – in den Schützengräben an der Somme und vor Verdun – hatte sich das Pathos bekanntlich aufgebraucht. Weitere zwei Jahre später sahen selbst die genügsamen Deutschen keinen anderen Ausweg mehr als den der bewaffneten Revolte, der Revolution.
Vorerst leben wir in friedlicheren Zeiten – zumindest hierzulande, im wiedervereinigten Deutschland. Nur die Menschen. Ob Ost (weniger) oder West (mehr): Sie wirken perfektionistisch. Gestresst, mürrisch und irgendwie freudlos. Ist das das Ergebnis: die speziell deutsche Melange aus amerikanischem Keep It Cool, liberalem Marktradikalismus, sozialdemokratischem Staatsbürokratismus und konservativem Deutschnationalismus? Wir wissen es nicht, wir sind in unserer Zeit gefangen. Eines scheint jedoch sicher: Nachhaltige Lösungen, für den Stress, das Wohlstandsgefälle und das Miteinander-Zusammenleben allgemein – die werden Ost- und Westdeutsche wohl zusammen finden müssen.
SOUNDTRACK:
David Bowie – Heroes (1975)
Silly – Verlorene Kinder (1989)
Udo Lindenberg – Sonderzug nach Pankow (1983)
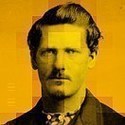




Was ist Ihre Meinung?
Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.