Schneller, harter Sex in der Eingangsszene. Schmuddelwetter, Trabantenstadt, gelb-blau-giftiggrüne Neo-Noir-Farben. Zu seinem aktuellen Fall kommt Kommissar Grimmer (Felix Kramer) wie die sprichwörtliche Jungfrau zum Kind. Vor zehn Minuten, nach dem Sex, gab es Mißstimmungen mit der Zweitfrau. Mit deren Baby im Arm spaziert er nun durchs nächtliche Marzahner Plattenbauambiente. Und übernimmt – nicht ganz zufällig, wie wir schnell erfahren – die Tatortregie in einem frischen Mordfall. Der Tote: ein Türke und, was schwerer wiegt, Starkicker der deutschen Mannschaft im für den kommenden Tag angesetzten Länderspiel Deutschland–Türkei. Was in einem normalen »Tatort« der Auftakt für einen Whodunnit-Krimi der Zielgruppenrichtung »mal was fürs Publikum unter 60« wäre, ist hier lediglich der Auftakt zu verschärften Formen des Existenzkampfs: Der von seiner Spielsucht wie von seinen Gläubigern geplagte Ermittler entfaltet nämlich nur wenig Aufklärungsaktivitäten. Vielmehr versucht er aus dem Stand, Geld zusammenzukratzen für eine waghalsige Sportwette und manipuliert zu diesem Zweck Tatort und Infofluss. Kann das gut gehen? Wir erfahren bereits bei der Einblende: nicht wirklich. Schlechtes führt zu Schlechtem. Hier: zu Krieg in den Straßen – sieben Tage später.
Krieg in den Straßen, echte Gangsta, libanesische Clans, Sportwetten-Mafia; die Kiez-Welt vom Prekären-Wohnsilo bis zu Charlottenburger Kreuz und Olympiastadion – die Ecke Berlins, wo Halbwelt, Unterwelt und Offizialwelt schon immer prominent aufeinandertrafen. Das Problem von »Dogs of Berlin« ist, dass die Serie von Beginn an zu dick aufträgt, stets einen Tick zu laut ist, zu sehr Berlinerisch nuschelt und zu sehr bemüht, die Dichte der einschlägigen Genre-Wiedererkenn-Treffer auf keinen Fall zu verringern. Dass Späne da fallen, wo gehobelt wird, ließ bereits die Vita des ausführenden Regisseurs Christian Alvart vermuten. Seine Meriten verdient hat sich Alvart mit den Till Schweiger-Tatorten – Produktionen also, die ähnlich adrenalingeschwängert daherkamen wie nunmehr »Dogs of Berlin«. Schweigers Tatort-Kompagnon Fahri Yardım gibt auch hier den Good Cop. Insgesamt kann man Netflix kaum vorwerfen, bei dieser Eigenproduktion an guten Schauspielern gespart zu haben. Aufzuführen sind hier vor allem zwei weibliche Hauptrollen: Anna Maria Mühe als Sabine, die zerrissene, sich bei einer Sex-Hotline das Hartz-Zubrot verdienende Gelegenheitsfreundin von Grimmer und Katharina Schüttler als dessen offizielle, lieber in Boutique und kleinbürgerlichen Lebensentwurf machende Lebenspartnerin Paula.
Hohe Klischee-Dichte
Die einschlägige Klischee-Dichte dieser Serie mag hoch sein; ebenso die unabkömmlichen Dicke-Eier-Sprüche, die bei härteren Produktionen des Genres mittlerweile internationaler Eichstandard sind. Referenz von »Dogs of Berlin« und Konkurrenz gleichermaßen ist erkennbar »4 Blocks« – wobei die dazugehörige Hip Hop-Musik hier in Form eines Sidekicks für den Rapper Haftbefehl in die Handlung mit integriert ist. Während der von Sky auf den Weg gebrachte Vorläufer im Großen und Ganzen Erwartbares bietet (und in der Beziehung weder große Ausreißer nach unten noch hin in den Spitzenbereich hat), versucht »Dogs of Berlin«, die Zuschauer mit – zum Teil exzellent geratenen – Zweitrangigkeiten bei der Stange zu halten. Exzellent, ungewöhnlich, packend, unmittelbar, visuell – das wären in etwa die Begriffe für die Bildsprache, die Art und Weise der Inszenierung: ein Qualitätsmerkmal, das durchaus auch ohne Griff in den Postproduktions-Farbeimer funktioniert hätte. Das rohe, ungeschliffene, stinkende Berlin: In dieser Serie ist es als eigenständiger Act mit dabei – inklusive nuschelnder, slangender, rappender und auch aufnahmetechnisch machmal nicht sehr gut zu verstehender Protagonisten.
Lädiertes Aussehen, ratloser Blick – Fahri Yardım in der Netflix-Serie »Dogs of Berlin«
Was verführt doch dazu, »Dogs of Berlin« die – um im Bild zu bleiben – Tabledance-Stange zu halten? Die Handlung ist es sicher nicht. Es sind beileibe nicht nur die riesengroßen Logik-Löcher – wie zum Beispiel der Umstand, dass eine Fall-Manipulation, wie sie Dirty Cop Grimmer vornimmt, im echten Leben nicht den Hauch einer Chance hätte. Doch Logik-Löcher – manchmal ausgewachsen zu riesigen Logik-Kratern – sind speziell im deutschen Thriller-Metier ein Fact, mit dem man sich abfinden muß. In »Dogs of Berlin« allerdings kommt spätestens ab Folge 5 (von 10) jegliche Klarheit abhanden. Neue Ereignisse, Wendungen, Figuren finden sich fast im Viertelstundentakt ein. Zu viel, zu sehr, ausreichend für mindestens drei Spielfilmhandlungen. Vielleicht liegt es daran, dass die beiden Hauptprotagonisten Grimmer und Birkan (Yardım) ab etwa Serienmitte nur noch verpeilt, verwirrt und apathisch rüberkommen. Serielles Burnout: Während Birkan als Good Cop desorientiert durch diverse Handlungsstränge stolpert, kennt sein Sonderkommissions-Partner Grimmer als Dirty Cop nur noch einen Gemütszustand: Einsteckqualitäten.
Konstant am Rand des Limits sind auch die Gangster der Serie: ein Libanesen-Clan, Plattenbau-Neonazis wie aus dem Bilderbuch (und familiär mit Grimmer verbandelt) und schließlich eine Balkan-Mafia – deren Anführer von Ausnahmeschauspieler Mišel Matičević eine Differenziertheit verliehen bekommt, die in dieser Serie leider eine Ausnahmeerscheinung bleibt. War da noch ein Fall? Ein Mord, eine Ausgangskonstellation, die man zu einer guten, stringenten Geschichte hätte voranentwickeln können? Ja – irgendwie schon. Allerdings: Der »Fall« geht nicht nur den beiden – mittlerweile zu Sonderkommissions-Leitern avancierten – Hauptfiguren ziemlich am Hinterteil vorbei. Auch bei den Scriptschreibern, Showrunnern, Regisseuren und Productionern dieser Serie schien der handlungstragende Plot nicht gerade die allerhöchste Priorität gehabt zu haben. Entsprechend lustlos eingestreut sind die Sitzungen der Sonderkommission – wo statt aufgeklärt lieber gesimst wird, was das Zeug hält. Schließlich ist immer irgendwo anders eine besonders heiße Sache an Laufen; da muß die Fallaufklärung notgedrungen eine Pause einlegen.
Außerhalb ihrer sozialen Rollen – als Dirty Cop mit Schulden, als schwuler Cop mit türkischem Migrationshintergrund, als Gangsterboss, jüngerer Bruder vom Gangsterboss, als Sozialhilfempfängerin oder auch als Neonazi-Familienanhang des ermittelnden Kommissars – bleiben die Beteiligten blass, klischeehaft; Entwicklungen (oder auch nur: wirkliche Motive) scheinen in »Dogs of Berlin« nicht vorgesehen. Sicher entschädigt die Serie für die nicht wirklich stattfindende, in besseren Momenten an Filme von David Lynch erinnernde Handlung – durch Action, durch Bilder; irgendwo auch durch die Stimmung und das »migrantische« Lebensgefühl, dass die Serie transportiert. Man muß es eben mögen. Der große Durchbruch nach oben – im unter Hype-Dauerbeschuss stehenden deutschen Serienhimmel – ist »Dogs of Berlin« ebensowenig wie seine Genre-Vorgänger »4 Blocks« oder »Babylon Berlin«. Ein Faktor, der sicherlich viel mit dem deutschen Produktionsstandort zu tun hat und damit, dass Serien »mit Aussage« von den Verantwortlichen zeitig liquidiert wurden – wie 2009 die ZDF-Serie »KDD« und 2010 ihr ARD-Pendant »Im Angesicht des Verbrechens«.
Fehlender Mut zur Geschichte
Positiv formuliert könnte man das Fazit folgendermaßen ziehen: Eine Actionserie – sogar überdurchschnittlich geraten und mit Elementen, die über das Genre hinausweisen. Allerdings: Angesichts der Asse im Ärmel, die diese Serie weggeschmissen hat, als gälten sie nichts, sollte man schon ein inhaltlich fundierteres Resummée ziehen. Fazit eins so: Was herausragende Anspruchsstoffe der Sorte made in USA, Skandinavien oder auch Frankreich anbelangt, ist die deutsche Serie klinisch tot – auch mangels geeigneter Finanzeure. Die Dauervergleiche, mit denen stattdessen versucht wird, Mittelprächtiges zu Grandiosem hochzuhypen, nerven nur noch – zumal auch weitere Aspiranten der letzten Jahre lediglich Mittelmaß geliefert haben. Deutschland ist nicht das Land der »Sopranos«. Der Umstand ist leider der, dass die deutschen Filmschaffenden (mit ihrem speziellen Konglomerat aus staatlich mitfinanzierter Filmförderung und risikoscheuen Öffentlich-Rechtlichen) lediglich die äußere Hülle des Mediums Qualitätsserie übernommen haben, nicht aber den eigentlichen Inhalt. Dies ist der wesensbildende Grund dafür, dass aus Skandinavien, den USA und Frankreich – noch immer – gut erzählte Geschichten im Serienformat kommen, aus Deutschland jedoch nicht.
Fehlender Mut zur Geschichte, zur Aussage – dazu, INHALTLICH einen Punkt zu setzen: Das scheint mir der Hauptpunkt zu sein, warum Serien »made in Germany« manchmal unterhalten, aber nie wirklich richtig packend sind. »Dogs of Berlin« hätte gute Chancen gehabt, das Muster zu brechen – ein guter (Ausgangs-)Plot, gute Schauspieler, fähige Leute im Stuff für das In-Szene setzen, also die Optik. Die Ironie dabei ist, dass trotz aller flapsigen Sprüche, trotz aufgesetzter Härte und Szene-Sprech letztlich eine bieder-angepasste Mainstream-Produktion dabei herausgekommen ist. Möglich, dass Netflix damit einen Markt konsolidiert, der (noch) nicht zum Kernpublikum der Streaming-Networks gehört: Hip Hop ist ein Markensegment mit einer millionenstarken Anhängerschaft. Schade beim konkreten Versuch ist, dass die Tragik, die mögliche Geschichte, die der Plot enthielt, dabei badengegangen ist.
Einfacher gesagt: Die Serienmacher und ihre Finanziers haben sich – wieder mal – am kleinsten gemeinsamen Nenner orientiert. So werden bestehende Zustände perpetuiert. Die da sind: Für die einfachen, eingängigen, in den besten Fällen aufrüttelnden Stoffe sind die Amis zuständig, für erzählte Geschichten die Skandinavier und für das gewisse savoir vivre die Franzosen. Die Deutschen haben es dafür technisch drauf – beste Szene; demnächst (das heißt: wenn es in diesem Land veritable Singer-Songwriter gäbe) möglicherweise sogar mit Soundtracks auf Weltniveau.
Dass ausgerechnet Migranten – also jene, die im Wirtschaftswunderland Germany mit am wenigsten zu lachen haben – die Hauptfiguren spielen in diesen perfekt inszenierten, inhaltlich jedoch harmlos-belanglos und aussagearm bleibenden Bilderwelten, ist die beste Pointe obendrauf.
WEITERE KRITIKEN:
Noch nicht mitbekommen? Die Achtziger sind vorbei! Oliver Kaever, Spiegel Online, 7. Dezember 2018
Und am Ende brennt Berlin. Kathrin Hollmer, Süddeutsche Zeitung, 7. Dezember 2018
Die Gangster-Clans rufen „Habibi“, die Nazis „Heil“. Holger Kreitling, Welt, 9. Dezember 2018
Unauthentisch und deshalb gut. Doris Akrap, taz, 9. November 2018

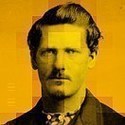




Was ist Ihre Meinung?
Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.