Das Gute an Lockdown & Corona-Pandemie: An Zeit zum Lesen mangelt es derzeit eher weniger. Da Winter, Umstände sowie tagesaktuelle Zeitereignisse sowieso die großen Sinnfragen nahelegen: Warum sich nicht die Theoriebrocken vornehmen, die im Bücherregal vor sich hinstauben? Oder – vielleicht noch besser – eine entsprechende Neuerscheinung in Angriff nehmen? Grundsatzfragen nach dem Motto »Was läuft in unseren Gesellschaften schief, wer trägt daran Schuld und wie kann man Abhilfe schaffen?« haben zwar spätestens seit der Finanzkrise 2008/2009 eine wahre Flut einschlägiger Buchtitel zur Folge gehabt. Im Bereich politischer Konzepte allerdings haben sich diese bislang mehr in Form bruchstückhafter Detail-Puzzlestücke niedergeschlagen denn als programmatischer Monolith.
Frage: Was wollen »wir« überhaupt – als Normalbürger(innen), politisch Interessierte oder auch als dezidierte Linke: Klimaverbesserung pur, einen praxistauglichen Green New Deal, Identitätspolitik oder doch eher Konzentration auf die bislang ungelöste soziale Frage? Der multiple, in Bezug auf übergreifende Zielvorstellungen eher vage-ratlos erscheinende Ist-Zustand linker Praxiskonzepte ist auch in Wir Untoten des Kapitals von Raul Zelik ein Ausgangspunkt, um den ernsthafte Autor(inn)en zum Thema kaum herumkommen. Als Erklärer hat der 1968 in München geborene und seit 2012 in der Linkspartei engagierte Schriftsteller, Journalist und Politikwissenschaftler zumindest einen nicht zu unterschätzenden Vorteil: die kontinuierliche Teilnahme an sozialen Bewegungen. Speziell über die Verhältnisse in Lateinamerika sowie Spanien hat er kontinuierlich berichtet – unter anderem im ND, der taz und der junge welt. Freitag-Leser(innen) dürfte er ebenfalls nicht ganz unbekannt sein: unter anderem aufgrund seiner Beiträge rund um das Katalanische Unabhängigkeitsreferendum 2017 (siehe unter anderem: hier).
Die Grundfrage, wie eine linke Zukunftsvision aussehen könnte, impliziert zunächst eine schonungslose Bestandsaufnahme der Gegenwart. Das erste Kapitel (Zombification!) widmet sich – nach einem Vorwort, welches die durch COVID-19 entstandene Lage im Frühjahr mit einbezieht – den politischen Monstern der Gegenwart. Schnelle, narrativ vollzogene Parallelen zwischen den Popkultur-Zombies à la The Walking Dead sowie Game of Thrones und den Epochenumbrüchen innerhalb der liberalen Gesellschaften unterfüttern die universalistische, eher übergreifende als fachspezielle Sichtweise des Autors – frei nach der Devise: Alles hängt mit allem zusammen. In der kapitalistischen Gesellschaft ist es, soweit wenig Überraschung, der Markt, der keine Perspektive mehr bieten kann. Andererseits – so die andere, ebenfalls leidlich bekannte Seite der Medaille – fällt es auch linken Kräften schwer, eine allumfassende Antwort auf die Krise zu finden.
Kapitalismus = unverwüstlich? Das zweite und dritte Kapitel steigen tiefer in die Materie ein. In Kapitel 2 arbeitet sich Zelik an den aktuellen linkspolitischen Programmatiken ab. Da ist zum einen der Green New Deal – ein Konzept, dass nicht umsonst an den US-amerikanischen New Deal der Dreißiger Jahre erinnert sowie die damit verbundenen Nachfrage-Stimulanzmittel aus der Schatulle des Ökonomen John Maynard Keynes. Wie ist der aktuelle Diskussionsstand bezüglich der Grundsatzfrage »Planung versus Markt«? Wie können die neuen Teilhabeansprüche einbezogen werden, wie sie etwa der Feminismus formuliert? Und: Reicht es aus, die Gesellschaft lediglich auf »Grün« zu schalten, und alles wird gut? Insbesondere mit den Nachhaltigkeitskonzepten aus grünökologischer Ecke geht Zelik kritisch ins Gericht. Stichwort Dekarbonisierung: Unter kapitalistischen Vorzeichen bewirkt die angepriesene Digitalisierung – respektive deren materieller Unterbau – nicht etwa einen Stoffwechsel hin zu weniger CO2-Verbrauch, sondern vielmehr eine Fortsetzung des Raubbaus an Mensch und Natur auf neuer, in den Formen allerdings verblüffend gleicher Ebene.
Auf ähnlich narrative Weise arbeitet Raul Zelik die bisher ausprobierten linken Rezepturen ab. Im Mittelpunkt des dritten Kapitels stehen die Plan-Konzepte der realsozialistischen Modelle Sowjetunion, China und Jugoslawien – respektive die Frage, wieso diese letztendlich (wenn auch auf jeweils unterschiedliche Weise) zum Scheitern führen mußten. No Future? Das vierte Kapitel beleuchtet noch stärker die Detailparameter, welche bei den Veränderungen der letzten 200 Jahre zum Tragen kamen: Marktkonzepte, das sozialistische Planwirtschafts-Pendant, bürgerlicher Liberalismus, Rätedemokratie und lokales Wirtschaften und schließlich, als integriertes Konzept, der Chavismo Marke Venezuela nebst linkspopulistischen Anverwandten.
Das fünfte Kapitel widmet sich schließlich den notwendigen Bedingungen für eine sozialistische Transformation. Den beiden Grundstrategien Revolution und Reform stellt Zelik hier das der Transformation entgegen. Speziell diesen Gedankengängen ist die Anlehnung an Gramscis Theorien des Machtaufbaus (anstelle schematischer Machteroberung) stark anzumerken. Seine Darstellweise – insbesondere die narrative Form der Abhandlung – erinnern dabei zwar stark an die eines anderen »klassisch linken« Tabubrechers: Slavoj Žižek. Der Unterschied: Während Žižek sich in seiner Rolle als altlinker Provokateur neulinker Harmoniesüchte offensichtlich gefällt (siehe aktuell auch den Jacobin-Beitrag »Wir brauchen keinen sanftmütigen Kapitalismus, sondern einen sozialistischen Neustart«), geht Zelik eher geduldig erläuternd und nach »vorne blickend« vor. Wie seine Konzepte einordnen? Naheliegenderweise bezieht er sich zwar stark auf Konzepte und Ideen aktueller Theoretiker(innen) wie etwa Paul Mason, Thomas Piketty oder Naomi Klein. »Klassisch links« indess ist, dass seine Thesen nicht verkappt auf eine »grüne« Programmatik hinführen (respektive die Klimafrage zum Dreh- und Angelpunkt machen), sondern vielmehr eine Rundum-Erörterung der Frage sind, wie die politische Linke wieder in die Offensive gelangen und ergo handlungsfähig werden könnte.
Übertragen auf das 21. Jahrhundert ist es sicherlich nicht ganz falsch, Zelik in der Klassikerreihe Luxemburg – Kautsky – Bernstein als dem Kautsky’schen Zentrum als am zugehörigsten einzuordnen. Was nicht das Schlechteste ist – bezieht man das historische Scheitern sowohl von Mehrheits-SPD-Führung als auch Luxemburgs Ansatz mit ein. Zentrales Konzept – das also, was nach dem Lesen übrig bleibt – dürfte das der Transition sein, dem Aufbau möglichst vielfältiger (also auch »diverser«) gesellschaftlicher Gegenmacht gegen die Kräfte des Kapitals. Dass mittlerweile durchaus neue, vorzugsweise auf den Bereich der Miet- und Arbeitskämpfe abzielende Konzepte vorhanden sind, stellen Kurzexkurse zu Konzepten wie dem aus den USA kommendem Deep Organizing unter Beweis. Fazit also auch hier: ein beachtlicher Erfahrungsschatz ist durchaus vorhanden; veränderungswillige zivilgesellschaftliche Kräfte müssen keinesfalls bei Null beginnen.
Inhaltlich-formal ähnelt Raul Zeliks Wir Untoten des Kapitals eher einem längeren Strategietext aus dem Umfeld der Rosa-Luxemburg-Stiftung als einem theoretisch hochambitionierten, abstrakten Philosophiewerk. Im Ergebnis ist Zeliks Buch eine flüssig geschriebene und so auch breitenlesbare Abhandlung zur Zukunft linker Politik. Empfehlung: Für alle, die nach sozialistischen Alternativen suchen respektive diejenigen, die wissen wollen, in welche Richtung es möglicherweise Alternativen zu TINA-Prinzip und Rechtspopulismus gibt.
Raul Zelik: Wir Untoten des Kapitals. Über politische Monster und einen grünen Sozialismus. edition suhrkamp, Berlin, Juni 2020. 338 Seiten, 18 Euro. ISBN 978-3-518-12746-9.
Zwei anstatt einer: siehe auch Freitag-Rezension »Sozialismus – aber grün« von Guido Speckmann vom August 2020

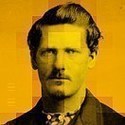




Was ist Ihre Meinung?
Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.