Für Länder des globalen Südens war 1966 zumindest in kultureller Hinsicht ein bedeutsames Jahr. In jenem Jahr lancierte eine brasilianische Formation mit dem Namen Sérgio Mendes & Brazil ’66 einen veritablen, bis heute fleißig nachgecoverten Welthit: Mas que nada. Sicher war die in brasilianischem Portugiesisch dargebotene Ode an die Leichtigkeit der Dinge nicht der erste »Ethno«-Titel, welcher in die Gefilde der angloamerikanisch dominierten internationalen Popmusik einbrach. Ältere und/oder kulturbeflissene Leser(innen) werden sich – vermutlich noch stärker – an The Girl from Ipanema erinnern: jenen Welthit, der im Grunde am Beginn dessen steht, was wir heute als Ethno- oder World Music bezeichnen. Bedeutsam war der Erfolg von Méndes & Co. in mehrererlei Hinsicht. Zum einen richtete er die Aufmerksamkeit auf eine eher breitenpopuläre, in großstädischen Innen- und Vorstadtquartieren verankerte Spielweise des Bossa Nova. Anders gesagt: Im Unterschied zu der Clique um João und Astrud Gilberto, Antônio Carlos Jobim sowie die Nachwuchschanteuse Elis Regina fokussierte der Bossa-Stil von Méndez & Co. weniger auf die amerikanisierte Wohlstands- und Jet-Set-Blase rund um die exklusive Copacabana, sondern auf die breite Bevölkerung. Die neue Musik – so der Anspruch – sollte populär sein, ja mehr noch: die brasilianische Popularmusik erneuern, modernisieren.
Dass die Erfolge – zumindest zunächst – eher mittelprächtig ausfielen, hatte mit äußeren Gegebenheiten zu tun. Seit 1964 war Brasilien eine stramme Militärdiktatur. Folgerichtig waren sowohl den intellektuellen Singer/Songwritern von der Copacabana als auch anderen Musikschaffenden der Musica Populeira enge Grenzen gesetzt. Einige blieben im Land und versuchten, so gut es ging die Zensur zu umschiffen. Viele indess gingen ins Ausland, vorwiegend die USA – darunter auch João und Astrud Gilberto. Das Ziel USA lag auch aus kommerziellen Gründe nahe. Wesentliche Wegbereiter der Bossa-Nova-Welle waren US-amerikanische Jazz-Musiker wie zum Beispiel der Saxophonist Stan Getz. Darüber hinaus hatte der Flirt amerikanischer Unterhaltungs- und Jazzmusiker mit südlichen Sounds und Rythmen bereits seit den Vierzigern zunehmend an Fahrt aufgenommen. Ein weiterer Latin-Welterfolg, der zum Bestandteil des Great American Songbook avancierte, war Bésame mucho – eine romantische Ballade, die von der mexikanischen Komponistin Consuelo Velásquez komponiert wurden war und 1941 erstmals auf Schallplatte gepresst wurde. Ob Mambo und Bolero oder Salsa und Son: In den Nachkriegsjahrzehnten jagten sich förmlich die Modewellen, in denen US-amerikanische Crooner auf lateinamerikanisches Musikgut zurückgriffen. Mit einem zünftigen Mambo Italiano reussierte seinerzeit auch Rosemary Clooney, eine bekannte Jazz-Atrice und Tante eines auch heute noch vielbeschäftigten Schauspielers.
Die politische Linke hatte ihre eigene Haltung zur popmusikalischen Gesamtentwicklung. Einerseits pflegte sie den fundamental-kritischen Abstand – entweder aufgrund stalinistischer Dogmatik (Walter Ulbricht im Dezember 1965: »Ich bin der Meinung, Genossen, mit der Monotonie des ›yeah, yeah, yeah‹ und wie das alles heißt, sollte man doch Schluss machen«) oder aber aus linksbildungsbürgerlichen Vorbehalten heraus. Im Verlauf der Sechziger geriet die alte, von Busch, Hootenanny und Schönberg durchdeklinierte Geschmackswelt allerdings in einen Zangenangriff aus kapitalistischem Pop und zeitgemäßem Agitprop. Die Neue Linke frönte ausgiebig den angesagten Acts der neuen Counterculture, und auch der traditionslinke Nachwuchs konnte respektive wollte den Verlockungen von Jimi Hendrix, Doors & Co. nicht in Gänze widerstehen. Im eigenen Lager stieß der Wind der Kämpfe ebenfalls neue internationalistische Tore auf. Beispiele: der griechische Komponist und Widerstandskämpfer Mikis Theodorakis, seine in jeder Hinsicht überdurchschnittliche Sängerin Maria Farantouri, die argentinische Sängerin und Aktivistin Mercedes Sosa, Astor Piazzolla als Star des neuen, anspruchsvollen Tango, die chilenische Gruppe Inti-Ilimani und viele weitere. Lange Rede kurzer Sinn: Nicht nur die Popmusik wurde zunehmend internationaler, sondern auch das traditiotionslinke Liedgut.
Begriffstechnisch machten im Westen Stil-Sammelbezeichnungen wie »Ethno« und »World Music« die Runde. Der bildungsbeflissene Zugang zur Musik anderer (meist ärmerer) Länder zeitigte zwei scheinbar gegenläufige Trends. Zum einen wurden die Sounds des globalen Südens fleißig in die eigenen Konzepte und Sound-Mixturen integriert. Eine der wenigen, denen diese Form Ambition wirklich gelungen ist, sind die aus der Krautrock-Formation Embryo hervorgegangenen Dissidenten – hier mit dem Stück Telephone Arab. Der gegenläufige Zugang war der, möglichst nur die möglichst naturbelassenen Musikexponate fremder Kulturen als »authentisch« anzuerkennen. Egal wie zerkratzt und/oder soundtechnisch defizitiär die Originalaufnahmen waren – hier und nur hier war die Kraft unverfälschter Volksmusik zu erkennen. Die Einsicht, dass auch die Gesellschaften des Südens längst auf dem Weg waren, eigene Formen von Popmusik auf den Weg zu bringen, setzte sich erst ab den Achtzigern langsam durch. Schlagendes Beispiel für diese auch kommerziell neue Früchte tragende Entwicklung war der Erfolg eines weiteren brasilianischen Stils – diesmal nicht von der Copacabana, sondern aus dem armen Nordosten: Lambada.
Auch wenn es nicht sofort deutlich wurde: Mit der Lambada-Welle – ausgelöst durch den Single-Erfolg der Formation Kaoma – änderten sich die Koordinaten im Bereich Weltmusik grundlegend. Ska, Reggae sowie weitere Karibik-Stile waren bereits in den Siebzigern und Achtzigern weitgehend in die Rock- und Popmusik eingemeindet. Ein Projekt der eigenen Art brachten der US-Gitarrist Ry Cooder und der deutsche Regisseur Wim Wenders auf den Weg. Sie trommelten eine Reihe Altmeister der kubanischen Musik zusammen und nahmen mit ihnen ein Album auf: Buena Vista Social Club. Wenders komplettierte das Crossover-Projekt mit dem dazugehörigen Film. In den grünlinksalternativen Milieus kamen die Global Sounds in zwei Wellen an. Die erste – Mitte der Achtziger bis Mitte der Neunziger – wandte sich dem nordafrikanischen Raï zu. Mit Pop- und Rockeinflüssen bereits durchsetzt, bot dieser urbane Sound ein Setting, dass sich von dem europäischer Pop- und Rock-Konsumenten nicht allzu stark unterschied. Auch diese Form Rezeption hatte ihre Vorgänger sowie nahen Verwandten: einerseits das Interesse für die Lieder des griechischen Rembetiko, andererseits die Jemenite Songs der israelischen Sängerin Ofra Haza mit ihrem Erfolgsstück I'm nin alu. Im Raï kamen, wenn man so will, beide Komponenten zusammen: die Ursprünglichkeit und Authenzität des »griechischen Blues« und die kommerziell ambitiöse, in jeder Hinsicht »modern« klingende Handhabung des Songmaterials bei Haza.
Ein neues Moment des nordafrikanischen, besonders in Algerien (und in Frankreich) populären Raï war, dass er bereits von Haus aus Popmusik war – Schlager, moderne Unterhaltungsmusik und, in Ansätzen, sogar Transformator zeitaktueller Sozialkritik. Raï-Interpreten der ersten Stunde waren Chaba Fadela und ihr (damaliger) Lebenspartner und Kompagnon Cheb Sahraoui. Mit dem 1983 erschienen Titel N’sel Fik legten sie einen der erfolgreichsten Maghreb-Hits hin. Aufgrund zunehmenden Terrors islamistischer Fundamentalisten – ein Freund des Paares, der Regisseur Abdlkader Alloua wurde im März 1994 beim Verlassen seines Hauses in Oran ermordet – emigrierte das Duo 1995 schließlich nach Frankreich. Geschuldet nicht zuletzt der politisch zugespitzten Situation in ihrer Heimat, entwickelte sich Frankreich zunehmend zum neuen kulturellen Mittelpunkt des Raï. Nichtsdestotrotz rentiert es sich, sich dieser Musik nicht von der kommerziellen Superstar-Spitze heutiger Tage zu nähern, sondern von den Anfängen. Chaba Fadela & Cheb Sahraouis Fernseh-Einspielung ihres Erfolgstitels (Clip: oben) offeriert alles, was Raï-Musik ausmacht: die Liedkompositionen und ihre Melodik, dazu der charakteristische Mix aus Zouks, Trommeln und Tambourins mit Synthesizer-Sounds sowie sonstiger Elektrik.
Ein Grenzgänger zwischen Raï und Rock war der 2017 verstorbene Rachid Taha. Seine Interpretation von Ya Rayah, einem weiteren nordafrikanischen Erfolgsschlager, ist in mehrererlei Hinsicht bemerkenswert. Zum einen wegen des ambitiösen Musikclips, in dessen Mittelpunkt die Freuden sowie Mißgeschicke einer maghebinischen (oder immigrantischen; wer will das wissen?) Hochzeit stehen. Im Gegensatz zur Oppulenz, welche der Clip zu Tahas Song-Interpretation in Szene setzt, steht die traurige Geschichte des Song-Schöpfers, Damane El Harrachi. Für El Harrachi blieb sein 1973er-Erfolgssong eine Eintagsfliege. Pendelnd zwischen Algerien und Frankreich, starb er 1980 als weithin vergessener, von früherem Ruhm zehrender Caféhaus-Musikant in Paris. Integraler Bestandteil des französischen Popmusik-Business ist hingegen der Superstar des Raï: Cheb Khaled. Khaleds Allzeit-Hit ist wohl der Schmachtschlager Aicha – im Grunde ein »Must« für jede multikulturell ausgerichtete Ü50-Party. Wo wir gerade bei Frankreich sind: Zu erwähnen ist schließlich die subsaharisch-afrikanische Emigration, die in La Françe naturgemäß eine größere Rolle spielt als bei uns. Reinhör-Tipp hier: der kolonialismuskritische Reggaekünstler Tiken Jah Fakoly – hier mit Plus rien n m’étonnes. Eine Geschichte von Heimatlosigkeit, Bürgerkrieg und Migration hat schließlich auch die aus dem Kongo stammende und nunmehr in Belgien legende Sängerin Khadja Nin. Reinhör-Empfehlung hier: die Afrogospel-Ballade Sina mali, sina deni (Free).
Die Rezeption von World Music (um den euphemischen, im Westen jedoch bis heute gebräuchlichen Begriff an der Stelle weiter zu verwenden) veränderte sich noch einmal grundlegend mit der Implosion der vormals kommunistischen Systeme in Osteuropa. Zum einen tauchten auf den Straßen westeuropäischer Metropolen mehr und mehr Straßenmusikanten aus Osteuropa auf. Wie stets beförderte der Austausch im Kleinen den im Großen. Im Detail lassen sich drei deutlich voneinander unterscheidbare »Musikimporte« ausmachen. Der erste war der aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion sowie benachbarten RGW-Ländern. Besagte Straßenkapellen popularisierten alte WK-II-Hits wie beispielsweise Katjusha. In einer zweiten Welle folgten mehr oder weniger experimentelle Bands – inklusive des zu erwartenden Crossovers mit Rock, Punk sowie anderen Stilen. Beispiele an der Stelle: die russische Formation Gogol Bordello und die australische Combo Vulgargrad. Für die russischen Exil-Communities im Westen (zumindest deren älterer Teil) blieb weiterhin die alte Estrada – wobei mit der russischen Atrice Elena Vaenga eine Interpretin Erfolge feiert, der man zwar eine gewisse Nähe zum Regime in Russland nachsagen kann, die aber musikalisch auf der internationalen Höhe der Zeit agiert.
Die beiden anderen Richtungen waren Klezmer und die Musik der osteuropäischen Sinti und Roma. Klezmer hatte bereits in den Achtzigern eine gewisse Popularisierung erlebt. Eine Besonderheit dieses Stils war, dass seine Musiker(innen) tatsächlich über den ganzen Globus verstreut agierten. Wie bei allen Musikrichtungen teilte sich auch beim Klezmer das Segment in mehr traditionell orientierte Bands und solche, bei denen der Unterschied zu Rockkapellen eher temporärer Natur war. Eine Gruppe der letzten Richtung sind Golem! – eine New Yorker Formation, die seit 2001 besteht und die traditionelle osteuropäische Musik mit Punk-, Rock- und Ska-Elementen anreichert. Eine weitere Eigenheit hier: der fliegende Wechsel aus Jiddisch und englischer Sprache – oben zu hören und zu sehen in dem Stück Train Across Ukraine. Die Musik osteuropäischer Rom brachte schließlich Emir Kustoricas Film Ederlezi – Time of the Gypsies einem breiteren Publikum nahe. Spätestens seit der Jahrtausendwende sind darüber hinaus Balkan Beats so gut wie ein »Must« auf sämtlichen Tanzfeten mit Hipness-Faktor. Das Verdienst, die Musik des Balkans verpoppt respektive in die Nachbarschaft zu Techno und ähnlich zeitgemäßen Stilen geführt zu haben, gebührt dem Mannheimer Musiker, Produzenten und DJ Shantel – hier zu hören mit seinem programmatischen Titel Disko Partizani.
Ebenfalls stark von zeitgemäßen Electronic-Beats geprägt ist die Musik der in Österreich begründeten Band DelaDap. In Romani bedeutet der Name der Gruppe »Gib mir den Beat«. Beachtenswert ist die immer größer werdende Anzahl von Formationen, die sich gar nicht erst auf eine bestimmte Stilrichtung festlegen will und stattdessen den kreativen Mix unterschiedlicher Ethno-Stile mit Rock, Pop, Jazz, Ska und weiteren Richtungen pflegt. Auch ein bißchen Chanson schadet da nicht. Beispiel: die Berliner Formation 17 Hippies. Entstanden in den Neunzigern als musikethnologische Hobbyband, ist sie längst zu einer der Haus- und Magenbands des kulturinteressierten grünen Milieus avanciert. Deutschsprachiges mit Chanson-Appeal – wie hier in Frau von ungefähr – wird da lediglich der Beobachtung gerecht, dass die Welt längst so etwas wie ein musikalisches Global Village geworden ist. Multilingualisiert in Sprache und Liedgut agiert auch das Barcelona Gipsy Klezmer Orchestra, eine 2012 in der katalanischen Hauptstadt gegründete Formation – hier mit einem flotten Medley der rumänischen Volksweise Od Ebra do Dunava und dem populären spanischen Bürgerkriegslied Ay Carmela.
Vergebens das Unterfangen, all die Stile aufzuführen, die mittlerweile rund um den Globus zirkulieren. Ungeachtet der Unmöglichkeit dieses Unterfangens gibt es nach wie vor einen Reader, der selbiges wenigstens versucht: der Rough Guide Weltmusik – 2000 zuletzt erschienen und mittlerweile nur noch antiquarisch zu ordern. Verändert haben sich zwischenzeitlich natürlich auch die musikalischen Koordinaten südlich von Rio Grande und Florida Keys. Der neue Gesamttrend auf dem Kontinent hört auf den Namen Cumbia. Stilistisch ist Cumbia ein Sproß aus kolumbianisch-venezolanisch-mittelamerikanischer Folklore, Reggae, Ska und Techno-Beats. Bemerkenswert am Cumbia-Boom ist, dass der Stil keine abgezirkelte Lokal-Region widerspiegelt, sondern – mehr oder weniger und sicher auch in abgestufter Weise – auf dem ganzen mittel- und südamerikanischen Kontinent präsent ist. Eine typische Formation ist die kolumbianische Band Bomba Estéreo – hier mit dem Titel Fuego.
Stand der Dinge: Sowohl rurale als auch städtische Stile tauschen sich mehr und mehr über den Globus hinweg aus. Weltmusik ist längst keine Domäne mehr von bildungsbeflissenen Gymnasiallehrern, ethnischen Diaspora-Communities oder ruralen Gemeinschaften in einer bislang wenig erschlossenen Weltgegend. Die »Generation Widerstand« – womit an der Stelle der globalisierungskritische Widerstand gemeint ist – hat mittlerweile ihre eigenen Formen der Adaption gefunden. Ein weiterer Stil-Bastard hört auf den Namen Mestizo. Gemeint ist ein Stil-Mix, der lateinamerikanische Traditionsmusik mit Rock, Techno, Ska, Punk, Hip Hop sowie systemkritisch-widerständigen Texten kombiniert. Anerkannter Star dieser Szene ist natürlich Manu Chao. Doch auch in der Breite gewinnt diese Richtung immer mehr Zuwachs. Dem Mestizo zurechnen lassen sich Punk-Ska-Formationen wie die mexikanische Band Tijuana No! ebenso wie die aus Barcelona stammende Formation Che Sudaka oder die argentinischen Los Fabulosos Cadillacs.
Fazit: Auch musikalisch wird die Welt zunehmend zum Dorf. Das löst zwar nicht das Bündel der – tendenziell immer größer werdenden – Pobleme. Allerdings eröffnet dieser Prozess zumindest eine Option: dass sich mit den Austausch der jeweiligen Musik auch die Menschen weniger fremd werden.
-------
Korrektur: Die in der ursprünglichen Textversion Erich Honnecker zugeschriebene Aussage zur Beat-Musik in der DDR stammt in Wirklichkeit von Walter Ulbricht. Der Fehler ist im Text nunmehr korrigiert.
Info
»Mashups« (siehe Wikipedia) sind Samplings, bei denen zwei oder mehr Musikstücke zu einem zusammengesamplet werden. Die Beitragreihe »mashupt« Themen, Künstler(innen) und Stile der Pop- und Rockmusik.
Staffel 1: (1) Hardrock versus Country | (2) Stones versus Dylan | (3) Feuerzeugballaden | (4) Funk versus Soul | (5) Wader versus Scherben | (6) Clash versus Cure | (7) Der »Club 27« | (8) Reggae-Time | (9) Venus, Glam & heiße Liebe | (10) Raves & Bytes
Staffel 2: (1) Die Hüter der Tradition | (2) Die Weitergabe der Staffel | (3) Gabriel und Werding
Die nächste Folge thematisiert das dialektische Verhältnis zwischen schwarzem Blues und dem Schmerz des weißen Mannes.

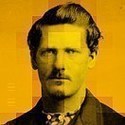




Was ist Ihre Meinung?
Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.