Unter Linken – oder, zeitgerechter formuliert: progressiv sich verstehenden Menschen – galt Country lange Zeit als Epizentrum alles Reaktionären. Anlass, wir wollen es nicht verschweigen, gab es durchaus: Ebenso wie Schlagerbarde Freddy Quinn rückte auch Countrystar Merle Haggard Südstaaten-basierte Sekundärtugenden Ende der Sechziger ins wortwörtlich rechte Licht. Das auf Dauerpatriotismus getrimmte Grundrauschen von Formationen wie Son of the Pioneers war ebenfalls nicht unbedingt von der Sorte, die fortschrittlich gestimmte Counterculture-Aktivisten oder Rockfans mitnahm. Mißverständlich, um es nett zu formulieren, waren auch einige verbale Countrygrößen-Statements sowie Shakehands mit extrem falschen US-Präsidenten. Summa summarum reichte dieses Standbild aus, das Genre zwei Jahrzehnte lang in den progressiven Giftschrank zu sperren. Stark unterkomplex war diese Form der Ausgemeindung bereits zur Entstehungszeit: Country-Bolide Johnny Cash hatte sich gerade mit der musikalischen Ikone aller 68er- und Counterculture-Aspiranten zusammengetan. Mit Nashville Skyline lieferte Dylan ein Album ab, dass Fans beider Richtungen zufriedenstellen konnte. Darüber hinaus war zumindest die US-Rockmusik ohne Country undenkbar. Nicht nur im wörtlichen Sinn – also dass Grenzgänger(innen) zwischen Rock und Country das Personal stellten für Dylan-Begleitbands, Supergroups der Marke Crosby, Stills, Nash & Young sowie die sozialkritischen Bilder des New Hollywood. Auch profanes Beziehungs-Techtelmechtel sorgte für Zugluft sowie neu sich bildende Netzwerke. Bekanntestes Beispiel: Emmylou Harris, Freundin des verstorbenen Byrds-Frontman Gram Parsons und – ein Bisschen Pathos an der Stelle darf schon sein – Miterfinderin des feministischen Zweigs der Country Music.
Standardschablone zur Aufrechterhaltung der linksliberalen Genre-Lebenslüge war die feingeistige Unterscheidung in Folk (= gut, unterstützenswert) und Country (= böse, reaktionär). Gut waren demzufolge Woody Guthrie, Pete Seeger und natürlich Dylan himself. Böse hingegen war der gesamte Rest – die, die es wagten, auf hinterwäldlerischen Banjos rumzuklimpern oder sich sonstwie auf fragwürdige Roots bezogen. In den Neunzigern löste sich das fragwürdige Theoriekonstrukt von guten und bösen Genres langsam auf; ein realistischerer Blick machte sich breit. Mitauslösendes Ereignis war sicherlich die legendäre, mit Nirvana-Produzent Rick Rubin eingespielte American Recordings-Albumreihe von Altmeister Johnny Cash. Eine Wucht waren die »Recordings« gleich in mehrererlei Hinsicht: a) weil Altmeister Cash – nach seinen legendären Knastauftritten sowie dem Highwaymen-Intermezzo mit seinen Kollegen Nelson, Jennings und Kristofferson (siehe Clip oben) – erneut auf das Junge, das Unangepasste und Authentische setzte, b) aufgrund der herausragenden Güte der Songs, c) aufgrund der Signalwirkung, die diese Song-Sammlung zwangsläufig entfalten musste. Anders gesagt: Nach Cashs »Recordings« kamen auch die notorischsten Country-Hater kaum mehr umhin, die neuen Strömungen im Metier zumindest zur Kenntnis zu nehmen.
Je nach Zählweise blickte das Genre bis dato auf eine Wegstecke von vierzig bis siebzig Jahren zurück. Abhängig von der historischen Nullpunktsetzung liegen die Wurzeln der auf Schallplatte gepressten Hillbilly-Musik entweder in den Zwanzigern oder aber in der Depressionsära zehn Jahre später. Hausbacken, auf eine Form von Ponderosa-Idylle getrimmt sind fast alle Aufnahmen aus jener Zeit: Hinterwäldler und Hinterwäldlerinnen eben – vor einer Scheune postiert und posierend mit den obligatorischen Cowboyhüten, Fransenjacken und notorischen Gute-Laune-Gesichtern. Der erste Superstar des Metiers war Hank Williams. Seine kurze, vom Alkoholtod beendete Karriere währte lediglich sieben Jahre: von 1946 bis 1953. Dass Williams’ Song-Oeuvre ein Steinbruch war und entsprechend ein Karriere-Beschleuniger für viele andere, wurde erst im großen Rückblick klar. Überschattet wurde Williams’ Bedeutung lange Zeit von der des großen Meisters des Metiers überhaupt: Johnny Cash. Dann starb Cash – während das Genre sich in Lichtgeschwindigkeit in seine unterschiedlichen Marktbestandteile und Sub-Szenes aufpuzzelte.
Was Country heute ist, ist eine gute Frage. Wahlweise nennen kann man Countrypopstar Taylor Swift, Altikone Loretta Lynn, den Neotraditionalisten Brad Paisley oder aber Rootsrock-Interpreten wie etwa die Band Mumford & Sons. Ein weites Feld also. Da ein Jahrhundert sich schlecht in einen Artikel packen lässt, ist es vielleicht aufschlussreich, den Spirit dieser Musikform von den Familienclans her aufzurollen, welche das Genre Country prägten. Die Beschäftigung mit den Williams’, den Carters & Cashs sowie Vater und Sohn Earle hat den Vorteil, dass sie fast alle wesentlichen Wegemarken beinhaltet, welche der Popmusik-Markt für die (vorwiegend) weißen Bewohner(innen) der zentrenabseits gelegenen US-Regionen durchmachte. Auch die Songs purzeln hier sozusagen im Jahrestakt. Was Hey Good Lookin’ und Move it all over die Hank-Williams-Ära waren, waren Ring of Fire, The Baron und Hurt für die Cash-Dekade. Schlussendlich einzugehen wäre schließlich auf die Frage der Wachablösung – wobei der in den politischen Agitationsmodus hinübergewechselte Steve Earle ein guter, allerdings nicht der einzige Kandidat ist.
Hank Williams
Videoclip-Beispiele für den herausragenden Star der Nachkriegs-Countrymusik haben ein riesiges Problem: das der Authenzität. In der Zeit entstandene TV-Einspielungen gibt es. Für heutige Ansprüche allerdings ist die Form der Inszenierung unzufriedenstellend, gekünstelt. Umgekehrt gibt es einen recht manierlichen Film – I Saw the Light (2015) mit Tom Hiddleston in der Rolle des Hank Williams. Letztendlich jedoch scheitert die Visualiserung am – vielleicht – zu großen Zeitabstand. Dass Williams’ Songs überdurchschnittlich realistische Alltagsbeschreibungen enthielten, ist heute ebenso schwer vermittelbar wie der Umstand, dass der Sänger für seine Umgebung ein veritabler Alptraum gewesen sein muß. Der Country-Musiker Hank Williams ist ein Kind des tiefen Südens. Geboren im Bundesstaat Alabama, arbeitete er sich aus einfachsten Verhältnissen hoch. Zur Musik zog es ihn früh. 1938 schmiss er die Schule, um bei einem Country-Radiosender als DJ zu arbeiten.
Dann kam der Krieg: ein Einschnitt, den man stetig mitbedenken sollte, wenn man die – aus heutiger Sicht oft unbedarften – TV-Aufnahmen aus der Nachriegs-Country-Ära betrachtet. Diejenigen, die hier einen auf Heile Welt und Landleben-Idylle machten, hatten großteils die Hölle hinter sich. Williams’ Generationskohorte rang nicht nur den japanischen Militarismus nieder. Vom Kassarin-Pass bis zu den Alpen, von der Normandie bis zum Hürtgenwald und der bayerischen Kleinstadt Dachau waren sie maßgeblich daran mitbeteiligt, die Nazi-Pest auszukärchern, welche Europa nicht aus ihrem Griff hergeben wollte. Für Musik waren die Zeiten weniger gut. Bei Hank Williams kam ein zweites Problem hinzu – König Alkohol, bereits zu jener Zeit wohl sein beständigster Freund. Weder kollegialer Rat noch die Ehe mit seiner späteren Managerin Audrey Mae Sheppard richteten da viel aus. Williams absolvierte Radioshows in volltrunkenem Zustand, wurde rausgeschmissen, schrieb neue Songs – und landete, das Glück musste einem wie ihm schließlich hold sein, am Ende auf den vorderen Plätzen der Hitparaden.
Anders gesagt: Mit Hank Williams ging es ebenso stetig bergab, wie es mit seinen Stücken bergauf ging. Auf die sentimentale Westernswing-Ballade Never Again (1947) folgten bluesgetränkte Stücke wie Move it on over, Lovesick Blues und Honky Tonk Blues, das gut aufgelegte Hab-Spaß-mit-mir-Anmachständchen Hey Good Lookin’ (siehe auch Clip oben), eine Einspielung des Cajun-Klassikers Jambalaya, lebensweisheitlich angereicherte Indianerfolklore (Kaw-Liga, 1953) sowie Ähnliches. Für einige Gastauftritte hatte es den Sänger 1949 auch ins besetzte Deutschland verschlagen – genauer: in den Titania-Palast im Westberliner Stadtteil Steglitz. Dass Williams im Prinzip der unzugängliche, verfeinerten Genüssen eher abholde Hillbilly geblieben war, belegen Presse-Snippets aus jener Zeit. Beim Dinieren in einem Nobelrestaurant etwa herrschte der Sänger den Kellner entnervt-ungehalten an: »Hey Hermann – bring me the Ketchup«. Auch die verbleibende Vita des ersten Stars der Country Music verblieb weiter auf der Schiene Eskapaden, Krawall und Hochprozentiges. Die weiteren Stationen: Scheidung und zweite Ehe inklusive hochkarätigem Hochzeits-Event, Rausschmiss aus der Grand Ole Opry, zusätzlicher Konsum von Morphium und schließlich, am 1. Januar 1953, das Ende: Polizeikontrolle, ein toter Sänger im Wagen. Todesursache: Herzinfarkt, hervorufen von übermäßigem Medikamenten- und Alkoholkonsum.
Johnny Cash
Ebenso wie Hank Williams – oder, einige Jahre später, der King des Rock’n’Roll – hatte auch Johnny Cash hautnahen Kontakt mit dem Land der Dichter und Denker: in Landsberg/Lech absolvierte er ab 1951 seinen Militärdienst. In Germany komponiert haben soll er auch einen seiner wesentlichen Titel – Folsom Prison Blues. Spätere Germany-Zeugnisse des überragenden Country-Sängers seiner Epoche sind allerdings von der Art, die an die tiefsten Gefilde seines Landmanns Presley erinnern. Die Handvoll eingedeutscher Songs, welche Cash Anfang der 1960er einspielte, sind eher von der Art, die 250-prozentige Fans des Sängers goutieren (Kostprobe). Doch ebenso wie bei Presley gehört auch bei Cash der Kitsch mit zum Oeuvre hinzu. Ebenso wie Hank Williams war auch Johnny Cash ein Kind des Südens. Geboren wurde er 1932 im Mittelwest-Bundesstaat Arkansas. Das Leben als Farmer blieb dem vierten von insgesamt sieben Kindern einer Baumwollpflücker-Familie ebenso als Bild erhalten wie die Präsenz familiärer Tragödien (einer seiner Brüder verunglückte tödlich beim Hantieren mit einer Kreissäge).
Der Rest kam nach Germany. J. R. Cash sprach bei einem innovativen Label in Memphis vor, überzeugte die Label-Macher und änderte seinen Vornamen in Johnny. Der Rest wurde Geschichte. Mit den in der Sun-Ära entstandenen Stücken begründete er Mitte/Ende der Fünfziger seinen Ruf: Folsom Prison Blues, I Walk the Line und schließlich die Cash-Ballade schlechthin: Ring of Fire. Mitgeschrieben hatte den Titel June Carter – Cashs spätere Frau. Zusammen mit der Carter Family war June Bestandteil eines Geschäftsmodells, dass so wohl nur im Country erfolgreich sein konnte: die musikalisch erfolgreiche Familie, die privat natürlich wie Pech und Schwefel zusammenhält. Der aussagekräftigste Biografiefilm – Walk the Line mit Joaquin Phoenix – rückt diese Periode eher in den Hintergrund. Biografisch interessanter ist so wohl ein zweiter der frühen Cash-Songs: I Walk the Line. Geschuldet war er den Eifersüchteleien von Cashs erster Ehefrau – der er mittels Livedarbietungen von I Walk the Line mitteilte, dass er treuetechnisch »auf Linie« war.
Wie es ausging, ist bekannt: 1967 heiratete Cash June Carter. Zusammen gaben Carter & Cash das Dream Team der Country Music schlechthin ab. Der Rest war durchwachsen. Cashs Rockabilly-betonter Chicaboom-Sound hatte sich Mitte der Sechziger Jahre überlebt. Hinzu kamen Probleme mit Drogen und den Ordnungsgewalten. Was folgte, war die erste substanzielle Wendung seiner Biografie. Cash suchte den Clash. Seine Auftritte in den Haftanstalten San Quentin und Folsom wurden geradezu legendär. Anders als Elvis Presley, dessen Karriere in etwa zeitgleich zu der von Cash begann, ging Cash den Ausbruch aus den erwarteten Rollenschema nicht nur punktuell, sondern systematisch, auf Langfristigkeit ausgerichtet an. Stärkere Früchte als seine Sessions zusammen mit Bob Dylan trug der Zusammenschluss mit drei anderen Outlaws: Kris Kristofferson, Willie Nelson und Waylon Jennings. Unter dem Namen The Highwaymen etablierten sie nicht nur eine Art US-amerikanischer Variante des Erfolgsmodells Wecker–Wader–Mey. In den Achzigern sorgten Cashs Highwaymen-Auftritte nicht unwesentlich mit dafür, dass der Sänger auch künstlerisch weiter Präsenz zeigen konnte.
Nichtsdestotrotz lieferte Johnny Cash auch in der Zwischenperiode zwischen Live at San Quentin und den American Recordings eine Menge Substanzielles ab. Ein typisches Beispiel: der Song The Baron (siehe Clip oben) – ein Westernstück, in dem es darum geht, wie das Alter (personifiziert durch die Figur »The Baron«) die Jugend (symbolisiert durch die Figur Billy Joe) erfolgreich in den Senkel stellt. Es geht um ein Billiardspiel gegen Geld – wobei Billy Joe in seiner Not schließlich den Ehering seiner Mutter setzt. Der Baron erkennt den Ring als den seiner ehemaligen Frau wieder, welche er zwanzig Jahre zuvor verlassen hat, und Billy Joe infolgedessen als seinen Sohn. Mit etwas Hängen und Würgen könnte man The Baron als optimistische, mit einem halben Happy-End endende Variante von A Boy named Sue klassifizieren (der Baron gibt, so viel sei verraten, seinem wiedergefundenen Sohn den freundschaftlichen Rat, an seinem Stoß noch zu arbeiten). Tief am amerikanischen Grund schürfen blieb auch später eine der wesentlichen Fähigkeiten von Cash. Er beendete es so, wie wir es alle kennen: mit den American Recordings, fünf in komplett abgespeckter Besetzung aufgenommenen Alben, die alles enthielten, was der Mensch (zumindest der weiße) für den letzten Sinn so braucht: Spirituals wie Wayfaring Stranger, düsterer American Gothic wie in The Man Comes Around oder neu interpretierte Klassiker wie Solitary Man. Dann ritt er ein – gesundheitlich schwer gezeichnet und fünf Monate nach dem Tod seiner Lebensgefährtin June Cash.
Das Wachablösungs-Problem
Von den vier Highwaymen weilen zwei noch unter den Lebenden: Willie Nelson und Kris Kristofferson. Nichtsdestotrotz wurde die Frage, wer nach Cash die überragende, legendäre Figur der Country Musik sein soll, nie ernsthaft erörtert. Das mag mit der Vielfalt zu tun haben, in die sich dieses Marktsegment mittlerweile aufgesplittet hat, siehe oben. Anders gesagt: Ein einvernehmlicher Konsens über das, was Country Music ausmacht und das, was sie von anderen Sparten unterscheidet, ist kaum noch möglich. In den Neunzigern noch sah das etwas anders aus. Schuld daran waren drei, vier außergewöhnliche Alben, welche ein weiterer Outsider des Country Business zu der Zeit abgeliefert hatte: Steve Earle. Den Rebell hatte Earle bereits gegeben, als er noch vielversprechender Star des New Country war und mit Titeln wie »Guitar Town« getreulich seinen Hitparaden-Pflichten nachkam. Politisch in der linken Kurve befand er sich schon immer. Ebenso wie bei Hank Williams kam dann zu viel von allem. Gewalt, Drogen, Waffenbesitz und schließlich eine Haftstrafe. Am Ende erfand Steve Earle sich neu. Noch prononcierter linkspolitisch aufgebürstet, lieferte er nicht nur den Soundtrack zur globalisierungskritischen Bewegung der Anfangsjahrtausend-Jahre – sondern stürzte sich mittenrein ins Getümmel.
Das Problem bei dem Ganzen: Mittlerweile scheint Steve Earle konsequent zu verdrängen, dass politische Missionen nicht vorrangig das sind, was das Publikum sucht. Seine Neunzigerjahre-Konzerte – ich war auf zweien – waren exzellent: super-Begleitgruppe, authentischer Roots Rock und ein Steve Earle auf dem Höhepunkt seiner zweiten Karriere. In aktuellen Clips mit Liveeinspielungen hingegen beträgt das Verhältnis zwischen Song und Gesprochenem mitunter eins zu zwei. Wichtig bleibt er allemal. Nachfolger in der Earle-Dynastie war – bis zu seinem Tod 2020 – sein Sohn Justin Townes. Der zweite Vorname stammt von den Singer-Songwriter Townes Van Zandt – Vater Steves großes Vorbild und in den Siebzigern/Achtzigern Schmerzensmann des Genres und ewiger Insidertipp gleichermaßen. Zwar hat auch der 1997 verstorbene Townes Van Zandt dem Metier Dutzende herausragender Songperlen hinterlassen. Eine Karriere, die damit endet, dass die Songrechte allesamt der Geehelichten überschrieben werden und nach der Scheidung nichts mehr bleibt, möchte man allerdings niemand wünschen. Justin Townes Earle wird dazu keine Gelegenheit mehr haben. Ein Nachruf auf ihn findet sich hier. Musikalische Kostprobe an der Stelle: die Audio-Version von einem der besten Van-Zandt-Songs überhaupt, hier interpretiert von Vater und Sohn Earle zusammen: »Mr. Mudd and Mr. Gold«.
Eine Dynastie auf den Weg gebracht hat auch Hank Williams. Über die Frage, wie die drei Williams – das Original, seinen Sohn Hank Williams Jr. oder den Enkel, Hank Williams III – beliebtheitstechnisch einsortiert, lässt sich als alter Country-Hase gut fachsimpeln. Ich persönlich präferiere das Original und den bislang jüngsten Sproß der Dynastie, Hank Williams III (siehe Clip oben), auf Rangfolge zwei. Es ist nur schwer zu bestreiten: Der Enkel hat was. Obwohl musikalisch klar auf die Folkpunk-Schiene gewechselt, ist das musikalische Material durchgängig substanziell. Hinzu kommt, dass es stetig »Rebel« ist. Egal wo und mit wem: Hank Williams III erweckt stetig den Eindruck, direkt-unmittelbaren Rapport geben zu wollen vom aktuellen Frontverlauf der US-amerikanischen Opioidhölle. Authenzität plus persönliches Beispiel: Womit mindestens zwei Faktoren in trockenen Tüchern wären, die auch dem ersten Hank nicht unvertraut waren.
Der Carter-Cash-Clan hat ebenfalls durchaus karätigen Nachwuchs an die Rock’n’Roll-Front entlassen. Roseanne Cash, die leibliche Tochter von Johnny Cash und June Carter, scheint vor allem der Darling des gepflegten Feuilletons zu sein. Der interessantere Part ist in meinen Augen ihre Halbschwester Carlene, Johnny Cashs Stieftochter. Auch Carlene Carter hat in den Achtigern und Neunzigern das Rock’n’Roll-Leben in tiefen Zügen inhaliert. Karrieretechnisch wurde ihr zum Verhängnis, dass ihr Sound für Country zu rockig, für Rockmusik-Enthusiasten hingegen zu countrybehaftet war. Als Beispiele an der Stelle zwei Stücke. Nummer eins: Baby Ride Easy – ein im Duett mit Dave Edmunds dargebotener Schmachtfetzen, in dem eine Restaurantbedienung ihren Trucker-Schwarm anhimmelt, der, das Leben ist eben hart, bald wieder unterwegs sein wird zu seiner Angetrauten. Nummer zwei: Every Little Thing, eine Groove-Nummer, die klingt, als sei sie von T. Text – nur ohne T. Rex. Insgesamt beschleicht mich bei Carlene Carter konstant der Eindruck, dass sie es im Schatten des großen Clan-Patriarchen nicht immer leicht hatte. Immerhin, sagt der Optimist: Die feministische Welle kam irgendwann auch in der Country Music an. Den Paradesong für alle Thelma & Louise-Enthusiast(inn)en schrieb 1991 Mary Chapin Carpenter. Es heißt He thinks he'll keep her und behandelt das Schicksal einer Working-Class-Amerikanerin, die rackert und rackert und rackert und trotzdem nie die Anerkennung kriegt, die ihr eigentlich zusteht.
Ein Artikel, der im Krieg beginnt und mit dem Feminismus endet – ein bißchen symptomatisch vielleicht für das Genre, dass sich Country nennt. Aber so ist dieses Genre vielleicht: immer gut für einen vollen Schlag auf die Realität – und, nach dem Motto »Sag mir, was du gern hörst, und ich sage dir, was du bist«, vielleicht gerade darum das bestmögliche Bild, was man sich vom Zustand der weißen amerikanischen Arbeiterklasse machen kann.
Info
»Mashups« (siehe Wikipedia) sind Samplings, bei denen zwei oder mehr Musikstücke zu einem zusammengesamplet werden. Die Beitragreihe »mashupt« Themen, Künstler(innen) und Stile der Pop- und Rockmusik.
Staffel 1: (1) Hardrock versus Country | (2) Stones versus Dylan | (3) Feuerzeugballaden | (4) Funk versus Soul | (5) Wader versus Scherben | (6) Clash versus Cure | (7) Der »Club 27« | (8) Reggae-Time | (9) Venus, Glam & heiße Liebe | (10) Raves & Bytes
Staffel 2: (1) Die Hüter der Tradition | (2) Die Weitergabe der Staffel | (3) Gabriel und Werding | (4) Global Villages | (5) Der Schmerz des weißen Mannes | (6) Die Leichtigkeit der Dinge | (7) Der Schwermetall-Report | (8) Beatz & Reime
Die zweite Staffel geht ins Finale. Thema der letzten Folge: Retro-Trends in elektroverstärkter wie akustischer Musik.

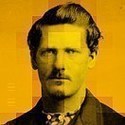



Was ist Ihre Meinung?
Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.