Der schwarze Mann hat es nicht einfach. Die schwarze Frau ebenfalls nicht. Als Billie Holiday am 17. Juli 1959 in einem verrotteten New Yorker Hospital verschied, saßen J. Edgar Hoovers Drogenagenten direkt am Sterbebett. Der Feldzug von Hoover gegen die berühmte Jazz- und Blues-Ikone zog sich zu diesem Zeitpunkt bereits über Jahrzehnte. Er beinhaltete systematische Schikanen, polizeiliche Übergriffe und wirtschaftliche Schädigung – kurzum: das komplette Besteck, das zu befürchten ist, wenn ein übergriffiger, mit der nötigen Macht ausgestatteter Staat zielstrebig gegen ihm Mißliebige vorgeht. Zugegeben – Holiday hatte ein Drogenproblem, ein veritables sogar. Den Rassismus und die de-facto-Apartheid, die für afroamerikanische Musiker(innen) bis weit in die Sechziger obligatorisch war, kann das indes nicht entschuldigen. Ob der legendäre Chef der US-amerikanischen Bundespolizei, der seinen Berufseinstand bei den »Red Scare«-Repressionskampagnen Anfang der Zwanziger abgeliefert hatte, im krankhaften, wahnhaften Sinn paranoid war oder sich nach der Meldung vom Ableben seines Opfers eine kleine, machtvergessene Entspannung unterm Schreibtisch gönnte, ist darum nicht so sehr die Frage. Die wirklich interessante Frage ist, wie sich das Stil-Bundle afroamerikanischer Musikrichtungen aus dem Ghetto der Race Records heraus einen Weg freischlagen und auf irgendeine Weise im amerikanischen Pop-Mainstream ankommen konnte.
Um das Phänomen Soul Music zu verstehen, ist der Blick auf einige Vorläuferinnen des Metiers hilfreich. Ruth Brown beispielsweise, Big Mama Thornton, LaVern Baker oder etwa ein ungewöhnlich vielseitiges Energiebündel aus dem tiefen Arkansas – Sister Rosetta Tharpe. Im Verlauf ihrer Karriere durchlief Tharpe alle Aggregatzustände, welche im Rahmen schwarzer Musik möglich waren: den Field Blues und Gospel ihrer südlichen Heimat, die Rhythm-and-Blues-Kapellen der Nachkriegsära und schließlich den städtischen Blues bis hin zu den Jazz- und Bluesfestivals der Sechziger. Die Strategie, mit der sie es von der Frontfrau beim Orchester von Lucky Millinder bis zum Folkfestival-Auftritt inklusive Pferdekutsche am Bahngleis schaffte, ist nicht allzuschwer zu durchschauen: Tharpe hatte es erfolgreich hingekriegt, sich unentbehrlich zu machen. Hinzu kam ungewöhnliches Talent und ein begnadetes Fingerchen für Live-Performances. Anders als ihre Kolleginnen Brown, Thornton und Baker stand sie jedoch nicht einfach im altetablierten Blues ihre Frau (oder marodierte – wie Baker – zwischen Mainstream-Pop, Rock’n’Roll und Blues hin und her). Sister Rosetta schuf einen Stil-Mix, der alle Stile der afroamerikanischen Musik integrierte.
Wieso nahm der Soul Train Anfang der Sechziger so an Fahrt auf? Sicher hat ein Dr. Martin Luther King hier eine nicht unwichtige Rolle gespielt. Für Infrasktruktur sowie stilistische Alleinstellungsmerkmale indes waren die Labels zuständig: Stax in Memphis, Tennessee, für die südliche, eher ungeschliffene, ursprüngliche Richtung, Motown in Detroit für die distinguierte, urbane Variante. Wichtig für die Anfangszeit war vor allem Label Nummer drei –Atlantic Records, ein in New York ansässiges und vom Großenvolumen eher mittleres Unternehmen. Innovativ und musikalisch ambitioniert bewegte sich Atlantic mit seinen Veröffentlichungen in jenem Bermuda-Dreieck aus alteingesessenem Rhythm’n’Blues, noch älterem Gospel und zeitlosem Jazz, aus dem sich binnen weniger Jahre die neue afroamerikanische Popmusik herausdestillierte. Am Anfang standen etablierte Acts wie die Jazz-Soul-Disseuse Nina Simone (Anspieltipp: »Sinnerman«). Allzeit-Fisch im Atlantic-Netz war vermutlich Aretha Franklin. Einerseits avancierte Franklins 1967er-Hit »Respect« zu der Erkennungshymne der Bürgerrechtsbewegung schlechthin. Am Ende des kurzen Jahrzehnts war jedoch auch das Innovationskonzept der Atlantic-Begründer Ertegün Makulatur. Unbemerkt vom popfokussierten Musikmarkt hatte sich sein afroamerikanischer Part erneut ausdifferenziert in unterschiedliche Richtungen – schweißtreibende, reduzierte Riffs mit Jazz-Anklängen hier, durchchoreografierte Tanzballaden da. Man könnte sagen: Kaum war Soul tot, standen Funk und Disco bereits in der Tür. Und: Weil die afroamerikanische Popmusik großzügig war, lieferte sie gerade im Umbruchs-Doppeljahr 1970/71 – nach den Unruhen von Watts, den FBI-Ermittlungen gegen die Black Panthers und den tödlichen Schüssen auf Martin Luther King und Malcolm X – die beiden Paradetitel für die gerade vollzogenen Umbrüche ab: James Browns »Sex Machine« und »Papa Was A Rollin’ Stone« von den Temptations.
Sex Machine
Wie sich James Brown als Mr. Sex Machine in Szene setzte, ist auch heute noch ein Unikum. Zehneinhalb Minuten abgespeckter, auf Bass, Drums und gelegentliche Horn- sowie Orgeleinsätze eingedampfter Gesang. Man könnte auch sagen: Rap. Mr. Brown sang – nein: erzählte, schrie, tanzte – die Allzeitnummer des Ghettoboys, der seinen Mann zu stehen hatte und bitterernst gewillt ist, ihn auch zu stehen. Womit »stehen« meint: in wirklich jeder begrifflichen Beziehung. Das Rahmensetting handelt von um die Häuser ziehen, einen drauf machen, Frauen aufreißen. Brown und sein Call-and-Response-Sparringspartner Bobby Byrd steigern sich dabei zunehmends herein in die Pimp-gängige Pose des Was-Hermachens, Angebens, Ankündigungen-Setzens (ob sie stimmen, ist stets eine andere Frage). »Sex Machine« – im vollen Titel »Get Up (I Feel Like Being A) Sex Machine« – ist dabei weit mehr als die Summe aus Musik und Text. Musikalisch bringen Brown und seine Combo die Technik des musikalischen Abspeckens an ihre Schmerzgrenze. Was bleibt, ist Rhythmus. Untermalt von einer auf minimalistisch getrimmten Begleitband und animiert vom Stichwort-zuwerfenden Byrd sowie (im Clip) dem im Hintergrund tanzenden Model Elza Soares, tanzt und singt sich Brown geradezu in einen Furor in Sachen »Sex Machine« hinein.
Standfestigkeit ist in diesem Song alles. Man könnte auch sagen: die »Sex Machine« im Rampenlicht ackert und ackert und ackert und ackert. Ein Höhepunkt – im Sinn von Höhepunkt, auch: zum Ende kommen – ist in diesem Setting nicht vorgesehen; Long- und Short-Version blenden lediglich an unterschiedlichen Stellen aus. Wirklich bemerkenswert sind allerdings die uralten Wurzeln, die dieser Paradesong des Funk auf so lässige Weise rekapituliert. Die Horn-Sektion – selbstredend in einheitlicher Kleidung – ist im Grunde eine Referenz an die Rhythm’n’Blues-Kapellen der Nachkriegsära; Cab Calloway, Louis Jordan und der bereits erwähnte Mr. Millinder lassen grüssen. Brown selbst gibt den Parade-Hustler, reflektiert die kleinkriminellen Roots, die seine eigene Biografie nicht unmaßgeblich mitgeprägt haben. Brown, geboren 1933 im US-Bundesstaat South Carolina, kannte nicht nur das ärmliche Leben auf der Straße (inklusive Knastaufenthalten) aus eigener Anschauung. Auch musikalisch war er 1970 alles andere als ein Newcomer. Seine einschlägige Diskografie reicht zurück bis in die späten Fünfziger. Auch in seinen frühen Hits – Beispiel: der Paradetitel »It’s a Man’s Man’s Man’s World« aus dem Jahr 1966 – war Brown eher ein stetiger Begleiter der aktuell angesagten RnB-Moden denn ein bewußt agierender Innovateur.
Inwieweit der 2006 in Atlanta verstorbene Brown bewußt die musikalischen Spielregeln änderte, bleibt auch im Nachhinein Auslegenssache. Fakt ist, dass sein auf Rhythmus und Tanzbarkeit angelegter Soul-Stil mehr oder weniger zwangsläufig auf Funk hinauslief. Eine Agenda für Befreiung boten Sänger und Sound allenfalls bedingt. Im Hinblick auf seine Band praktizierte der »Godfather des Soul« ein Prinzip des Hire & Fire. Darüber hinaus war er als Perfektionist und Despot gleichermaßen verschrien. Musiker, die einen Einsatz verpatzten oder sonstwie unangenehm aus der Rolle fielen, hatten im besseren Fall Gagenabzüge zu vergegenwärtigen, im schlechteren Fall den Rausschmiß aus der Band. Ungeachtet dessen – oder vielleicht: gerade deswegen – galt die James-Brown-Formation als erste Adresse für ambionierte afroamerikanische Musiker. Entsprechend ranken sich um James Brown die unterschiedlichsten Legenden – inklusive der, dass er den Tod von Elvis Presley mit der Bemerkung kommentiert haben soll: »Jetzt bin ich nicht mehr die Nummer Zwei«. »Black Power« – oder jedenfalls das musikalische Synonym dafür – ist sein schweißdurchtränkter Sound bis heute geblieben. Und – im historischen Rückblick – eine der Hauptstraßen, die schließlich in Richtung Hip Hop und Rap führten.
Papa Was A Rollin’ Stone
Wies die Musik von James Brown hinaus in Richtung Hip Hop, nahmen die Temptations und ihre ein Jahr nach »Sex Machine« erschienene Tanzeloge »Papa Was A Rollin’ Stone« den Sound von Disco um Jahre vorweg. Programmatisch könnte der Unterschied zwischen zwei Stücken kaum extremer ausfallen. Wo Brown reduzierte, bis nur noch Bass, Schlagzeug und Gesang übrigblieben, lieferten die Temptations eine fein durchziselierte Soul-Sinfonie ab – mit minutenlangem Instrumental-Oeuvre, Geigen und schließlich Gesangsparts, die bis in den letzten Winkel hinein durchchoreografiert waren. Schweiß, Leidenschaft und große Gefühle brachen sich selbstredend auch hier Bahn: Im Kern ist »Papa Was A Rollin’ Stone« eine Anklage – gegen einen Vater, der ein Herumtreiber war, ein Abwesender. Textlich beschränkt sich das Stück auf die Beschreibung. Ob der Sänger (oder: die Sänger) die Handlungsweise schlecht finden oder, im Gegenteil, als Vorgabe gut für ein männliches Identifkationsmodell, bleibt offen.
Obwohl ungeschönte Situationsbeschreibungen in der Soul-Musik alles andere als unüblich waren, markiert »Papa Was A Rollin’ Stone« einen stilistischen Bruch. Salopp könnte man es mit dem Bonmot »Der Weg ist das Ziel« beschreiben. Ähnlich wie James Brown stellten auch die Temptations die Tanzbarkeit ihres Stücks in den Mittelpunkt. Lediglich die Wege zum Ziel waren dabei unterschiedlich. Während »Sex Machine« die ungeschliffene Kraft des afroamerikanischen Aufsteigers symbolisierte, akzentuierte »Papa Was A Rollin’ Stone« auf die Kultiviertheit einer neuen afromamerikanischen Mittelschicht. Die vortragende Formation wurde diesem Bild ebenfalls gerecht. Ebenso wie Brown und die Seinen waren auch die Temptations – ein aus fünf Mitgliedern bestehendes Gesangsquintett – in Sachen Soul mehr oder weniger Altgediente. Eine gute Frage indes ist, wieso ihr Label diese Art musikalischer Extravaganz überhaupt zuließ. Während der Godfather des Soul sich nämlich schon aufgrund seines Bekanntheitsgrades mehr und mehr von einengenden Vorgaben emanzipieren konnte, liefen die bei Motown unter Vertrag stehenden Acts gemeinhin brav in der Spur, welche Labelbegründer Berry Gordon vorgab.
Wieso Motown sich auf das Experiment mit einer Richtung einließ, für die zeitweilig der Begriff Psychedelic Soul in Umlauf war, ist im Nachhinein schwer zu sagen. Vielleicht war es einfach so, dass Berry Gordon einen lukrativen neuen Markt witterte. Wie auch immer: »Papa Was A Rollin’ Stone« avancierte zu einem der angesagtesten Stücke auf den Dancefloors. Nicht nur 1971, sondern auch den Jahren, ja Jahrzehnten darauf, und nicht nur in afroamerikanischen Tanzschuppen wie beispielsweise dem legendären Funcadelic in Frankfurt/Main, sondern überall. En passant war der Song auch eine Richtungsentscheidung – unter anderem eine, die nicht unmaßgeblich dazu beitrug, das Gordon-Imperium künstlerisch auszubluten. In der ersten Hälfte der Siebziger nämlich vollzog sich geradezu eine Explosion afroamerikanisch-kreativen Musikschaffens. Die Karriere von Stevie Wonder ist hier vielleicht das Paradebeispiel; allerdings schwirrte die Luft bereits unmittelbar nach Erscheinen des Disco-Paradestücks von Beispielen, die unüberhörbar die Message an den Mann und an die Frau brachten: Ich bin zwar Künstler. Das heißt allerdings nicht, dass du, Label-Chief, allein über meine Musik bestimmst.
Vom Blaxploitation zum Rap
Welches Stück im Nachhinein wo hin geführt hat, ist im Nachhinein immer schwer zu entscheiden. Dass »Sex Machine« an der Wiege des Funks stand (ihn in gewisser Weise sogar gezeugt hat), gilt jedoch mehr oder weniger als Allgemeinplatz. Augenfällig ist in meinen Augen, wie geradlinig diese Musik zum Hip Hop und zur Rap-Musik heutiger Tage hingeführt haben. Zugegeben – auch diese Aussage ist vielleicht ein Allgemeinplatz. Für die Tradition des narrativen Geschichtenerzählens, der situationsbedingten Übertreibung und auch der Glorifizierung bestimmter (männlicher) Verhaltensschemata gibt es jedoch kaum einen geeigneteren Referenzpunkt als eben »Sex Machine« von James Brown. Coverversionen von Rang sind übrigens rar – anders als bei der »Herumtreiber«-Eloge der Temptations, zu der an der Stelle zumindest die etwas funkiger gehaltene Version von Was (Not Was) aufgeführt werden soll. Ein gutes Beispiel in Sachen funkunterlegtes Geschichtenerzählen gibt etwa die Formation Jazzmatazz ab – ein Crossover-Projekt des US-Rappers Guru mit den Jazz-Saxophonisten Donald Byrd, dass Anfang der Neunziger eine Zeitlang als musikalisch wegweisend galt. Anspieltipp hier: ein auf den Sound fokussierter Clip des Stücks »Transit Ride«.
Ist auf der Strecke, die von »Sex Machine« zum Hip Hop der Neunziger führt, allenfalls noch der Antikriegssong »War« von Edwin Starr anzuführen, pflasterten die Temptations eine große, breite Straße in die Zukunft. Bereits zeitgleich mit der »PWARS«-Veröffentlichung häuften sich Filme und Filmmusiken mit ähnlichem musikalischem Schema, ähnlichen Erzählstories und ähnlicher Instrumentierung. Zentraler Begriff der Post-Black-Panther-Culture der Afroamerikaner(innen) ist Blaxploitation – ein Begriff, der erst mal das schwarze amerikanische Kino der Siebziger im Visier hat, im übertragenen Sinn jedoch mehr meint: ein neues Selbstbewußtsein und eine neue Art und Weise, die eigene Geschichte und Gegenwart kulturell zu verarbeiten. Musikalisch dokumentiert wird dieser Stil durch zwei Titel, die gleichzeitig auch als Soundthemes fungierten: »Shaft« von Isaac Hayes und »Superfly« von Curtis Mayfield (Songbeispiel hier: die Ballade »Give Me Your Love«). Das Ende der Fahnenstange war mit diesen Black-Power-Sinfonien natürlich nicht erreicht. Wenn man will, kann man den Faden weiterspinnen zu Michael Jackson und seinem famosen Album »Thriller« – wobei die Auskoppelung »Billie Jean« vielleicht den geeigneten Konterpart abgibt zum Herumtreiber-Song der Temptations.
Selbstverständlich landet, wer von der Musik der Temptations redet und dem Psychedelic Soul jener Tage, über kurz oder lang – und einen Umweg-Abstecher vielleicht zu den Blues Brothers mit Aretha Franklin als Klassentreffen-Mitbeteiligter – bei Quentin Tarantino. Einer der unterschätztesten Tarantino-Filme überhaupt ist »Jackie Brown«. Intro hier: Pam Grier als Billigairline-Stewardess, die mit dem Drogenhandel-Beigepäck in ihrer Handtasche durch die Flughafen-Gänge des L.A.-Airport defiliert – unterlegt von nichts anderem als Bobby Womack und seinem Song »Across 110th Street«. Sicher kann man die Straße noch weiter in die Jetztzeit bauen und etwa Michael Kiwanuka mit hinzunehmen und seinen Song »Cold Little Heart«. Ähnlich wie »Far From Any Road« für die Düster-Serie »True Detective« avancierte »Cold Little Heart« zur Erkennungsmelodie der die Laster der Reichen & Schönen thematisierenden Miniserie »Big Little Lies«.
Womit der abgebrühte Zyniker Recht bekalten könnte mit dem Kommentar: Alles in trockenen Tüchern. Leider stimmt dieser Eindruck nur oberflächlich. Sicher – afroamerikanische Stars und auch die Musik der zweiten großen US-Minderheit sind mittlerweile fester Bestandteil des Mainstream-Pops. Dem gegenüber steht die weiterhin anhaltende und sich in manchen Bereichen verschärfende Diskriminierung – sich ausdrückend unter anderem in Bewegungen wie Black Lives Matter. Ein widersprüchliches Verhältnis zur afroamerikanischen Musiktradition pflegten zeitweilig jedoch auch die Subkultur der End-Sechziger und die mit ihr assoziierte 68er-Linke. Soul-Acts waren auf den Haupt-Events der Subkultur – siehe etwa Woodstock – eher mit der Lupe zu suchen; das einzige namhafte Gegenbeispiel – Jimi Hendrix – bestätigt in dem Fall eher die Ausnahme denn die Regel. War der lange Weg also erfolgreich? Am schlüssigten ist hier wohl die Mittelposition. Was konkret heißt: Afroamerikanische Musik beeinhaltet mittlerweile eine ganze Bandbreite höchst unterschiedlicher Stile – unterschiedlich in der Instrumentierung, unterschiedlich im Anspruch und unterschiedlich auch in der jeweils geäußerten Message. Auch wenn es rückblickend nicht allzu schwer fällt, zwei Songs auszumachen, die ungefähr in der Mitte stehen zwischen den Anfängen des Rhythm’n’Blues und Jazz und seinem heutigen Ist-Zustand als diversem, allseitig anerkanntem Marktsegment.
Was umgekehrt bedeutet, dass Songs zwar manches ausdrücken und auch zuspitzen können, für Weltveränderung jedoch ziemlich ungeeignete Aspiranten sind.
Mashups (siehe Wikipedia) sind Samplings, bei denen zwei oder mehr Musikstücke zu einem zusammengesamplet werden. Die »Mashup«-Textreihe kapriziert sich auf Schlüsselsongs – wobei in jeder Folge zwei vergleichbare Popmusik-Stücke im Mittelpunkt stehen. Die Folgen:
Mashup Vol. 1: Hardrock versus Country
Mashup Vol. 2: Stones versus Dylan
Mashup Vol. 3: Feuerzeugballaden
Mashup Vol. 4: Funk versus Soul
Mashup Vol. 5: Wader versus Scherben (folgt)

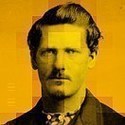




Was ist Ihre Meinung?
Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.