Ende der Siebziger Jahre sah Gott, dass die Rockmusik sich nicht nach seinem Geschmack entwickelt hatte. Also stieg er vom Himmel herab, wirbelte einmal kräftig durch das Geschehen, schärfte seinen Getreuen, die er kurz mit auf die Seite genommen hatte, etwas ein von wegen »Ihr müßt mehr auf die Roots achten« und machte sich darauf gleich wieder von hinnen. Seine Getreuen gaben ihr Bestes. Binnen fünf Jahren hatten sie die Rockmusik derart neu eingenordet, dass kaum noch ein Anhänger des alteingesessenen Pharisäerkultes (auch: »Artrock« oder »Progrock« genannt) sich in dem neuen Geschehen zurechtfand. Die neuen Stile hatten unterschiedliche Namen. Ein wichtiger (manche sagten sogar, es sei der wichtigste oder jedenfalls Allerwahrste, Allerauthentischste) war Punk. Doch Gottes neue Heerschar bot durchaus Raum für mehr Richtungen. Außer Punk gab es Reggae, Ska kam hinzu und Mods-Nachfolger mit Faible für Porky-Pie-Hüte, Sonnenbrillen und karierte Schwarzweißmuster. Im flackernden Licht neondurchfluteter Bars gesellten sich zu fortgeschrittener Stunde gar ein paar halbseidene Damen und Herren der Gattung Blue-Eyed Soul zur Runde – Simply Red beispielsweise oder Carmel. Hauptverkünder des neuen Evangeliums indess waren stark gitarrenrockbetonte und auf Druckablassen versierte Bands mit den Namen Pretenders, Police und Dire Straits. Und im Untergrund rumorte eine weitere, bis dato unbekannte Richtung: Wave, New Wave oder auch: Gothic.
Aller Differenzen ungeachtet war die Musikszene der Anfangs-Achtziger egalitär bis zum Anschlag. Und: durchlässig. Zugeben mochte das indess niemand. Punks verkloppten Popper; alle (oder jedenfalls die meisten) hassten Faschos. Aber sonst? Letztere auch hier ausgenommen, kamen im Schein der Neonbar alle zusammen. Denn: Wer wollte schon groß einen Unterschied machen, wenn die Tom Robinson Band songtextlich die Regenbogenkoalition umriss, die nötig war, um endlich Power in die Dunkelheit hineinzubringen? Dass die Zeit der zugekifften Hippies endgültig perdu war, galt allgemein als Konsens. Schwarze Klamotten waren auf einmal – unbedingt – angesagt. Und Konsumverzicht? Auf den wollte – nach Nina Hagens »White Punks on Dope«-Covereinspielung »Ich glotz’ TV« – auch niemand mehr was geben. Folglich kamen später Sade sowie eine Welle, die sich Neue Deutsche Welle nannte, mit der Gleichung »Schlager + bunte Klamotten + Ironie« jedoch weitaus prägnanter charakterisiert ist. Disco war auf den Dancefloors – zumindest denen des Vorstadtproletariats – bereits seit zehn Jahren angesagt. Nach den hektischen Achtzigern – ein, zwei Fluppen, und schon waren sie vorbei – bereitete sich die Republik bereits auf den Mauerfall und das »Anything Goes« der Nineties vor. Allerdings ist es immer schlecht, eine Geschichte vom Ende her zu erzählen. Berichtet werden soll daher von zwei Schlüsselsongs, die am Anfang jener Umbruchperiode standen – der eine ein Punkstück und Mobilisierer für jede Hausbesetzerdemo, der andere so richtig nach dem Weltschmerz-Feeling der Epoche: »London Calling« von The Clash und »Boy’s Don’t Cry« von den Cure.
London Calling
Beide Bands – Cure und The Clash – waren Bestandteil jener auf Fundamentalopposition eingestimmten Szenerie, welche sich Mitte der Siebziger anschickte, die Rockmusik-Welt vom verschwurbelten Kopf auf die Füße zu stellen. In gewisser Weise war eine Schmerzkur angesagt. Keine Band hatte den neuen Mix aus Provokation und neuen Sounds so gut drauf wie die Sex Pistols. In deren Umfeld – unter anderem als Vor-Band – schärften auch The Clash ihr Profil. Anders als die Pistols mit ihren zerstörungsdurchtränkten Zweieinhalb-Minuten-Abrißbirne-Nummern waren The Clash durchaus eine Band mit Traditionsbewusstsein. Das Grundsetting – die Dominanz der klassischen Besetzung Gitarre/Gesang, Bass, Drums – hatte sich die Formation um Sänger und Gitarrist Joe Strummer beim Merseybeat der Sixties-Machart abgeguckt – also: Yardbirds, Animals, Them und The Who. Hinzu kam – für reinkarätige Punkcombos wie die Pistols auch auch Ramones undenkbar – ein guter Schuß Reggae. Reggaedurchtränkt war auch »Armagiddeon Time«, die B-Seite der Single-Veröffentlichung vom dritten Album. »London Calling«, A-Seite und Titelsong des gleichnamigen Albums, begründete den Ruf von Clash gleich in zweierlei Hinsicht: a) als straighteste Vertreter des Punkrock, die damals zu haben waren, b) als linkspolitisches Flaggschiff der zeitgleich entstandenen »Rock against Rassism«-Bewegung.
Not war am Mann (und an der Frau): Die konservativ-neoliberale Regierung unter Margaret Thatcher polarisierte nicht nur in sozialer Hinsicht. In ihrem Windschatten formierte sich eine militant auftretende Straßen-Rechte, deren Ausläufer in Form der Skinheads auch in die neue Jugendbewegung hineinreichten. The Clash und andere Bands setzten hier ein Gegenzeichen. Vom Text her beschreibt »London Calling« ein apokalyptisches London – gezeichnet von Atomkraftwerk-Unfällen, Riots sowie sozialem Elend. Der Refrain ist kämpferisch gestimmt; er appelliert, sich mit Gleichgesinnten zusammenzutun. Die Titelzeile ist einer alten BBC-Parole entliehen und hier quasi gegen den Strich gebürstet. Die entschiedene Haltung wird durch das Video zum Song unterstrichen. Strummer und Mitstreiter stehen in Formation; der Clip selbst ist in grobkörnigem Schwarzweiß. Nichts hier ist beschönigt – das Stück ist ein einziger Weckruf, und so wurde es seinerzeits auch rezipiert.
Links, gegen den Strich gebürstet und renitent blieben The Clash auch in späteren Jahren. Als Combo hielten sie bis 1985 durch. Frontman Joe Strummer, verstorben im Sommer 2002, spielte »London Calling« auch zu späteren Gelegenheiten. Bemerkenswert ist die Version anlässlich seines Gastspiels bei den Pogues. Die – ebenfalls aus der Szene um die Pistols hervorgegangene – Folkpunk-Formation hatte ihren delirierend-genialen (oder: genial-delirierenden) Sänger Shane McGowan 1991 rausgeschmissen und benötigte dringend Ersatz. Ob Strummer für die Pogues-Backlist ein adäquater Ersatz war, ist Ansichtssache. Seine mit den Experten des irisch durchschwängerten LmaA-Lieds dargebotenen Live-Versionen von »London Calling« gehören jedoch zum besten Stil-Crossover, welchen die britische Rockszenerie Anfang der Neunziger zu bieten hatte.
Der Song selbst war zu jener Zeit längst zum Grundrepertoire aller links- bis linksautonomen Bewegungen avanciert. Wie weitgehend dieses einzelne Stück die Scheidelinie markierte zwischen dem sich stärker politisierenden Teil der Punk-Bewegung und jenen, für die einfach Sex & Drugs & Rock’n’Roll ihr Ding blieb, wird sich vermutlich nie klären lassen. Auch der Punk – jene Musik, welche die Rockmusik umgestülpt hatte wie kaum eine Richtung zuvor – verabschiedete sich ab Mitte der Achziger Jahre zunehmend von der Bühne. Was er hinterließ, waren unterschiedliche Scenes und Sub-Scenes: Hausbesetzer, Autonome, Lifestyle- und Straßenpunks. Und schließlich eine Richtung, die – unter dem Label New Wave; umgangssprachlich auch einfach: Wave – die Chose zuerst auf eine breitere Grundlage stellte, später jedoch ein eigenes Großgenre ausformte: Gothic.
Boys Don’t Cry
Zumindest textlich scheint es auf den ersten Blick keinen größeren Gegensatz zu geben zwischen dem auf politische message gebürsteten The-Clash-Klassiker und »Boys Don’t Cry« von The Cure. Historisch steht die 1979 erfolgte Single zwischen dem ersten Album der Band und dem zweiten. Pophistoriker verorten den treibend-melancholischen Gitarrensound, welcher zum erstrangigen Wiedererkennungsmerkmal der Band avancierte, als den Scheidepunkt zwischen Punk und New Wave. Der Text von »Boys Don’t Cry« ist selbst für heutige Verhältnisse ein Offenbarungseid: das rückhaltlose Geständnis eines Mannes an seine Ex-Geliebte, dass er sich wie ein Arschloch verhalten hat, demzufolge selbst Schuld daran ist, dass sie mit ihm Schluss gemacht hat und er – darüber weinen möchte, es allerdings nicht kann. Weil: Männer weinen eben nicht.
Vom Kampf-Impetus der Clash waren The Cure damit Lichtjahre entfernt. Nichtsdestotrotz wurde »Boys Don’t Cry« zu einem Allzeit-Klassiker der Band, zu dem Erkennungsstück von The Cure schlechthin. Ebenso wie The Clash wurden auch The Cure im Umfeld der Sex Pistols groß. Die Richtung des Gothic begründete die Band fast im Ein-Mann-Alleingang. Robert Smith, Sänger, Gitarrist und Songschreiber, gab den Cure nicht nur sein unverwechselbares Gesicht und eben den typischen melancholischen Weltschmerz-Sound. Als Aushelfer beförderte er auch die Karriere der zweiten maßgebenden Gothic-Band: Siouxsie & The Banshees. »Boys Don’t Cry« war dabei nicht mal der paradigmische Song der Band schlechthin. Weitaus typischer für den Cure-Sound war die langgestreckte, in Sachen Gitarren-Weltuntergangsriffs sicher ergiebigere Gruftieeloge »The Forest« – ebenfalls eine Auskoppelung aus dem Highlight-Album »Three Imaginary Boys«. Smith selbst indess wurde im Lauf der Jahre zum fleischgewordenen Sinnbild aller (Rock)-Männer, die weinen möchten, es aber nicht können.
Dass The Cure am Anfang jener Stil-Hauptrichtung standen, die später unter dem Label »Gothic« firmierte, ist insofern weniger verwunderlich als konsequent. Man könnte auch sagen: Smith und the Cure hatten es darauf angelegt – von Anfang an. Sowohl programmatisch als auch lebensweltlich sowie vom Outfit her schieden sich Punks und »Grufties« zunehmend voneinander. In den Neunziger Jahren hatte die »Schwarze Szene« – »New Wave« war zu der Zeit bereits Schnee von gestern – endgültig ihre Eigenständigkeit erreicht. Auffällig ist die Diskrepanz, was die bemerkenswerten Cover-Versionen anbelangt. Anders als der Clash-Klassiker blieb »Boys Don’t Cry« seiner Szene verhaftet. Sicherlich gibt es vom künstlerischen Aspekt her bemerkenswerte Einspielungen. Was die Genres anbelangt, machte der Song allerdings nie derart die Runde wie der Klassenkampf-Appell der Kollegen um Strummer & Co.
Das Öffentliche und das Persönliche
Straight-links oder divers? Im Rückblick ist es bezeichnend, dass zwar beide Songs sich bis heute »gehalten« haben – allerdings mit unterschiedlicher Bedeutung und mit unterschiedlichem Kontext. Als Betrachter muß ich mich selbstkritisch fragen, ob ich in Sachen Songvergleich der geeignete Objektivierer bin. Sicher: Ich mag – und das bis heute – beide. Allerdings war mein Zugang schon in den Achtzigern ein, nunja: vielleicht besonderer. Der auf Programmatik getrimmte Clash-Song fungierte in den Achtzigern als Erkennungshymne für alle, die mehr als nur DKP- oder sonstwie traditionslinks sein wollten. The Clash – und damit auch »London Calling« – waren Programmatik: politische Programmatik und Lebensgefühl in einem. Keine Fete, auf der »London Calling« – vielleicht im Gleichklang mit Nina Hagens »Auf’m Bahnhof Zoo« – nicht hoch und runter genudelt wurde. Fast – für ein paar Jahre – sah es so aus, als ob der von der Punk-Welle entfachte Blitzkrieg die Welt entern würde: musikalisch vorgegriffen auch diesmal wieder von Nina Hagen, die im Clip oben Frankieboy Sinatras Crooner-Schnulze »My Way« mal eben vom Kopf auf Berliner Füße stellt.
The Cure waren exklusiver und – gleichzeitig, in meinem Fall – banaler. Zwei, drei Thekenbedienungen meiner damaligen Stammkneipe hatten ein Faible für die wavigen Gruftie-Rocker. Hinterfragbar war das wenig: Ebenso wie heute die iTunes-Songliste die kneipentechnische Hintergrundbeschallung steuert, so taten das damals Cassetten – rückblickend die noch bessere Ausrede, nicht am Laufmeter den Sound zu wechseln. Wie auch immer: Die Cassettenvorlieben von Conny und Lisa brachten mich im konkreten Fall auf den Geschmack – und adelten den Sound von The Cure zu einer Art Soundtrack, der als Hintergrundrauschen über Jahre mitschwang. Im musikalisch-politisch verfeinerten Rückblick von heute ist frappierend, wie gut beide Songs nach wie vor funktionieren. »London Calling« hat sich als Hymne verselbständigt; als Kracher funktioniert es bei einem Stadionrock-Hochkaräter wie Bruce Springsteen ebenso wie bei begrenzt bekannten Politpunk-Combos oder Straßenmusikant(inn)en. Wenn man so will, transportiert das Stück eine zeitlose klassenkämpferische – oder jedenfalls: entschieden Gesellschafts-unkonforme – Haltung. »Boys Don’t Cry« funktioniert anders. Nicht nur, weil sein Schöpfer nach wie vor als der ungekrönte König des nah am Wasser gebauten Weltschmerzes durch die Lande tourt. Auch politisch ist das Stück hochaktuell. Man muß die Brücke nicht schlagen zur Subkultur der Emos oder heutigen Ansätzen im Queer-Milieu. Dass männliche Gefühlswelten – auch für Männer – oft toxisch sind, ist mittlerweile immer stärker Allgemeinplatz. Nirgends wird dieser »Point of View« wohl politischer als da, wo man das politische Wirken echter Männer vom Schlag Trump oder Erdogan in live beobachten kann.
So bleibt der Popmusik auch hier ihre (widerspruchsvolle) Dialektik erhalten: »London Calling« rekurriert auf linkes Klassenkampfdenken – insofern auf das Soziale, die nach außen gerichtete Komponente. »Boys Don’t Cry« hingegen betont die (männliche) Innerlichkeit, ist insofern klar identitätspolitisch ausgerichtet. Eine Binse sicher, dass das Strömenlassen der Tränen uns Rechtspopulisten und soziale Schieflagen nicht vom Hals schafft. Ebenso sicher ist allerdings, dass die von Smith & Co. songtechnisch zugespitzte Problematik weiterhin virulent bleibt: spätestens dann, wenn wieder mal eine Frau einem Partner den Laufpass gegeben hat – und die Tränen partout nicht fließen wollen.
Mashups (siehe Wikipedia) sind Samplings, bei denen zwei oder mehr Musikstücke zu einem zusammengesamplet werden. Die »Mashup«-Textreihe kapriziert sich auf Schlüsselsongs – wobei in jeder Folge zwei vergleichbare Popmusik-Stücke im Mittelpunkt stehen.
Bisherige Folgen: (1) Hardrock versus Country | (2) Stones versus Dylan | (3) Feuerzeugballaden | (4) Funk versus Soul | (5) Wader versus Scherben
In der nächsten Folge begeben wir uns auf die Spuren von Janis, Jim & Co. Titel: »Mashup Vol. 7: der »Klub 27«

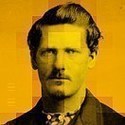




Was ist Ihre Meinung?
Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.