Die Geschichte der Reggae-Musik? Nimmt man sie ernst (was man sollte), läßt sie sich kaum anders erzählen denn als aberwitziges, verschlungenes und in sich widersprüchliches Hauptkapitel aus dem großen Buch der Pop- und Rockmusik-Annalen. Rock’n’Roll – oder irgendwas vom allseits bekannten Hauptstamm – war Reggae lediglich in stark bedingter Form. Die irrsinnigen, breitbeinig die Bühne zu eben ihrer Bühne machenden Gitarrenheroes beehrte er mit einem neugierigen, nicht allzu beeindruckten Interesse. Stattdessen schickte er einen Freak mit Rastalocken auf selbige, Jesus-gleich und gleichzeitig ein etwas friedlicherer jüngerer Bruder von Che Guevara: Bob Marley – Superstar ever und im globalen Süden bis heute der mit Abstand beliebteste Popmusiker. Eines war bereits in den Siebzigern klar: Der Reggae war gekommen, um zu bleiben. In sich war er ein Gewächs der Dritten Welt – irgendwas zwischen Kingston, Kinshasa und Addis Adeba. Ebenso jedoch war er Fleisch von unserem Fleisch: Die Kifferschwaden auf den Festivals waren da der beste Beweis. Nimm es leicht, Maahn. Es ist wahr: Kaum ein Sound war bislang so entspannt gekommen. Der Rhythmus schien taktgenau auf den Herzschlag abgestimmt. Die panafrikanischen Farben schließlich – Grün, Gelb und Rot? Auch wenn die Aufbauhilfe-Brigaden für Nicaragua damals noch in der Zukunft lagen, lagen sie ebenso im Trend wie das Bewußtsein für die Eine Welt sowie die Entschlossenheit, die einfarbige Sichtweise der Mächtigen und Spießer hinter sich zu lassen. Anders gesagt: Auch wir Weißbrötchen waren damals alle ein bisschen »Rastafari«.
Mento, Ska & Rocksteady
Zweifelsohne verdankte der Reggae seinen internationalen Durchbruch Bob Marley. Der Dreh ist allerdings, dass die jamaikanische Popmusik an dem Punkt, an dem Marley ins Spiel kam, bereits ein paar Pirouetten der waghalsigsten Natur hinter sich hatte. Womit an der Stelle der nötige Disclaimer fällig wäre: Diejenigen, die bereits die Geschichte der normalen Popmusik für kompliziert ohne Ende halten, hören an diesem Punkt am besten mit dem Lesen auf. Ursuppe, wenn man so will, ist eine Lokalvariante der karibischen Popmusik: Mento. Mento klingt – Gruß an der Stelle an Mr. Harry Belafonte – ähnlich wie Calypso, ist gleichfalls entspannt; man sieht die karibischen Palmenspitzen am Strand geradezu wedeln. Entstanden irgendwann in den Dreißigern, war Mento in den Fünfzigern der Popsound der vormaligen Zuckerinsel. Wie er – vielleicht – damals geklungen hat, zeigen die Einspielungen der Jolly Boys: ein paar Oldies, die damals schon mitmischten und hier eine Coverversion von Amy Winehouses »Rehab« zum Besten geben.
Warum führte der Mento nicht geradewegs zum Reggae? Das wäre die einfache, naheliegende Lösung gewesen. Doch im Leben ist selten etwas einfach. Als erstes stellten die lokalen Musiker und DJs fest, dass die angesagte US-Musik auf ihrer Insel nicht funktionierte. Rock’n’Roll floppte also; der originäre Popsound der Afroamerikaner – Rhythm and Blues – erwies sich hingegen als ganz brauchbar. Bezeichend für die Stile der Folgedekaden ist der Offbeat – das Überspringen eines Taktes: ein Effekt, der einen ganz speziellen treibenden Rhythmus zur Folge hat. Als erstes kam Ska. Ska war nicht nur schnell, laut, treibend und extrem tanzbar. Er avancierte auch zum ersten Musik-Exportartikel Jamaikas. In den Sechzigern landete die Ska-Welle an den Gestaden der britischen Insel. Die Mods und Skins dort – grosso modo also die ansässige Arbeiterklassenjugend – waren musikalisch gleichermaßen rassenblind wie musikalisch multiple. Inspiration (und Platten) holten sie sich ebenso aus den Heartlands des US-amerikanischen Soul. Importierte Rare- und Northern-Soul-Scheiben schlossen so das erste globale Dreieck interkultureller Popmusik-Adaption. Die Ausmusterung des Ska auf der karibischen Heimatinsel vollzog sich aus ganz profanen Gründen. Ende der Sechziger grassierte auf Jamaika eine Hitzewelle. Die Tänzer bewältigten das schnelle Tempo nicht mehr; auch das Gewaltlevel bei den Tanzevents stieg in unerfreuliche Höhen. Die nächste Station war somit Rocksteady, eine heruntergepegelte Version des Ska – und mehr oder weniger jene Variante jamaikanischer Popmusik, die Ende der Sechziger schließlich in den internationalen Hitparaden landete.
Peacy und entspannt waren die Hauptstadt Kingston und das umgebende Inselumland zu der Zeit weniger. Allerdings stand eine hungrige Generation junger Musiker in den Startlöchern – experimentierfreudig bis zum Anschlag und gern auch mal einen musikalischen Zwischenschritt überspringend wie oben im Clip Toots & The Maytals mit ihrem »Funky Kingston«. Die Infrastruktur von »Funky Kingston« gab es her, und so reussierten von dort bald auch einige international bekannte Acts. Zwei davon waren Desmond Dekker und Jimmy Cliff. Dekker schaffte es 1967 mit »Israelites« in die Hitparaden. Das Stück verwies bereits auf einige Grundthemen des Reggae – Geldsorgen, Armut sowie die Erlösung der Israeliten aus dem babylonischen Exil. Von Jimmy Cliff blieb vor allem der Antikriegssong »Vietnam« (1969) bleibend im Gedächtnis. Den ultimativ realistischen Blick auf die Musikszene Jamaikas lieferte er drei Jahre darauf ab in dem Film »The Harder They Come«. Der entwickelte sich zwar nicht gerade zu dem, was man einen Kinofeger nennen würde. Dafür warf er ein Spotlight auf die Lebenssituation damaliger Musiker. Die Story im Kurzdurchgang: Ein Musiker verdient sich das Geld zum Aufnehmen einer Single mit Marihuana-Handel. Die Single – das Titelstück »The Harder They Come« – wird zum Erfolg, der arme Schlucker von vordem zum Volksheld. Der nun leider von der Polizei gesucht wird. Ein klassisches B-Movie also – das folgerichtig so endete, wie derlei Geschichten eben enden. Womit nunmehr, Anfang der Siebziger, alles zusammen war, was den späteren Reggae ausmachte: Armut, eine atemberaubende Musik, die nötigen Musiker und schließlich eine Mission, die den Siegeszug des Reggae flankierte: Rastafari – der Glaube an den äthiopischen Kaiser Haile Selassie und ein in der Bibel versprochenes Reich der Schwarzen in Afrika.
Marley & Tosh
Toots & The Maytals, Jimmy Cliff, Desmond Dekker, Bob Marley, Peter Tosh und hinzukommend ein paar innovative Produzenten wie etwa Lee »Scratch« Perry oder der Brite Chris Blackwell, Mitbegründer des Labels Island Records – Anfang der Siebziger war dies eine Frucht, die zum Platzen reif war. Und wieder wurde es – erst – kompliziert. Dominierende Richtung im Reggae war mittlerweile der Roots Reggae – eine politisierte und mit Elementen des Rastafari-Heilsglauben angereicherte Variante des neuen Stils. In den Dreißiger Jahren entstanden, führte dieser an die koptische Form des Christentums angelehnte Volksglaube mehrere Elemente zusammen: den Glauben, dass die Schwarzen das auserwählte Volk Israels seien, den Glauben an die Gottähnlichkeit des weiter oben bereits erwähnten äthiopischen Noch-Kaisers und, politisch, einen stark präsenten, auf die »Back-to-Africa«-Bewegung des Jamaikaners Marcus Garvey zurückgehenden Panafrikanismus. Zum Superstar des Roots Reggae avancierte bald Bob Marley. Öffentlich kam Marley stets als der nette Kerl von nebenan rüber. Seine Stücke indess waren in Songs gegossene politische Botschaften – speziell die Parade-Hymne aus dem Jahr 1973: »Get Up, Stand Up«. Spätestens mit ihr erklomm der Roots Reggae die Ebene der politischen Plattform. Geschrieben hatte Marley das Stück anlässlich eines Aufenthaltes in Haiti. Thema: die skandalösen politischen Verhältnisse unter der Diktatur Duvalier – gegen die Marley eine einfache, allgemeinverständliche Botschaft setzte: »Steht auf! Erhebt euch!«
Wie Marley hierzulande rezipiert wurde, war eine andere Frage. Sicherlich – »I Shot the Sheriff« war von einem Kaliber, dass selbst Johnny Cashs berühmten »Folsom Prison Blues« in die Cowboystiefel stellte. Popularisiert hatte den Titel zudem Eric Clapton – einer aus der Riege der weißen Gitarrengötter. Aber – war das noch emanzipativ, wo man doch eher in die gewaltfreie Richtung unterwegs war? Noch komplizierter wurde es mit einem anderen Marley-Standard: »No Woman, No Cry«. Langsam säte sich die Saat der Mißverständnisse aus, die in der späteren Geschichte des Reggae noch für einige Diskussionen sorgen sollten. Sie basierten nicht unwesentlich auf dem Umstand, dass weiße Reggae-Rezipienten die Texte des Reggae eins zu eins nahmen und die zugrundeliegende Kreol-Sprache (das jamaikanische Patois) ignorierten. Wie auch immer: Um die Jahrzehntmitte war Bob Marley auch im Westen allseits gefeierter Popstar. Auf Jamaika hingegen geriet der neue Gott der Popmusik mehr in problematische Gefilde. So nahm es ihm ein Teil seiner Fans übel, dass er versuchte, einen Friedenschluss zwischen den beiden notorisch miteinander verfeindeten jamaikanischen Parteien – den Konservativen von der Labour Party und den zeitweilig prosowjetisch gestimmten Sozialdemokraten von der People’s National Party – zuwege zu bringen. Das Ende vom Lied: Am Ende überlebte der größte Musiker Jamaikas zwar einen Mordanschlag auf sich und seine Familie. Dafür ereilte ihn wenige Jahre später die Krankheit des weißen Mannes: Krebs. Am 11. Mai 1981 verstarb er im Jackson Memorial Hospital in Miami, Florida.
Während Bob Marley am Ende friedlich in seinem Bett starb, ereilte seinen Wailers-Bandkollegen Peter Tosh am Ende tatsächlich der Tod durch die Kugel. Zum richtig überragenden Idol – wie Marley – avancierte Tosh nie. Allerdings brachte er, nachdem er sich von Marley und den Wailers getrennt hatte, ein musikalisches Gesamtkunstwerk auf die Beine, dass allenfalls im Volumen dem seines ehemaligen Bandleaders nachstand. Sein wohl bekanntester Song ist »Johnny B. Goode« – eine Auskoppelung aus der 1983 erschienenen LP »Mama Africa«. Obwohl man es kaum glauben mag, handelt es sich dabei tatsächlich um eine Coverversion des gleichnamigen Chuck-Berry-Titels. Selbst die Textversionen weichen lediglich in unwesentlichen Details voneinander ab. Inhalt: Berrys Thema Nummer eins – die Rock’n’Roll-Geschichte vom Außenseiter, der gewillt ist, es der Welt zu zeigen und groß rauszukommen. Beachtenswert ist der Sound: Toshs »Johnny B. Goode« ist in einem Ausmaß »eingereggaet«, dass musikalische Ähnlichkeiten mit dem Original kaum noch erkennbar sind. Abgesehen davon ist es ein wunderbarer, Liebe, Frieden (und natürlich unbändige Tanzwut) verbreitender Song. Peter Tosh ist dem Leben, dem er tendenziell entkommen wollte, am Ende doch nicht entkommen. Am 11. September 1987 drangen drei Kleingangster in das Appartement seiner Familie ein und verlangten Geld. Sie bedrohten die Familie, töteten Tosh schließlich im Anblick der immer größer werdenden Menge vor dem Haus und schossen sich den Fluchtweg frei. Der Rest: seine letzte, posthum erschienene LP, darunter auch der hundertprozentige Rastafari-Bekenntnissong »Testify«.
Lavilliers
Im weitesten Sinn war es das Amalgam aus Armut, politischer Korruption und politisch desaströsen Zuständen, welches Peter Tosh das Leben gekostet hatte. Ende der Achziger setzte zunehmend der Exodus substanzieller (oder jedenfalls systemkritischer) Musiker von der Insel ein. Der Reggae – oder allgemeiner: die Popmusik aus Jamaika – veränderte wieder einmal ihre Gestalt. Während die Arbeiterklassejugend im Vereinigten Königreich mit Roots Reggae wenig anfangen konnte und in Teilen zunehmend nach rechts abdriftete, adaptierten die Linken die Sounds aus Jamaika nachgerade rückhaltlos. Ein weiteres Moment war, dass Reggae zwischenzeitlich zur internationalen Angelegenheit avanciert war. Auftritt: Bernard Lavilliers. Der 1946 geborene, aus soliden Mittelstandsverhältnissen stammende Franzose stellte schon früh sein Talent unter Beweis, sich auf robust-nachhaltige Weise mit den Autoritäten anzulegen. Sein Leben unter den Outcasts der Sechzigerjahre-Gesellschaft beschrieb er rückblickend mit den Worten: »In dieser Periode meines Lebens suchte ich mich selbst: ich wusste nicht, ob ich Gangster, Boxer oder Dichter sein würde.«
Am Ende wurde Lavilliers Chansonnier. Wie für nicht wenige Künstler seiner Generation wurde die Kommunistische Partei für ihn zum festen Ankerpunkt. Lavilliers spielte bei Betriebsbesetzungen auf, absolvierte weiter Reisen, schlug sich als Bettler und Gelegenheitsarbeiter durch und gab Auftritte in kleineren Clubs. Peu à peu kam schließlich der Erfolg. »Stand the Ghetto«, ein aus dem Album »O Gringo« ausgekoppelter Reggae-Tanzflächenmagnet, war ein Produkt der Reisen, die er weiterhin auf extensive Weise durchzog. Um sich auf die Spuren des Reggae zu begeben, hatte Lavilliers 1979 einen längeren Trip nach Jamaika absolviert und sich in Kingston, direkt gegenüber dem berüchtigten Knast Gun Court Prison einquartiert. Musikalisch ist die Nummer Roots Reggae vom Feinsten; ungewöhnlich damals war lediglich die französische Sprache. Textlich ist das Stück eine einzige Liebeserklärung: an die Insel, ihre Musik, ihre Bewohner. Romantik verkneift es sich. Die Impressionen sind geradezu in Van-Gogh’scher Manier hingepinselt; gleißende Schönheit ist nur hundert Meter von ebenso gleißendem Schrecken entfernt. Zusammengefasst in der letzten Strophe klingt das so: »Ich und ich lieben die Insel in der Sonne // Ich und ich wissen wann und wohin ich gehe // Aber es ist so schwer, meine Kinder zu ernähren // Aber es ist so schwer, das Ghetto zu ertragen.«
»I and I« – da war es wieder: das ans Kollektiv appellierende Doppel-Ich im Reggae-Slang. Unprätentiös und auf eigenen Pfaden wandelnd hatte der französische Außenseiter-Chansonnier so zu Marley, Tosh & Co. aufgeschlossen. Da Reggae nie als kurz-pointiertes Protest-Chanson konzipiert war, sondern vorrangig als Tanzmusik, müssen wir schließlich über Titellängen reden. In der üblichen Singlelänge-Version spielen sowohl Peter Toshs »Johnny B. Goode« als auch Bernard Lavilliers »Stand the Ghetto« unterhalb ihrer Möglichkeiten. Tiefen-Sog entfalten sie lediglich in den Long- und Extended-Versions. Interessant ist auch das Thema Cover-Versionen. Bei »Johnny B. Goode« muß es naturgemäß flachfallen – weil Peter Toshs Stück bereits die Adaption eines Chuck-Berry-Titels ist. Bei »Stand the Ghetto« wird man lange suchen müssen, um eine Coverversion auf Augenhöhe mit dem Original zu finden. Bemerkenswert ist eine Aufführung auf dem 21e festival Nuits de Champagne im Jahr 2008, bewerkstelligt von einem mehrhundertköpfigen Chorensemble. Falls noch ein Beweis erforderlich wäre, dass der Reggae-Groove auch in der Mitte der europäischen Normalgesellschaften Einzug gehalten hat, dann könnte die Suche danach ungefähr hier beginnen.
Tiken Jah Fakoly und der Rest
Man könnte nunmehr übergehen zu den modernen Formen der Reggae Music – also Dub, Dancehall und Raggamuffin. Historisch wäre das korrekt. Allerdings würde es einen nicht unwesentlichen Aspekt außer Acht lassen – den, dass Reggae zwischenzeitlich ein globalisierter Stil ist. Bleiben wir somit in Frankreich – respektive: seinen ehemaligen afrikanischen Kolonien. Reggae pur macht auch ein Künstler, der mit der jamaikanischen Musik lediglich in temporärer Form etwas zu tun hat. Tiken Jah Fakoly kommt von der westafrikanischen Elfenbeinküste. Geboren 1968, liegt er generationell eine Generation hinter Marley und Tosh. Musikalisch ist er klar im Roots Reggae verortet, politisch ebenso klar im Kampfmodus gegen die von Gewalt, Korruption, Armut und desolaten Regimes geprägten Zuständen in seiner Heimat. Noch stärker als Marley und Tosh, in deren Heimatland zumindest nominell demokratische Zustände herrschen, stieß Fakoly mit seinen Texten auf den Unmut der autokratisch regierenden Machthaber in seinem Land. Die Folge: immer wieder Exil, Zwischenstopps in Frankreich, Ausweichen in Nachbarländer. Den Bogen überspannt hatte er speziell mit seinem Stück »Franceafrique« – eine einzige in Ton gegossene Anklage gegen die kurzsichtig-eigennützige Afrikapolitik der Vereinigten Staaten und Frankreichs. »Le Pays Va Mal« (2002; siehe Clip unten) ist ein ähnliches Kaliber: eine Beschreibung der sozialen Fragmentierungen in seinem Heimatland – im Titel lapidar mit den Worten »Dem Land geht es schlecht« zusammengefasst.
Wenigstens erwähnt sei an der Stelle die Sting-Adaption »Africain à Paris«. Das Clip-Filmmaterial wurde großteils im zum Pariser Bezirk Montmartre gehörenden Afrikanerquartier Goutte d’Or aufgenommen. Textlich thematisiert es die Zwischen-Lebenswelt, die für afrikanische Flüchtlinge in Frankreich das Lebensrefugium (oder besser: -provisorium) bildet. Sicher ist die Stimme des Protests auch im internationalen Reggae nicht mit Marley und Tosh erloschen. Unvernehmbar – seit Jahrzehnten und bis heute – ist etwa die von Linton Kwesi Johnson. Der studierte Soziologe und Black-Panther-Sympatisant brachte nicht nur einen eindeutig linken Drive in den Reggae hinein – so etwa, indem er die Rastafari-Religion als reaktionär klassifizierte. Auch sein Sprechgesang weist hinaus in literarischere und gleichzeitig musikalisch zeitgemäßere Sphären. Im Wesentlichen hat die jamaikanische Popmusik zwei davon hervorgebracht: Dub und Dancehall. Das Kapitel »Dub« kann man kurz fassen. Ohne Dub mit seinen Sampling-Techniken, seinen Halls und Repetierungen ist zeitgenössische Popmusik undenkbar. Erfunden hat das Ganze Lee »Scratch« Perry – ein Mitstreiter von Marley und Tosh. Perrys langjährige Arbeit als Produzent, Musiker und DJ ist derart zentral, dass man sicher keinen großen Fehler begeht, wenn man seine genialen, im besten Sinn verrückten Einspielungen als Synonym setzt für Dub überhaupt. Anspieltipp hier, fresh from 2019: »Heaven & Hell«.
Womit es Zeit wäre, die Generation »Fünfzig minus« in die Geschichtsstunde mit zu integrieren. Zu berichten gibt es Gutes wie weniger Gutes. Ebenso wie in anderen Popmusik-Genres zog auch im Reggae der Frauenanteil ab den Neunzigern merklich an. Bekanntere Stücke aus dieser Ära: »Dread Natty Congo« von Sister Carol und »Telephone Love« von June C. Lodge. Für teils ziemlich unliebsame Phänomene sorgte der bislang neueste Nachfolger des Reggae: Dancehall oder Raggamuffin. Aufgegleist nach jamaikanischer Manier mit den einfachen zur Verfügung stehenden Mitteln, breiteten sich in diesen Adaptionen von Hip Hop, Disko sowie zeitgenössischem RnB zunehmend (auch) Frauenfeindlichkeit, Gewaltverherrlichung und Homophobie Bahn. Für Schlagzeilen sorgte ein 2010 von dem Grünen-Politiker Volker Beck mit unterstütztes EU-Einreiseverbot für den mit homophoben Statements auffällig gewordenen Dancehall-Künstler Sizzla. Die Kontroverse darum wurde unter anderem in der taz geführt (Beiträge: hier, hier und hier). Wenig zur Klärung eventuell produktiver Fragen tragen zwischenzeitlich auch die Ambitionen einiger antirassistischer Initiativen mit stark identitätspolitisch ausgerichteter Grundlage bei, die Dreadlocks und ähnliche Insignien der Reggae-Kultur lediglich nichtweißen Menschen vorbehalten wollen.
Volkspädagogische Ambitionen oder besser Naturschutzreservat? Der Reggae wird vermutlich auch die fürsorglichen Belagerungen aus (vorwiegend) weißer Aktivist*Innen-Ecke überstehen. »Cool« – jedenfalls im heute vorherrschenden Popdiskurs-Sinn, der sich ausschließlich an den Faktoren Ironie, Zitat und vielleicht noch Diversität abarbeitet – ist er mit Sicherheit nicht. Die Fan-Szene hingegen ist stabil, treu und ansonsten vielfältig. Ein vorsichtiges Fazit so: Aller Widersprüche ungeachtet hat kaum eine Region der Welt eine derart entspannte Musik geschenkt wie Jamaika. Subjektiv-persönlich hat Reggae auch den Beitragsautor in nicht unergeblichem Ausmaß auf seinem Weg begleitet. Weil es meistens besondere Anstöße braucht, ist diese »Mashup«-Folge dj puma gewidmet – der damals, in den großen Bewegungszeiten, mit Herz, Musikkenntnis und dem richtigen Fingerchen »Johnny B. Goode« und »Stand the Ghetto« zu den Herz- und Ankerstücken seiner Disko-Events gemacht hat. Es war eine gute Zeit – und wenn man solches über eine Musikrichtung sagen kann, ist sie mit Sicherheit eines nicht: fehl am Platz.
Mashups (siehe Wikipedia) sind Samplings, bei denen zwei oder mehr Musikstücke zu einem zusammengesamplet werden. Die »Mashup«-Textreihe kapriziert sich auf Schlüsselsongs – wobei in jeder Folge zwei vergleichbare Popmusik-Stücke im Mittelpunkt stehen.
Bisherige Folgen: (1) Hardrock versus Country | (2) Stones versus Dylan | (3) Feuerzeugballaden | (4) Funk versus Soul | (5) Wader versus Scherben | (6) Clash versus Cure( | (7) Der »Club 27«
Thema der nächsten Folge sind der Gorbatschow-Effekt in der Popmusik, die heile Welt der frühen und mittleren Siebziger, Glam Rock, T. Tex, Suzi Quatro und der nicht totzukriegende Erfolg eines Stücks namens »Venus«.

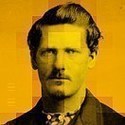




Was ist Ihre Meinung?
Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.