Die Zeiten sind manchmal ungerecht. Was heute überragend ist, ist morgen nur gewöhnlich. Gute Taten am Mittwoch bringen lediglich ein laues Danke, die vom Freitag hingegen Reichtum und Ansehen. So muß es der holländischen Musikformation Shocking Blue gegangen sein, als sie – wahrscheinlich so um ‘75 herum – einen Blick in die Glaskugel warf und dabei die verbliebenen Tantiemen durchzählte. »Eintagsfliege – haste einfach mal Pech gehabt«, würden Herzlose diesen Mechanismus kommentieren, und zusätzlich vielleicht noch »Komm – ich leg’ fuffzig Cent drauf« hinterher schieben. Dabei war die Formation um Sängerin Mariska Veres alles andere als ein Ein-Hit-Wunder. Echte und falsche Ein-Hit-Wunder hat es in der Geschichte der Popmusik zwar zuhauf gegeben. Insbesondere die Jahreswende 1969/70 wartete gleich mit einem halben Dutzend auf. Beispiele: die Archies mit »Sugar, Sugar«, Mungo Jerry mit »In the Summertime«, Don McLean mit »American Pie« und schließlich – der König aller Ein-Hit-Wunder – Norman Greenbaum mit seinem Einmal-Shuffle-und-er-war-nie-wieder-gesehen »Spirit in the Sky«. Doch Shocking Blue, liebe Güte: das war solider Rock – inklusive Vorgänger-Single, ein, zwei Nachfolgern im immerhin mittelprächtigen Bereich und dazu ein, zwei Alben. Der Pragmat würde sagen: Besser als nichts ist das allemal.
Erschwerend hinzu kommt, dass Pop- wie Rockmusik unterschiedliche Klassen des Scheiterns kennen. Der US-Sänger und Songschreiber Norman Greenbaum ließ es nach »Spirit in the Sky« einfach genug sein und erfüllte sich den Traum vom eigenen Restaurant. Dass er richtig abstürzte, verhinderte sein alter Hit. Dank Filmrechten für seinen alten Song berappelte er sich wieder, lebt in Santa Rosa nahe San Francisco und muß – zumindest laut Wikipedia – nie mehr arbeiten gehen. Andere haben die Launen von Publikum und Erfolg auf die harte Tour gelernt. Die Bluesband Canned Heat etwa habe ich vergleichsweise spät live erlebt – in den Achtzigern, lange nach ihrem auch König Droge geschuldeten Erfolgszenit. Location: ein eher abgeranzter und auch sonst überschaubarer Club im Vorort-Gürtel einer Hüttenstadt im Westen. Andere vormals bekannte Top-Acts mußten sich im Verlauf ihrer späteren, ähem, Karriere ebenfalls nach der vorhandenen Decke strecken. Wen das Altern von Popstars und das damit verbundene Herabschrauben der Ansprüche ernsthaft interessiert, dem sei der Independent-Movie »Crazy Heart« ans Herz gelegt. Es spielt zwar im Country-Metier. Mehr Sympathie für die Loser(innen) des Metiers geht allerdings kaum.
Manchmal liegt zwischen »Einhitwunder« und »Wegbereiter von XY« nur eine kleine Messerschneide – sagen wir: ein Jahr und/oder die richtigen Klamotten. In der Zeit selbst fällt das kaum auf. Zugegeben (und bitte nicht weitersagen): »Sugar, Sugar« von den Archies war meine allererste Single. »Venus« von Shocking Blue wanderte selbsredend ebenso auf den Plattenteller wie »Mendocino« von Sir Douglas Quintett und, ein, zwei Jahre später, »Hot Love« und »Get it on« von T. Tex. Der Unterschied: Während Shocking Blue zwar einen der Soundtrack-Songs für das Jugendjahr 1970 ablieferten, danach jedoch nichts mehr von vergleichbarer Relevanz, schüttelte Mr. Marc Bolan einmal das Reagenzglas und kreierte so einen neuen Stil. Das Erfolgsrezept: Während die Prog-Rocker im Zug der Nachwehen von 68 ff. immer avantgardistischer wurden, setzte Glam Rock auf Lebensfreude, tanzbare Rythmen sowie den eher nichtakademischen Teil der Jugend. Der Erfolg gab ihnen Recht. Obwohl »Venus« im Vergleich mit »Hot Love« der wahrscheinlich bessere, gehaltvollere Song ist, gehörte das Rampenlicht für einige Jahre den Glitzer-Boys und Glitzer-Girls. Reden wir also über Gerechtigkeit – und was selbige im Popbusiness bedeutet.
Venus
Eines lässt sich zugunsten der niederländischen Formation Shocking Blue zweifelsohne anführen: Mit Prog-Rock hatten sie eher wenig im Sinn. Geistiger Orientierungspunkt der 1967 gegründeten Band war die britische Rockmusik in ihrer mittleren Phase – nicht mehr ganz Beatles-Anfänge, allerdings auch noch nicht Cream. Einerseits war das auf sympathische Weise solide. Auch der Gedanke »aus der Zeit gefallen« wäre damals wohl niemandem gekommen (okay – ein paar Progrockern vielleicht schon; aber die zogen es wohlweislich vor zu schweigen). Es war die Zeit der Beat-Clubs und vor allem DES »Beat Club«. Das deutsche Fernsehen in Form des ARD-Senders Radio Bremen hatte sich quasi selbst überboten und ein Format aufgegleist, dass bis in die Siebziger das Avantgardistischste war, was die Öffentlich-Rechtlichen (die damals noch Monopolisten waren) sich geleistet haben. Das Konzept: eine recht zwanglose Moderatorin namens Uschi Nerke; Live-Bands, die live spielten (also ohne das damals fast obligatorische Playback) und eine konsequente Orientierung daran, was im United Kingdom und jenseits des großen Teichs damals angesagt war.
In dieses Setting platzten im Herbst 1969 Veres und ihre drei Mitstreiter. »Venus« zählt mit Sicherheit zu jenen Popsongs, bei denen das »Wie« mindestens ebenso wichtig ist wie das »Was«, also der textliche Inhalt. Der Text preist die Charakterzüge einer Frau an mit schwarzen Haaren – einer Verführerin, die alle Männer verrückt macht. Die Rolle der freien, sich um Vorurteile nicht scherenden Rocker-Braut war Mariska Veres wie auf den Leib geschnitten. Eine gewisse Vorliebe für die Nachbarn im nordwestlichen Nachbarland, ihre buchstäbliche Toleranz sowie gewisse Substanzen, die dort leicht erhältlich waren, spielte sicher ebenfalls eine gewisse Rolle. Alles kam gewissermaßen zu allem: Nachdem Großbritannien bereits entdeckt war, galt es nun, auch die unmittelbare Nachbarschaft einer genaueren Visite zu unterziehen. Entscheidend war allerdings das »Wie«. Kristallklar war nicht nur Veres’ Stimme. Die unprätentiöse Begleitung in E-Gitarre, Bass und Schlagzeug war es ebenso. Hundertachtzig Karat war schließlich der Song selbst – genauer: die Melodie, der Rhythmus. Nichts konterkarrierte hier irgendwas; Designtheoretiker würden sagen: Form Follows Function – Operation geglückt.
Geglückt war die Operation indess nur für wenige Jahre. Es folgten einige Anschlusssingles und auch Anschlussalben. An den Erfolg von »Venus« indess konnte die Gruppe nie mehr anknüpfen. Nach mehreren Umbesetzungen lösten sich Shocking Blue 1975 auf. Die obligatorischen Comeback-Versuche scheiterten; Sängerin Veres versuchte sich als Solo-Musikerin in einem Metier, dass für derlei Karrieren ebenfalls nicht unüblich ist: dem Jazz. Veres verstarb 2006. Was im Gedächtnis blieb, war der alte Hit – »Venus«. Unzählige Male gecovert, nistete sich »Venus« dauerhaft im kollektiven Gedächtnis der Rockmusik ein. Der treibende Beat des Stücks prädestiniert beim Cover-Einspielen zwar eher die härteren Stile – irgendwas an »Venus« ist sehr affin mit den Richtungen Gitarrenrock, Garagenrock und Punk. Beispiel: die Live-Einspielung der russischen Formation Rock’n’Roll Girls. Ähnliches gilt für die Dancefloor-Version der britischen 80r-Girlgroup Bananarama. Doch auch akustische Begleitung steht dem Song vorzüglich. Beispiel hier: die im Singer-Songwriter-Stil dargebotene Einspielung des Amateurduos Ellas.
Hot Love
Während Shocking Blue Hitparadenerfolge feierten, irrlichterte durch London ein gewisser Marc Bolan. Zwei Jahre zuvor hatte er die Formation Tyrannosaurus Rex gegründet und in der Folge bereits den ersten Reinfall seiner Rock’n’Roll-Karriere hinter sich gebracht. Tyrannosaurus Rex floppten; eine (voreilig) angesetzte US-Tournee geriet zum Desaster. Dass Bolan »Venus« mitbekam, ist wahrscheinlich; der Titel zog auch im UK seine Kreise. Musikalisch indes dürften ihn von den Holländern Welten getrennt haben. Zusammen mit seinem neuen Kumpel Mickey Finn brachte er gewagte Musik-Experimente auf den Weg (irgendwas zwischen Psychedelic und Folk), ernährte sich makrobiotisch und dachte vermutlich das ein oder andere Mal über seine weitere Zukunft nach. Bei etwa der 87. Tüte muß die zündende Idee gekommen sein. Die Formation, die sich bislang unter anderem mit Soundtrack-Arbeiten über Wasser gehalten hatte, benannte sich in T. Rex um und startete einen neuen Anlauf. Die erste Single erste funktionierte eher schlecht als recht, doch die zweite bombte. Womit wir bei »Hot Love« wären – und dem im Jahr darauf, 1972, veröffentlichten Anschlusshit »Get it on«.
Was war so faszinierend an dieser Musik? Vielleicht war es die Ambivalenz, die Gegensätze. Der Shuffle-Rythmus der beiden Songs ging zweifellos in die Beine. Hinzu kamen die beiden auf androgyn gestylten Frontmen der Formation. Vor allem Bolans nachlässiger, fast entrückter Gesang muß die Mädels (und sicher auch einige Jungs) um den Verstand gebracht haben. Was folgte, war eine wahre T-Rexo-Manie. Textlich bewegte sich »Hot Love« im üblichen Rockuniversum – heiße Liebe, garniert mit den üblichen Anzüglichkeiten. Wenn man so möchte, eine Art »Whole Lotta Love« für Softies. »Get it on« war aus ähnlicher Wolle gestrickt. Wenig verklausuliert beschrieb der Song eine kurvenreiche Wilde, die – glücklicherweise – das Mädchen des Sängers war. Der restliche Unterschied zwischen den beiden Stücken: Während »Get it on« auf die konventionelle Mixtur Rhythmus + Refrain setzt (und insofern das Odem das Nachfolgehits in sich trägt), entfaltete das in der zweiten Hälfte endloswiederholte »La-la-la-lalala« in »Hot Love« nachgerade magische Fähigkeiten. Wie oben im Clip zu sehen: Zumindest der Glam-Rock ist dem irdischen Paradieszustand kaum näher gekommen als in diesem Stück.
Das Bühnengebahren von Bolan und Finn verfestigte ebenfalls den Eindruck, dass es hier vor allem um die volle Show ging. Ähnliche Konzepte verfolgten damals auch andere. König der neuen Richtung war zeitweilig Alice Cooper – ein Britrocker, der ganz bewusst auf Schockeffekte aus war und mit seinen schwerlastigen Hardrock als Mit-Vorläufer des Heavy Metal gilt. So weit gingen T. Rex nicht. Bolan & Co. blieben, anders als Alice Cooper mit seinem »School’s out« wirklich Schulmädchen-kompatibel. Trotzdem brachten die Schminke, die Eyeliner, der Glitzer und die Bühnenshow ein neues Element in die Rockmusik. Wo die progressive Rockmusik immer anspruchsvoller und schwerer wurde, Ausflüge zu Konzeptalben und ins Feld der Klassik inklusive, betonten die Epigonen des neuen Glam Rock die einfachen Freuden des Lebens: einen drauf machen, durchaus auch mal über die Stränge schlagen, aber das Ganze auf keinen Fall zu schwer nehmen.
Glam Rock – from the Beginning to the End
T. Rex und Alice Cooper waren natürlich nicht die einzigen Epigonen der Anti-Bewegung, die ab 1971/72 auf den Plan trat. Vielmehr zeigt die Paraderevue der neuen Richtung eine Vielfalt, die später nur noch zu wenigen Gelegenheiten erreicht wurde. »Typisch Glam« waren vor allem Sweet sowie Mrs Suzi Quatro. Wenn man so will, dampften sie das Konzept von T. Rex noch weiter ein. Die Androgynität und das Spiel mit den Rollen blieb auf der Strecke; was blieb, war eine Disko-Mucke, die mit der Zeit einfach zunehmend langweiliger werden MUSSTE. Suzi Quatro war von der Regel sicherlich die löbliche Ausnahme. Angefangen hatte sie mit fetzigen Hinlegern der Sorte »Can the Can« und »48 Crash« (beide: 1973). Dass die musikalische Abwechslung bei der Art Songs irgendwann auf der Strecke bleiben würde, war einerseits zwar abzusehen. Allerdings brachte Mrs. Quatro einen klar femininen, um nicht zu sagen: feministischen Touch in die bislang von Männern dominierte Szene. Zudem erweiterte sie ab Mitte der Siebziger ihr Repertoire zunehmends mit Balladen. Beispiele: die beiden Titel »Stumble In« Und »If You Can’t Give Me Love« (beide: 1978). Gnade fand diese Form Rockmusik schließlich auch vor den Augen des großen Rockmusik-Skeptikers Erich Honecker. Beleg: einer der besten Quatro-Auftritte überhaupt – im Friedrichstadt-Palast anno 1988.
Möglich, dass den Glam Rock schon viel früher der Saft ausgegangen wäre. T. Tex schoben noch zwei, drei Singles nach. Das Konzept wiederholte sich indess. Bolan kam 1977 bei einem Autounfall ums Leben. Finn laborierte weiter in Sachen Musik (und Erfolg), verstarb allerdings drogeninduziert im Jahr 2004. Was blieb, war ein Konzept, dass in irgendeine Richtung weiterentwickelt werden MUSSTE. Metal war EINE denkbare Möglichkeit, doch die lag Mitte der Siebziger noch in der Zukunft. Eine andere okkupierten zwei bislang eher randständige Musiker der britischen Rockszene: Brian Ferry mit seiner Formation Roxy Musik und David Bowie. Vor allem Bowies weitere Karriere zeigte, dass das Spiel mit volatilen Identitäten auch als musikalisches Erfolgsrezept nutzbar gemacht werden konnte. Ob »Space Oddity«, »China Girl« oder das unschlagbare »Heroes« noch Glam Rock sind in der ursprünglichen Bedeutung, darüber kann man unterschiedlicher Meinung sein. (Der Autor dieses Beitrags tendiert zu der, dass Bowie & Co. eine eigene Güteklasse sind.)
Bemerkenswert sind die Fäden, die sich von Bowie & Co. zu weiteren Richtungen der Rockmusik zogen. Metal wurde bereits erwähnt. Stellt man das schrille Outfit der Glam-Rocker mit in Rechnung, ist es auch in Richtung aufgerauhter Spielarten wie beispielweise der von Kiss ein letztlich nur kleiner Schritt. Selbst zu Punk und Garagerock waren die Affinitäten recht groß. Beispiele: Iggy Pop, Bowies Kumpel zu Berliner Zeiten und Lou Reed, Mastermind überhaupt aller »undergroundigen« Rockarten. Mit etwas Fantasie ließe sich sogar Patti Smith auf Glam-Rock-Ursprünge zurückdeklinieren. Frage: Ergäbe das einen Sinn? Ich will zugeben, dass mehr Gründe dagegen als dafür sprechen. Bemerkenswert allerdings ist, wie viele musikalische Querverbindungen Marc Bolan mit seinem etwas anzüglichen Shuffle-Popschlager aufgleiste.
Lediglich Shocking Blue hatten bei alldem das Nachsehen. Wobei der Gerechtigkeitsgott der Rockmusik immerhin dafür gesorgt hat, dass die schwarzgewandete Venus auch heute, 50 Jahre später, nicht in Vergessenheit geraten ist.
Mashups (siehe Wikipedia) sind Samplings, bei denen zwei oder mehr Musikstücke zu einem zusammengesamplet werden. Die »Mashup«-Textreihe kapriziert sich auf Schlüsselsongs – wobei in jeder Folge zwei vergleichbare Popmusik-Stücke im Mittelpunkt stehen.
Bisherige Folgen: (1) Hardrock versus Country | (2) Stones versus Dylan | (3) Feuerzeugballaden | (4) Funk versus Soul | (5) Wader versus Scherben | (6) Clash versus Cure | (7) Der »Club 27« | (8) Reggae-Time
Thema der finalen Folge von Staffel 1 ist eine Musikrichtung, die die (deutsche) Gesellschaft nicht weniger zivilisiert hat als die berühmten 68er – Techno. Titel: »Raves & Bytes«.

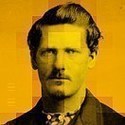




Was ist Ihre Meinung?
Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.