Mexiko hängt am Tropf. So zumindest der Eindruck, den die Schlagzeilen vermitteln. Die Ursachen sind multikausal. Das Verhältnis zum nördlichen Nachbarn ist notorisch angespannt. Zudem trudeln weite Teile der nördlichen Landeshälfte immer tiefer in den Strudel der Gewalt und des von den Drogensyndikaten aufgezwungenen de-facto-Bürgerkriegs. Wirtschaftlich steht Mexiko eher mittelprächtig da als prächtig. Zusätzlich in Rechnung stellen muß man die verbreitete Korruption. Erschwert wird die Konsolidierung unter anderem von den Wasserschulden, mit denen das Land beim Großen Bruder in der Kreide steht. Hintergrund: Bei den Wasserreserven des Rio Grande haben die Götter der Azteken oder das Schicksal die Yanquis eindeutig bevorzugt. Mit anderen Worten: Gingen alle Dinge ihren schlechten Lauf, müßte Mexiko längst am Boden liegen. Tut es aber nicht. Die Musik des Landes mit ihren vielfältigen Stilen ist dafür zwar sicher nicht der ursächliche Grund. Allerdings ermöglicht sie einen guten Zugang zu den Reserven, die dafür sorgen, dass Mexiko sich stetig weiter durchwurstelt.
Vom Corrido zum Narcocorrido
»Viva Mexico!« »Viva Villa!« »Viva Zapata!« Die Mexikanische Revolution von 1910 bis etwa 1920 ist nicht nur für den modernen mexikanischen Staat mit der wichtigste Referenzpunkt. Die revolutionären Ereignisse beförderten auch ein Genre, dass – mit Ausnahme vielleicht der Mariachi-Musik – prägend ist für die musikalische Landeskultur: der Corrido. Im Kern sind Corridos musikuntermalte Geschichten; der Vergleich mit europäischen Bänkelsongs geht sicherlich nicht fehl. Historisch lässt sich diese – ursprünglich aus Spanien stammende – Darbietungsform bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen. Im Verlauf der Revolution entstand ein eigenes Unter-Genre: die Revolutions-Corridos. Kaum ein halbwegs bekannter Anführer, dem nicht ein eigenes Lied gewidmet wurde. »La Cucaracha« etwa, eines der weltweit bekanntesten Corrido-Stücke, macht sich über den Interims-Dikator Victoriano Huerta lustig. Weitere (mehr oder weniger) bekannte Revolutions-Corridos: »Corrido de Pancho Villa« oder das in den Dreißigern entstandene Stück »Yo Me Muero Donde Quera«. Der Verlauf der Auseinandersetzungen – ein blutiges, insgesamt mehr als zehn Jahre andauerndes Gemetzel, in dem über weite Strecken schlecht bewaffnete Bauernarmeen gegen mit Artillerie und Maschinengewehren ausgestattete Regulares anrannten – verlieh auch einem bislang wenig in Erscheinung getretenen revolutionären Subjekt neue Bedeutung: den Frauen. Einige von ihnen – darunter Petra Herrera aka Pedro Herrera, Colonel in Pancho Villas Nordarmee – avancierten innerhalb der revolutionären Milizen gar zu veritablen Kommandeurinnen. Eines der bis heute beliebtesten Traditions-Lieder, welche die Rolle von Frauen in der Revolution thematisieren, ist »La Adelita«. Wer jene Adelita ist, welche der Songtexter anschmachtet, und ob die Person dahinter mehr war als eine Legende, ist nicht bekannt. Die Rolle der diversen Adelitas feiert allerdings eine Reihe weiterer populärer Lieder – beispielsweise »La Marieta« und »Las Soldaderas«.
Dass die aufgeführten Titel in einer einigermaßen modernisierten Form vorliegen, ist nicht unwesentlich das Verdienst von Amparo Ochoa. Die aus dem nordmexikanischen Bundesstaat Sinaloa stammende Sängerin spielte in den Siebzigern und Achtzigern eine ganze Reihe von Alben mit Revolutions-Corridos sowie thematisch verwandtem Liedmaterial ein – darunter das Gros der im letzten Abschnitt aufgeführten. Eine weitere Förderin dieser Tradition stammt von nördlich der Grenze: die US-amerikanische Country-Sängerin Linda Ronstadt. Ronstadt – für ihre Zusammenarbeit mit der Country-Ikone Emmylou Harris ebenso bekannt wie als Unterstützerin des kritischen Dokumentarfilmers Michael Moore – veröffentlichte in den späten Achtzigern zwei Alben, welche ihrer Hispanic-Herkunft musikalisch Tribut zollten: »Canciones de mi padre« und »Mas canciones«. »La rielera« – im Clip oben mit ebenso oppulenter wie stilechter Liveshow in Szene gesetzt – thematisiert die Geschicke einer Eisenbahnerin während der Revolutionsära und gehört ebenfalls zu jener Auswahl an Traditionals, auf die Interpret(inn)en immer wieder gern zurückgreifen.
In der Nach-Revolutionsära wurden die Corrido-Schreiber zunehmend arbeitslos. Getreu der Tradition, die Geschichten der Ausgestoßenen und Rebellen nachzuerzählen, suchten sie sich ein neues Sujet. Im Grunde beginnt die Geschichte des modernen, zeitgemäßen Corridos mit den Alkohol- und Marihuana-Schmugglern, welche den trockengelegten Prohibitions-Sumpf nördlich der Grenze mit frischer Ware belieferten. Als Schlüsselsong für den Übergang vom traditionellen Corrido zum Narcocorrido gilt »Contrabando y traición« aus dem Jahr 1974. Mit »contrabando« etablierten die aus San José, Kalifornien stammenden Los Tigres del Norte nicht nur einen frühen Klassiker des Genres. Mit einen stetig wachsenden Repertoire ähnlich gestrickter Songs sowie ihrem mit Rock-Elementen hochgetunten Norteño-Stil ist die Band eine der erfolgreichsten sowie langlebigsten Formationen im Metier. Allzuviel Nähe zum Unterwelt-Milieu der Narcotraficantes und ihrer Paten versuchen Sänger Jorge Hernández und seine Mitstreiter zwar zu vermeiden. Die Band sieht sich als Chronist – als Formation, welche die kriminellen Aktivitäten lediglich begleitet. Auch wenn Hernández auf die textlich eingebauten Verfremdungen pocht und bemerkt, dass die in einem Autoreifen versteckte Marihuanamenge in Real Life nicht einmal zum Decken der Spritkosten ausreiche, versteht das Publikum die Botschaft durchaus – wie Publikums-Beifall sowie hochgereckte manos cornutas bei einschlägigen Song-Höhepunkten unter Beweis stellen.
Hat man sich Narcocorrido-Interpreten als eine Art singende Kriminalreporter vorzustellen? Von Underdog-Romantik kann zwischenzeitlich nur noch wenig die Rede sein. An die Stelle des altbackenen Mariahuana-Schmuggels ist eine durchorganisierte Drogen-Ökonomie getreten – mit Koka, Meth, Waffen, Flüchtlingen sowie Frauen als neuen Erwerbsquellen. Die mexikanische Regierung geht gegen die Narcocorrido-Musik mit Airplay-Verboten sowie offener Zensur vor. Der Beliebtheit des Genres – vor allem bei den abgehängten Teilen der Jüngeren – tut das keinerlei Abbruch; im Gegenteil. Auch stilistisch befinden sich die neuen Narcocorrido-Interpreten auf der Höhe der Zeit. So hat das Aufkommen sogenannter Trap-Corridos (mit Samples sowie Hip Hop-Elementen gekreuzte Norteño- und Banda-Musik) sogar für eine partielle Entspannung der innerethnischen Gang-Rivalitäten im US-Südwesten gesorgt. Andererseits glorifizieren die Narcocorridos – Beispiel: El Komander und sein Genre-Hit »Leyenda M1« – ganz offen die Kultur der Gewalt, der entgrenzten Habgier sowie das zum Gangster-Lifestyle hinzugehörende machistische Frauenbild. Direkte Auftragsanfertigungen für die Drogenbosse sind mittlerweile ebenfalls Teil des Metiers. Ein unbekannter Narcocorridista kann dafür mehrere tausend US-Dollar einstreichen, eine bekannte Genregröße das fünf- bis zehnfache. Auf der sicheren Seite des Gesetzes leben allerdings auch Insider nicht. Bislang starben mehrere Dutzend Musiker eines gewaltsamen Todes. Highlight des diesbezüglichen Scheckens: die Entführung und Ermordung von 17 Mitgliedern der Tropical-Band Kombo Kolombia im Jahr 2013. Andererseits hat fast jede Geschichte ein »Aber«: So eröffnet die Ökonomie der Kartelle zumindest partiell und für Einzelne die Möglichkeit, zu relativ – manchmal sogar zu viel – Wohlstand zu gelangen.
Mariachis, Cumbia & Tropical
Im Gegensatz zu den Drogenmafia-Stücken darf sich die Mariachi-Musik jeder Menge staatlicher Protektion erfreuen. Beispiel: dieses von Polizeikapelle-Mitgliedern gestellte Flashmob-Platzkonzert in Mexico City. Auch sonst ist Mariachi in fast jeder Beziehung das Gegenteil des aufmüpfigen Corridos. Entstanden ist sie ungefähr zeitgleich. Traditionelle Basis ist der mexikanische Son, eine Mestizen- und Indigenen-Musik, die in fast jedem Bundesstaat ihre eigene Ausprägung hat. Porfirio Díaz, Mexikos langjähriger Diktator, verpasste den Son-aufspielenden Bauernkapellen den bis heute gültigen Look: breite Sombreros sowie ein Outfit, dass sich an dem wohlhabender Hazienda-Besitzer orientierte. Mariachi-Musik ist in Mexiko allgegenwärtig – vor allem in den zentralen und südlichen Landesteilen. Stark befördert wurde das Bild entsprechender Kapellen von Filmen der Dreißiger und Vierziger Jahre. Fazit: Mariachi ist manchmal urkomisch, oft sentimental, gelegentlich Blockbuster-tauglich und – das Wichtigste – aus dem mexikanischen Alltag kaum wegzudenken. Mariachis spielen auf Hochzeiten auf, privaten Parties, öffentlichen Veranstaltungen; desöfteren auch in Form eines Ständchens, welches der Liebhaber seiner Angebeteten unter dem Fenster zukommen lässt. Auch stilistisch ist diese Form Musik ungemein vielseitig. Beispiel für die traditionelle, mit viel Oppulenz ausgestattete Vortragsform: »La Charreada« (deutsch: »Das Rodeo«) – ein Ranchera-Traditional, dass hier von Sandra Gonzales in Begleitung der Kapelle El Mariachi Alas de Mexico de Guadalajara Jalisco zum Besten gegeben wird.
Wie unterscheidet man die vielen Stilrichtungen der mexikanischen Musik? Ein guter Orientierungspunkt ist die Hutmode. Im Norden bestimmen US-amerikanische Cowboyhüte das Bild. In der Mitte und im Süden hingegen sind – so »Hut« überhaupt sein muß – eher breite Somberos angesagt. Musikalisch ist die Spielweise der Cowboyhutträger – Hauptrichtungen: Norteño, Tex-Mex und Banda – stark von den Stil-Mitbringseln mitteleuropäischer Einwanderer durchsetzt: im Texas-nahen Abschnitt der Grenze von Akkordeon und Polka, weiter westlich von Blaskapellen südeuropäischen Zuschnitts. In den Landesteilen mit stärkerer Affinität zum bäuerlichen Sombrero hingegen werden die Gitarren-Ensembles oft von Streichern oder Bläser-Sets unterstützt; hinzu kommt der wie eine Gitarre am Bauch des Spielers hängende mexikanische Zupfbass. Überlagert wird dieses Grundschema durch die Einflüsse karibischer sowie kolumbianischer Musik. Hauptmerkmal hier: Die jeweiligen Horn Sections klingen eher nach Swing und Salsa als nach Blaskapelle oder dem Begleitorchester von André Rieu. Auch diese Einflüsse – zu nennen sind vor allem Bolero und Habanera (Kuba) sowie Cumbia (Kolumbien) – machen sich lokal unterschiedlich bemerkbar. Ein weiteres Unterscheidungsschema ist das Stadt–Land-Gefälle. Während traditionelle Musik vielerseits recht urtümlich (und indigen) daherkommt, offeriert der urbane Schlager oft die balladesk-schwermütige Schwüle südeuropäisch-spanischer Provinienz.
Eine Interpretin, die sowohl die Kargheit der klassischen Gitarrenballade als auch die Grandezza orchestraler Begleitung kannte, war Chavela Vargas. Die Grand Old Lady des Ranchera hat eine Karriere hingelegt, wie sie ein Quentin Tarantino nicht besser verfilmen könnte. In den Sechziger Jahren war die Sängerin mit der tiefen, markanten Stimme ein Star, den in Mexiko so gut wie jeder kannte. Ende der Achtziger erfolgte das Comeback: musikalische Mitarbeit bei dem Biografiefilm »Frida« (inklusive einer Neuauflage ihres Erfolgssongs »Paloma negra«), Auftritte in Filmen von Walter Saxer sowie Pedro Almodovar, neue Alben, Konzerte. In dem fast 20 Jahre umfassenden Zeitloch davor war Vargas abgesackt, vergessen und lebte mittellos in einer Gartenlaube. Ihr Tequila-Volumen in dieser Zeit: eigenen Angaben zufolge 45.000 Liter. Stilistisch ein wenig vergleichbar mit der 2012 verstorbenen Dame des großen Ausdrucks ist die aus Mexico City stammende Folksängerin Natalia Lafourcade. »La Llorona« (frei übersetzt: »die weinende Frau«) ist ein Traditional der mexikanischen Ballade. Chavela Vargas hatte es ebenfalls im Repertoire. In dem dazugehörigen Videoclip (siehe oben) kombiniert Lafourcade den vielinterpretierten Klassiker mit der ebenfalls klassischen Optik des Diá de Muertos, des mexikanischen Totensonntags.
Womit wir bei Lila Downs angelangt wären. Die 1968 im südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca geborene Sängerin ist derzeit der herausragende Superstar der mexikanischen Popmusik. Ebenso wie Chavela Vargas wirkte auch Lila Downs an dem Biografiefilm »Frida« mit. Ihre Jugend- und jungen Erwachsenenjahre verbrachte die Tochter eines schottisch-amerikanischen Vaters im Yankee-Land, genauer: in Minnesota und Südkalifornien. Zunächst begeistert von Grateful Dead und Jazz, wandte sie sich schließlich der Musik ihrer Heimat zu. Indigene Bestandteile sind ein fester Teil ihres Repertorires. Hinzu kommen Cumbia, Tropical sowie andere karibische Stile. Ebenso oppulent und durchchoreografiert wie ihre Live-Auftritte sind die Videoclips zu ihren jeweiligen Hits. Wie in ihrer Musik zeigt sich auch im Visuellen die Liebe zu Stil-Vielfalt und Details. Ihr Hit »La Cumbia del Mole« (siehe oben) ist einfach extrem tanzbarer Cumbia. »Urgo« wiederum ist eine tangoähnliche Latino-Ballade und »Zapata se queda« ein Stück, dessen Clip indigene Einflüsse mit quietschbunten Farben kombiniert. Ein Wort zu verlieren wäre schließlich noch über die Cumbia-Welle, der sich auch die Mexikaner und Mexikanerinnen schon seit längerem mit Begeisterung hingeben. Ursprünglich ein lokal auf Kolumbien beschränkter Musikstil, hat sich die »Cumbiamania« zwischenzeitlich über den gesamten Kontinent ausgebreitet. Mit kubanischen Klängen ist die mexikanische Popularmusik schon aus nachbarschaftlichen Gründen eng verquickt. So verstarb die kubanische Sängerin Lupe Victoria Yolí Raymond aka »La Lupe« 1992 im mexikanischen Exil. Ihre Landsfrau, Salsa-Königin Celia Cruz, nutzte mexikanisches Territorium hingegen als künstlerisch-kreativen Zwischenstopp.
Rock, Punk, Banda & Nortec
Als alltagskulturell eher randständig – zumindest im Vergleich zum nördlichen Nachbarn – präsentiert sich hingegen das politische Lied. Unter den Bezeichnungen Canto Nuevo oder Canción de protesta hat die Tradition des zeitkritischen Songs zwar auch in Heimat der Azteken und Mayas seine Spuren hinterlassen. Mit der Folksinger- und Liedermacher-Szene der Vereinigten Staaten oder Europas lässt sich die Szenerie allerdings nur schwer vergleichen. Herausragende Persönlichkeit unter den kritischen Liedermachern Mexikos ist der 1935 geborene Óscar Chávez. Anders als seine Kollegin Amparo Ochoa widmete sich Chávez nicht der Traditionspflege, sondern kultivierte in seinen Songs die politische Klartextansage – beispielsweise in seinem Song »Macondo« aus dem Jahr 1969. Ebenfalls schwer hatten es in den Sechzigern und Siebzigern die ersten zarten Sprossen der Rockmusik. Nicht nur, dass die intellektuell-linkspolitisch geprägten Akteure des Canto Nuevo zur Rockmusik ähnlich auf Abstand gingen wie puritanistisch gestimmte US-Folksinger seinerzeitig zu Dylan, den Byrds & Co. Einig war man sich mit der regierenden PRI zudem in der Einschätzung, die Rockmusik sei ein imperialistisches Produkt des großen Bruders im Norden. Deshalb – so das Argument der Revolutions-Nachlassverwalter in der Partei der Institutionalisierten Revolution – müsse sich Mexiko dieser fremdländischen Einflüsse dringend erwehren.
Flankiert wurde der Erstkontakt zwischen Staatsgewalt und Jugendkultur von der blutigen Niederschlagung der Studentenunruhen im Jahr 1968 – gipfelnd in einem staatlich in Szene gesetztem Massaker, bei dem zwischen 200 und 300 Student(inn)en ums Leben kamen. Die paternalistisch-paranoide Repressionswelle, die in jedem Hippie einen potenziellen Zersetzer der Landeskultur wähnte, währte bis weit in die Siebziger. Für einreisende Langhaarträger war der zuvor zu absolvierende Faconschnitt zu jener Zeit eine weitverbreitete Prozedur. Einheimische Rockbands traktierte man mit Zensur sowie anderweitigen Repressionen. Nichtsdestotrotz hatte sich bis zum Beginn der Neunziger eine Rockszene etabliert, die langsam daranging, eigenständige Akzente zu setzen. Zwischenzeitlich zeigt sich die Szenerie ähnlich diversifiziert wie die in anderen großen (nichteuropäischen) Ländern. Unverbindlich-popkompatibler Schmuserock wie der von Maná koexistiert neben dem Dire-Straits-inspiriertem Gitarrenrock der Formation Café Tacuba (Clip: »Aprovéchate«) oder dem Singer-Songwriter-Rock von Elis Paprika. Verbindendes Merkmal von Rockmusik made in Mexico: die spanische Sprache. Die keinesfalls als Geste vorauseilenden Gehorsams zum Tragen kommt, sondern vielmehr mit die Inhalte transportiert, welche den jeweiligen Bands wichtig sind.
Wer von der neuen mexikanischen Rockszene redet, kommt an einer Formation nicht vorbei: Tijuana No!. Die 1989 in der nordwestlichen Grenzmetropole gegründete Band ist eine der wenigen Landes-Formationen, die mühelos Stadien befüllen kann. Ihre Musik ist ein druckvoller, schneller Ska-Punk, einer ihrer größten Hits das Stück »Pobre de ti« (zu deutsch, selbstverständlich in der gemeinten ironischen Konnotation: »du armer Kerl«). Gefördert wurde die Gruppe unter anderem von Manu Chao; ein wichtiges Vorbild: die britische Punk-Combo The Clash. Zu Anfang grenzten sich Tijuana No! von den politisch inspirierten Liedermachern des Canto Nuevo noch deutlich ab – allerdings nur, um der Liedermacher-Kultur ein eigenes, anarchistisch geprägtes Politikverständnis von unten entgegenzusetzen. Jorge Velasquez, Bassist der Formation: »Oft wissen die Leute gar nichts von den Schweinereien, die in Mexiko passieren und hören sie in unseren Texten oder bei unseren Ansagen zum ersten Mal. Dann denken sie hoffentlich darüber nach.« Als zumindest völkerverständigend lässt sich schließlich die Musikkarriere jenes weltbekannten Musikers interpretieren, der wie kein anderer für den Crossover zwischen Rockmusik, Jazz und mexikanischen Klängen steht: Carlos Santana (hier live zusammen mit Lila Downs, Soledad und Nina). Ein nicht so gutes Standing hat in Mexiko hingegen der Jazz. Als Nischenstil ist er zwar präsent. Das Problem hier allerdings: die großen internationalen Labels, welche die guten Musiker in Richtung Norden abziehen. Beispiel für zeitgenössischen mexikanischen Jazz an der Stelle: die Musikerin Magos Herrera mit ihrer Formation Brooklyn Riders und dem Titel Niña.
Cumbia war um die Jahrtausendwende das neue Ding. Das derzeit aktuellste trägt den Namen Banda. Die von Tuba und Horn geprägten Blaskapellen haben sich zwischenzeitlich in jede Stilrichtung eingeschlichen, die beidseitig der US-Grenze en vogue ist. Trefflich kombinieren lassen sich Tuba & Co. auch mit Corridos, welche die anhaltende Benachteiligung der hispanischen Bevölkerung in den USA anprangern. Beispiel hier: »Soy Mexico Americano« von Los Cenzontles. Weniger traditionalistisch kommt der neueste Clone dieser Form Musik: Nortec – ein Ableger der elekronischen Dance Music. Ähnlich wie die Narcocorridistas ihre Musik mit Banda und Ähnlichem anreichern, kombinieren auch die Künstler(innen) des Nortec traditionelle, volkstümliche Elemente – hier mit elektronischen Beats, DJs, Samples, Sänger(innen) sowie begleitenden Instrumenten. Zentrum des Nortec ist die Nordwest-Metropole Tijuana. Als Musiker Furore gemacht haben vor allem diverse Mitglieder des Zusammenschlusses Nortec Collective. Bekannt unter anderem auch von Auftritten in Deutschland ist das Duo Bostich + Fussible. Stücke wie »Radio Borderland« und andere mögen – die eine mögliche Sichtweise – zwar nicht mehr sein als elektronische Musik für ein international geprägtes Club-Publikum, dass hierzulande etwa auf die Auftritte von Shantel und ähnlichen Künstlern steht. Die andere Sichtweise: Die Adaption landeseigener Musiktraditionen in Dance, Trance und ähnlichen Richtungen zeigt, dass auch international geprägte Lebensentwürfe letztlich nur funktionieren, wenn als Korrektiv eine lokale Anbindung hinzukommt.
Fazit
Die mexikanische Musikkultur erlebt derzeit eine interessante, von viel kreativer Experimentierfreude geprägte Übergangsphase. Die Kennmarken dabei ähneln nicht nur denen anderer, vergleichbar entwickelter Länder. In den angelsächsisch-westeuropäischen Ländern hat sich die Popkultur ebenfalls nach dem Schema Abgrenzung zur Hochkultur / landesweiter Popmarkt / Dissidenz & Differenzierung / Internationalisierung weiterentwickelt. Auch in Mexiko hat sich seit dem Ende des 20. Jahrhunderts ein Stil-Mix etabliert, der neben traditionellen (ruralen und städtischen) Stilen dissidente Formen herausgebildete und dessen Mainstream zunehmend Teil eines großen lateinamerikanischen Musikmarktes ist. Bezogen auf den aktuellen Stand ist so durchaus eine positive Prognose möglich: Ein Land mit einer derartigen (kulturellen) Vielfalt wird dauerhaft weder ein Opfer kulturimperialistischer Ambitionen noch wird es sich politisch (leicht) über den Tisch ziehen lassen.
Webinfos zu den einzelnen Stilen: Corrido & Narcocorrido | Norteño | Banda | Nortec | Ranchera | Mariachi | Cumbia
Technischer Hinweis: Wiedergabe-Probleme – speziell bei eingebetteten Videos – lassen sich oftmals durch die Verwendung von Firefox umgehen. Die eingebetteten YouTube-Clips hier nochmal als Direktlink: La Rielera (Linda Ronstadt) | Contrabando y traición (Los Tigres del Norte) | La Llorona (Natalia Lafourcade) | La Cumbia del Mole (Lila Downs) | Pobre de ti (Tijuana No!) | Radio Borderland (Nortec Collective / Bostich+Fussible)

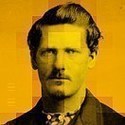




Was ist Ihre Meinung?
Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.