Der Legende zufolge sterben lediglich die Besten jung. Dem Spirit der Legenden Hank, Elvis und Janis huldigt man zwar auch in der Hauptstadt der Countryszene. Ungeachtet dem Image, dass es in dieser Musicbranche etwas gemächlicher, geerdeter zugeht, herrscht allerdings auch hier vor allem eins: knallhartes Business. Dies bekommt auch Rayna Jaymes zu spüren, die derzeitige »Queen of Country«. Die Charts-Positionen lassen zu wünschen übrig, Albumverkäufe und Konzert-Bookings ebenso. Im Anblick des Karriereknicks – so jedenfalls die Label-Entscheider – hilft nur ein beherzter Crossover. Lösung: Die Mittvierzigerin soll den Tour-Opener machen für Juliette Barnes – ein junges, aufstebendes Sternchen, dass derzeit den Country-Pop-Markt aufmischt.
Dass Jaymes und Barnes sowohl menschlich als auch musikalisch auf unterschiedlichen Planeten wohnen, verdeutlicht die US-Dramaserie Nashville bereits in den ersten zehn Minuten der allerersten Folge. Von der Diven-Schlammschlacht, die bei anderen Produktionen Handlungsmittelpunkt wäre, rückt Nashville allerdings frühzeitig ab. Es kommt noch besser: Je weiter die Serie voranschreitet, desto vielfältiger und ausdifferenzierter wird das Szenario, dass sich den Zuschauern darbietet. Wesentlich zu verdanken ist dieser – bei aller Sympathie – abgeklärte Blick der Serien-Initiatorin und Drehbuchautorin Callie Khouri. Dass Khouri Profi ist im Erzählen packender Frauengeschichten, bewies sie 1991 mit der Roadmovie-Story Thelma & Louise. Das große Plus der Geschichte: Basierend auf ihrer Anfangszeit im Medienbusiness konnte Khouri eigene Erfahrungen mit der Musikszene in Nashville in die Serie einbringen. Musikalisch grundiert wurde das Ganze schließlich von Khouris Ehemann, den Produzenten und ehemaligen Dylan-Begleitmusiker T-Bone Burnett.
Teaser der ersten Staffel zu Nashville
Bier, gebrochene Herzen …
Country handelt – eine weitere Legende – vorzugsweise von Bier und gebrochenen Herzen. Bekanntlich kann jedoch selbst bei einem guten Script eine Menge schiefgehen. Nashville umschifft die einschlägigen Klippen; die diversen Plots sind von Anfang an breitflächig aufgefächert, in einen größeren Rahmen gestellt. Der Konkurrenzkampf zwischen der gesetzten, lebens- und networking-erfahrenen Rayna und Juliette – einer zwischen Starallüren und Hilflosigkeit changierenden Diva im Dauerkampfmodus – fungiert mehr als Türöffner in die Welt des Country-Biz denn als In-Szene-Setzung eines seriell dargebotenen Dramaqueen-Duells. Der biografische Background ist es letztlich, der die Unterschiedlichkeit der Charaktere formt. Jaymes etwa entstammt solidem Nashviller Geldadel. Barnes hingegen kommt von unten, hat eine komplizierte Lebensgeschichte und eine Alkoholikerin als Mutter.
Auch Raynas Lebensgeschichte hat allerdings ihre Untiefen. In zweiter Ehe verheiratet mit einem akut klammen Geschäftsmann, muß sie nicht nur Karriere, Familie und Kids irgendwie stemmen. Die Familie in Form ihres Vaters, eines Wirtschafts-Tycoons mit den obligatorischen Ole-Boys-Seilschaften, wird mehr und mehr zu einem Problemstrang, der sich als Sub-Plot durch die Serie zieht. Die andere Seite – sozusagen die wahren, echten Werte von Nashville – verkörpert Deacon Claybourne, trockener Alkoholiker, Session-Musiker, Songwriter und abgelegter Ex von Rayna. Mit Deacon als (wichtigstem) Verbindungsglied führt die Serie ein halbes Dutzend weiterer serientragender Hauptrollen ein: die Chanteuse und Songschreiberin Scarlett O’Connor, die beiden (gleichfalls als Songwriter agierenden) Musiker Gunnar Scott und Avery Barkley und den schwulen Honky-Tonk-Showact Will Lexington. Der als aufstrebender Newcomer und Frauenschwarm die Erfahrung macht, dass der Weg zum Coming Out auch in jener Szene lang und steinig ist, in der Authenzität als der Wert schlechthin gilt.
Die Serie folgt zwar den Schicksalen und Lebenswindungen von allen: den arrivierten Stars, den aufgehenden Sternen am Country-Firmament und den musikalisch ambitionierten Newcomern. Letztere haben im Gefühlshaushalt von Nashville allerdings einen besonderen Pluspunkt. Mehr und mehr avancieren Deacon Claybourne und seine Nichte Scarlett O’Connor zum emotionalen Rückgrat der vielfältig miteinander verwobenen Handlungsstränge. Die guten, alten Werte – Freundschaft, Beziehungen, Authenzität und das letztendlich tun, was sich richtig anfühlt – machen zwar den Bodensatz von Nashville aus, die Zuversicht im Grundsätzlichen, welche die Serie transportiert. Aufgesetzt auf diese Schicht ist ein Kaleidoskop unterschiedlichster Konflikt-Gemengelagen: Probleme, den Ruhm zu verarbeiten, Drogen, die Vermarktung von Künstlern, Stress und künstlerisches Burnout, erpresserische Machenschaften, Intrigen und Hinterzimmer-Politik, Lüge und Wahrheit, problematische Freunde, problematische Familienmitglieder und, last but not least: problematische, der Zeit, dem Biz und den Umständen abgetrotzte Liebe.
Mit einem derart breiten Spektrum tun sich selbst die Etablierten, Erfolgreichen unter den anspruchsvollen Serien schwer. Die Sopranos oder Breaking Bad waren ähnlich vielschichtig. Allerdings kaprizierte sich der Point of View mehr oder weniger auf eine Hauptfigur. Game of Thrones wiederum wartete zwar mit einem breiten Protagonisten-Ensemble auf, externalisierte seine finale Menschheitshybris jedoch in eine Fantasy-Parallelwelt. Selbst The Walking Dead, derzeitige Nummer eins im Serien-Universum, kommt ohne eine apokalyptische Endzeit-Umgebung nicht aus. Nashville hingegen ist serielle Old School. Khouri und ihr Produktionsstab dirigieren ihre Figuren ähnlich unaufgeregt durch die Handlung wie der Direktor eines Großzirkus seine Elefanten durch die Manege. Die synchron verlaufenden Handlungsstränge bieten Highlights fast im Zehnminutentakt. Kameraführung und Farbgebung sind zwar wie Nashville & Country: modern im Detail, im Grundsätzlichen jedoch solide und langwertig. Schnelle, gut aufeinander abgestimmte Szenenwechsel sind bei derart vielen Hauptfiguren obligatorisch. Und funktionieren – tragen durch den seriellen Plot ähnlich wie eine Achterbahn in Disneyland.
… und Musik
Ein emminent wichtiger Bestandteil von Nashville ist – natürlich – die Musik. Obwohl T-Bone Burnett nach der ersten Staffel den Set als musikalischer Leiter verließ, inszenieren die bislang vier Staffeln Musik auf einem durchgehend hohen Niveau. Ob beim Entstehen neuer Songs oder bei ihrem Prelude auf der Bühne – der Zuschauer und die Zuschauerin ist stets hautnah dabei. Ein wichtiges Element von Nashville – vielleicht sogar das Wichtigste – ist die Tatsache, dass sämtliche Schauspieler als (echte) Musik-Acts agieren. Die Synthese von Handlung und Songs ist letztlich das Element, dass Nashville so immens authentisch rüber kommen lässt – etwa, wenn Charles Esten als Deacon Claybourne bei einem Stadtfestival den Song Playin’ Tricks spielt, Sam Palladio (als Gunnar) und Clare Bowett (als Scarlett) die Slow-Motion-Ballade If I Didn’t Know Better interpretieren (während die Kamera Abstecher macht zum aktuellen Treiben anderer Protagonisten) oder Will Chase als Ober-Star der Szene seiner Duett-Mitsingerin Connie Britton aka Rayna Jaymes auf offener Bühne einen Heiratsantrag macht.
Nashville ist voller Musik – sicher ein tragender Stein des Erfolgskonzepts. Die Stadt Nashville profitierte dabei unmittelbar von den Dreharbeiten. Der legendäre Nachwuchstreff Bluebird Café etwa wurde detailgetreu nachgebaut. Ein nicht unwesentlicher Teil des Ganzen ist das Musik-Merchandising. Bislang erschienen zwei Soundtrack-Compilations. Hinzu kamen eine Reihe Single-Veröffentlichungen – wobei einige Achtungserfolge in den Country-Charts erzielten. Was den Erfolg in Germany anbelangt, könnte allerdings genau hier das Problem liegen. In den USA ist Country Music – nach Pop und RnB – einer der drei großen Musikmärkte. Hierzulande sind nicht nur die Musiktraditionen anders gepolt. Auch die Info, dass Country in den Staaten längst zur aktuellen, zeitgemäßen Variante des Rock’n’Roll avanciert ist (und im Normalfall mehr nach Bruce Springsteen klingt als etwa dem patriotischen Kitsch der Statler Brothers), ist hierzulande eher in musikalischen Nischen Allgemeinplatz denn breit verankert.
Was bedeutet das für die Serie? Sicher kann man Nashville gut anschauen, ohne Country-Fan zu sein. Wer mit dem einschlägigen Kanon vertraut ist, hat allerdings ohne Zweifel mehr davon. Die einschlägigen Ecken des Genres sind fachgerecht besetzt. Rayna James repräsentiert die ehrwürdige Tradition von der Carter Family bis zu Willie Nelson, Juliette Barnes den vergleichsweise neuen Crossover in den Pop-Markt. Will Lexington und Luke Wheeler verkörpern die neuen Urban Cowboys der Marke Garth Brooks und Dwight Yoakam, Deacon Claybourne, Scarlett, Gunnar und Avery wiederum die Garde der Outcasts und Folk-Songwriter. Gastauftritte »echter« Stars schließlich gehören zu dem Authenzitäts-Kult, den Nashville zelebriert, ebenso dazu wie das Songmaterial, das ebenfalls von Hochkarätern der Szene stammt – unter anderem den Lumineers, Elvis Costello, Vince Gill, Liz Anderson, Patty Griffin, Steve Earle und Lucinda Williams.
Fazit
Aller Sympathie für diese spezielle Musikrichtung ungeachtet schafft es Nashville, die Distanz zu halten, die nötig ist, damit die Message eines Sittenbild-Potpourris glaubhaft funktioniert. Der Einfluss einer anderen Nashville-Filmproduktion – Robert Altmans gleichnamigem Film aus dem Jahr 1975 – ist dabei unverkennbar. Wenn man so will, hat Khouri den Kern-Plot von Altman modernisiert und auf Serienlänge transponiert. Die Ironie der seriell erzählten Geschichte mag dabei etwas weniger forciert sein als die in Altmans Szene-Portrait. Nashville ist, wenn man so will, die Familien-Packung im derzeitigen Anspruchs-TV. Irgendwie funktioniert die Serie wie ein Big Whopper. Die Chose ist manchmal klebrig und bereits von der Dosierung her nicht unbedingt das Gesündeste. Entgegen dem aktuellen Trend zur Miniserie offeriert Nashville die volle Packung: 21 bis 22 Folgen pro Staffel. Ob die aktuell im US-Fernsehen ausgestrahlte Staffel 4 tatsächlich die finale ist, steht – wie bei Erfolgsproduktionen so oft – in den Sternen. In Deutschland hat sich Streaming-Anbieter Netflix der Serie angenommen. Bislang sind dort zwei Staffeln abrufbar. Besonders nachhaltige Fans der Serie sind alsdann auf den iTunes Store von Apple zurückgeworfen. Dort im Angebot: Staffel 3 sowie die laufende, von der bislang acht Folgen im US-TV ausgestrahlt wurden.
Von allen Serien, die ohne Gangster-Glorifizierung, esoterische Plots und/oder aufgesetzten Livestyle-Kitsch auskommen, derzeit die Anspruchvollste und gleichzeitig Zwangsloseste. Drama für Erwachsene, mit Erwachsenen-Problemen und ganz viel Musik. Popcorn-Faktor: 9,5 von 10.
Nashville. TV-Serie. Bislang 4 Staffeln mit jeweils 20 bis 22 Folgen. Aktuelle Ausstrahlung im US-TV: Staffel 4. Staffel 1 und 2 als Streaming-TV bei Netflix abrufbar. Staffeln 3 und 4: downloadbar im iTunes Music Store.
Weitere Rezensionen:
TV-Serie »Nashville«: Smashhit mit Herz (SPON)
US-Serie »Nashville«: Wenn aus Kindern Monster werden (derStandard.at)
Bemerkenswerte Serien abseits des Qualitätskanons (I): »Nashville« (fortsetzung.tv)
»Nashville«: Neue US-Serie zu riskant für Deutschland? (DWDL.de)

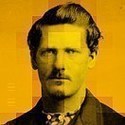




Was ist Ihre Meinung?
Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.