Einmal Skyline von unten, einmal Panorama von ganz oben – dazu Times Square, Liberty Statue sowie 9/11 Memorial als Pflichtprogramm: Für das Gros der New-York-Besucher(innen) dürften das die wesentlichen Stationen sein. Hinzukommend das Kulturprogramm – ein Besuch im Metropolitan Museum of Modern Art, eine Broadway-Show vielleicht, oder ein Diner im von Robert de Niro betriebenen Tribeca Grill (so man entsprechende Plätze ergattert hat). Stets mit der leisen Hoffnung, dass einem der Hausherr himself, Lady Gaga oder einer x-hundert bei Wikipedia gelisteten NY-Promis dort – oder eben zwei, drei Straßenecken weiter – über den Weg läuft.
Wie jede Metropole lebt auch New York von seinen Klischees. Eines davon ist die Gleichsetzung von New York (korrekt eigentlich: New York City, im Gegensatz zum gleichnamigen Bundesstaat, dessen südlichster Zipfel eben New York City – kurz: NYC – ist) und seinem pulsierenden Mittelpunkt, dem Stadtbezirk Manhattan. Stadteinteilungstechnisch ist das – fast insular auf einer langen Halbinsel gelegene – Manhattan lediglich einer von insgesamt fünf Stadtbezirken. Andererseits stimmt das Klischee schon: Anders als der flächenmäßig größere, aber nicht ganz so spektakuläre Melting Pot Brooklyn, das kleinbürgerliche Queens, die im Prekariats-Status verharrende Bronx sowie die von Trump-Fans bevölkerte Suburbia-Enklave Staten Island macht Manhattan richtig was her: der wohl bekannteste Stadtpark der Welt, eine große und eine etwas kleinere Wolkenkratzer-Ansammlung (beide für sich: exorbitant, unvergleichlich), spektakuläre Ein- und Ausblicke, kulturelle Überraschungen und schließlich vielberedete Viertel, die man einfach gesehen haben MUSS: Chinatown, die von gefühlt hunderttausend Sozialwissenschaftler(inne)n beschriebene Lower East Side, das Broadway-Viertel und, im Norden, Harlem – Geburtsort der Harlem Renaissance und zeitweiliger Aktionsmittelpunkt von Größen wie etwa Malcolm X und Cassius Clay aka Muhammad Ali.
Zahlen und Optik trügen bei New York / Manhattan gleichermaßen. Auf der Karte – etwa bei Google Maps – erscheint Manhattan eher wie die City, das Zentrum einer x-beliebigen Großstadt. Ergangen, erfahren oder sonstwie überbrückt sind die Entfernungen allerdings exorbitant. Von der Südspitze mit Skyline bis zu seinem nördlichsten Zipfel durchmisst Manhattan rund 25 Kilometer. Die Kilometerbreite zwischen East River im Osten und Hudson im Westen beläuft sich auf rund 3,5. Letzteres mag man via Erkundungsspaziergang schaffen; ersteres dürfte, jedenfalls am Stück, selbst schuhfeste Besucher(innen) an ihre Grenzen bringen. Hinzu kommt, dass das obere Drittel der Insel in gängigen Touristen-Rastern eh eine wenig bis gar nicht beschriebene terra incognita ist. Ganz (oder jedenfalls weitgehend) außen vor bleiben nicht nur die nördlichen Ausläufer-Kieze des Bezirks – also Washington Heights, Sugar Hill, Hamilton Heights mit ihren teils vorstädtisch anmutenden Nachbarschaften. Auch Harlem fällt im üblichen Besucher(innen)-Stadtplan mehr oder weniger durch das Sieb. Dabei besang bereits Aretha Franklin die Schönheit, Einzigartigkeit und auch Unzertrennlichkeit von »Black and Spanish Harlem« – bezugnehmend auf den Umstand, dass Harlem die heimliche Hauptstadt gleich zweier wichtiger US-Communities ist.
Ob Harlem Teil der üblichen Manhattan-Dreiteilung in Uptown (den Norden), Midtown (das Zentrum) und Downtown (die Südspitze) ist oder aber etwas Eigenes, Solitäres, daran scheiden sich die Geister. Einigkeit besteht – immerhin – darüber, dass »Uptown« nördlich der 59th Street beginnt, in einer Linie mit dem Südende des Central Park. Ob Uptown auf Höhe 96th Street (Osten; Spanish Harlem) respektive 110th Street (Westen) endet oder sich aber mit der Unter-Entität Harlem fortsetzt, ist wie gesagt Auslegungssache. Ebenfalls nicht ganz sicher ist sich die versammelte Koryphäenschaft betreffs der Ausbreitung von Midtown. Während einige lediglich die Wolkenkratzer-Ansammlung in der Mitte sowie einige umliegende Viertel als »Midtown« klassifizieren, subsummieren andere den gesamten Bereich zwischen 14th Street und 59th Street zum Zentrum, zur Mitte im engeren Sinn. Südlich der 14th Street schließlich, also in Downtown, wird Manhattan in mancherlei Hinsicht anders. Nicht nur das US-typische Straßenraster, zurückgehend übrigens auf einen Plan von 1811, löst sich zunehmend auf in die gewohnte Stadtgeografie europäischer Metropolen und ihrer Benamungs-Konventionen. Die speziell für Midtown bestimmende Hochbau-Architektur steigt hier ebenfalls herab auf die Normalhöhe europäischer Miethäuser-Komplexe. Ausgleichshalber befindet sich im Süden das Gros jener Stadtviertel, das bei Besuchern fernwehhaltige Assoziationen weckt: Chinatown, Little Italy, die legendäre Lower East Side; dazu Soho, Greenwich Village sowie sein östliches Pendant, das East Village.
Von Nord nach Süd geblickt nimmt die Wolkenkratzer-Architektur erst wieder Fahrt auf im südlichsten Zipfel – dem Financial District mit seiner Sub-Entität, dem Viertel um die zu Fall gebrachten zwei Türme. In ersterem befindet sich die Wall Street mit der gleichnamigen Börse. In letzterem mühen sich Stadt, Politik und Investoren nach Kräften ab, die Scharte vom 11. September ungeschehen zu machen, respektive in noch eindrucksvollere (= höhere) Architektur umzuwandeln. Aktueller Ausdruckspunkt dieser Art Gigantomanie ist das One World Trade Center. Mit 594 Meter Höhe ist es – aktuell – nicht nur das höchste Gebäude New Yorks. Auf dem ehemaligen WTC-Areal sind mittlerweile weitere Nachfolger der alten Türme hochgewachsen; andere sind in Planung oder bereits im Bau. Östlich davon, im historischen Bereich des alten, heute unter der Bezeichnung Financial District firmierenden New York befindet sich zumindest die menschen-unbekömmlichste (wenn auch von Touristen stark frequentierte) Form des Wolkenkratzerbaus, die man sich denken kann. Ungehindert von irgendwelchen Restriktionen wurden die historischen Gassen von Broad Street, Nassau Street und so weiter mit Hochhäusern zugestellt. Folge: Tageslicht verirrt sich lediglich in unzulänglicher Form in diese – im allerwörtlichsten Sinn – Straßenschluchten. Kontrastiert wird das Ganze, neben den obligatorischen Marken-Niederlassungen, von einem altenglischen Pub-Stil. Funktionstechnisch handelt es sich hierbei um historisch aufpolierte Nischen, welche die hier residierenden Anwalts-, Investment- und Bankenniederlassungen gnädigerweise übriggelassen haben – vielleicht in Anbetracht der Einsicht, dass auch die dort Arbeitenden zwischendurch irgendwo was einkaufen müssen.
Weiter nördlich schließt sich der Halbkreis der ethnisch definierten respektive Szene-Viertel an. Dazwischen liegt das Civic Center – das Herz der Stadtverwaltung, dessen imposantestes Gebäude, das Municipal Building, sogar dem großem Lenker im fernen Kreml so imponiert haben soll, dass es als Blaupause diente für jene Form realsozialistisch-klassizistischer Imponierarchitektur, wie man sie etwa beidseits der vormaligen Ostberliner Stalinallee bewundern kann. Auf diese Weise befruchtete der Kapitalismus den Sozialismus – wobei ersterer wiederum von einem älteren Empire, dem alten Rom, nicht unwesentlich inspiriert wurde. Nördlich der Canal Street – der südlichsten Straße übrigens, die durchgehend von der West- bis zur Eastside verläuft – verlieren sich die spätrömischen Architekturanleihen zugunsten der Engbebauung von Little Italy. Herzstück von Little Italy ist die von Süd nach Nord verlaufende Mullberry Street. Früher, in den Zeiten der Einwanderung und des Elends, war diese Gegend der Hot Spot irischer, jüdischer und italienischer Gangs. In einem berüchtigten Kiez – den Five Points – verdienten sich Al Capone und seine Mitstreiter ihre Jugend-Meriten.
Ein weiteres dieser von Delinquenz und Kriminalität geschlagenen Viertel war die Bowery beidseitig der gleichnamigen Straße. Die in Lower East Side und der Bowery ansässigen Diamantenhändler sind längst nach Midtown gezogen. Wie beengt und ärmlich es früher hier zuging, hat der Sozialreformer und Fotograf Jacob Riis dokumentiert – ein Zeitgefährte des progressiven Republikaners und US-Präsidenten Theodore Roosevelt. Die Bezeichnung »Little Italy« ist mittlerweile ein Euphemismus – respektive ein Magnet für souvenirfreudige Touristen. Den Italoamerikanern in Little Italy sind lediglich zwei, drei Straßenzüge beidseits der Mullberry geblieben. Zwischenzeitlich ist das ehemalige Italienerviertel übernommen worden vom zweitgrößten US-Zentrum chinesischer Einwanderer. Ausmäandert ist Chinatown auch in den historischen Anlaufpunkt der ost- und südeuropäischen Einwanderung – die Lower East Side. Originales East-Side-Feeling – koschere Läden, Altbau-Mietbauten, proletarische Romantik, die dazugehörige Kneipen-Infrastruktur und zeitweilig, in den Sechzigern sogar eine innovative Musikszene – findet man in diesem ehemals subbürgerlich geprägten Großviertel nur noch in wenigen Straßenzügen. Den Rest besorgte der Faktor Stadtsanierung. Die Ostseite von Downtown Manhattan wurde nach dem Krieg abgerissen und großflächig mit Wohnsilos Marke Sozialer Wohnungsbau bestückt. Weil Amerikaner grundsätzlich dazu tendieren, alles eine Nummer größer zu fabrizieren, wartet die am East River gelegene Ostflanke des ehemaligen Einwandererviertels mittlerweile mit einer Skyline auf, als hätte man die Berliner Entitäten Märkisches Viertel, Gropiusstadt und Marzahn-Hellersdorf auf einem Fleck konzentrieren wollen.
Hübsch, erbaulich. Wer sich von dieser Sorte Sozialrealismus-Schock kurieren will, dem bleiben immerhin die bekannten In-Viertel auf der anderen Halbinsel-Seite – das Village, Soho sowie das (bereits zu Midtown gehörende) Chelsea. In letzterem befindet sich das berühmte Chelsea Hotel, ein zwölf Stockwerke umfassendes Etablissement, das von einem künstlerisch ambiionierten Wohltäter errichtet wurde und in dem unter anderem Allen Ginsberg, Nico, Bob Dylan, Leonard Cohen und Nancy Spungen ihren Vorlieben für Musik sowie livestyletauglichen Substanzen frönten. Die überwiegende Mehrzahl aller New-York-Tourist(inn)en dürfte hauptsächlich wegen der spektakulären Skyline herkommen. Gute Blicke darauf hat man vom Brooklyner Flußufer, der Brooklyn Bridge (Fußgänger- und Fahrradfahrer-Überweg!) sowie von der New-Jersey-Side auf dem westlichen Hudson-Ufer. Hinzu kommen die Inseln: Governors Island, die ehemalige Einwander-Durchschleuse Ellis Island sowie – natürlich – Liberty Island mit der Freiheitsstatue. Ansonsten stuft sich der Wolkenkratzer-Bebau ab. Richtig los geht der Spaß (wieder) nördlich der 23th Street. Anders als im Financial District wurde die Wolkenkratzer-Bebauung in Midtown zumindest in Ansätzen stadtplanerisch reglemiert. Bekanntester Ausdruck dieser erzkapitalistischen Form von Einhegung sind die beiden Paradestücke der hier ziemlich durchgängig durchgezogenen Hochbauten-Bepflasterung: das Empire State Building (381 m) und das Comcast Building (259 m). Bedingung für die – stilistisch zwischen Jugendstil, Art Deco und sonstigen modernistischen Elementen changierenden – Wolkenkratzer der ersten Generation war die Auflage, alle 30 Stockwerke nach innen versetzt zu bauen. Grund: einfallendes Licht sollte Nachbarbauten nicht gänzlich verwehrt bleiben.
Downtown und Midtown werden skylinetechnisch zwar oft in einem Zug aufgeführt. Die Unterschiede sind allerdings nicht nur bebauungstechnisch frappierend: Während der Downtown-Komplex eines der größten Finanzzentrum weltweit darstellt, ist die – mitterweile großflächig umgesetzte – Wolkenkratzer-Bebauung zwischen (grob) 33. Straße und Central Park die größte Business- und Dienstleistungs-Ballung der USA. Von Süd nach Nord liefern in Mid drei kleinere Parkanlagen Orientierung: der Washington Square Park, der Madison Square Park und der Bryant Park. Südlich des alten, am Hudson gelegenen Irenviertels mit dem Namen Hells Kitchen geht die dem Himmel zustrebende Bebauung in die nächste Runde. In Hudson Yards, einer stadtgliederisch bislang wenig erschlossenen Industriebrachen- und Übergangszone wird gegenwärtig fleißig an Verstärkung gewerkelt für die eh bereits spektakulär daherkommende Midtown-Skyline. Bei den alten Wolkenkratzern geht das zum Rockefeller-Center-Komplex gehörende Comcast Building höhentechnisch gerade so mal durch. Eintrittshöhe in die Liga der zeitgemässen Supertalls sind 250 Meter. Erfüllen tun diese Mindestanforderung immerhin 30 der rund 3000 New Yorker Hochhäuser. Nach Norden, zum Central Park hin, wird das Ambiente nicht nur exklusiver. Mit dem Central Park Tower (472 m), dem Steinway Tower und dem Komplex 432 Park Avenue (425 m) erhält nicht nur das auch als »Billionaire’s Row« bezeichnete Tower-Ensemble rund um die 57. Straße standesgemäßen Zuwachs. Als sogenannte Bleistifttürme mit einem nachgerade extremen Verhältnis zwischen Grundfläche und Höhe markieren diese Türme den neuesten Trend dieser Art von Ultragroß-Bauten.
Ansonsten platzt Manhattan aus allen Nähten. Was einen simplen Grund hat: die (offiziell gezählt) rund 1,6 Millionen Bewohner(innen) der Halbinsel (New York insgesamt: circa 8,4; Metropolregion inklusive Vorstadt-Einzugsgebiet: ungefähr 19 Millionen) müssen/wollen irgendwo leben, arbeiten, unterkommen, sich vergnügen. Als partielle Ent-Stressoren fungieren der selbst für heutige Verhältnisse großzügig angelegte Central Park sowie das – nach wie vor leidlich funktionstüchtige – Netz unterschiedlicher Subway-Linien. Der Rest befindet sich – ungeachtet einiger Verkehrs-Arterien, die für Abfluss (leider ebenso: Zufluss) in die Peripherie sorgen – chronisch am Rande des Infarkts. Das Ganze aber – bittesehr – divers. Während der Westen mit der Durchgangsader West Drive / 12th Avenue über einen einigermaßen funktionstüchtigen Autoverkehr-Durchstich verfügt, versinkt der längs dem East River angelegte Franklin D. Roosevelt Drive (kurz: FDR) chronisch im Verkehrsinfarkt. Zusätzlich offenbaren West Drive und FDR die Verschiedenheit von West Side und East Side. Während am Hudson-Ufer bis heute die Relikte von New Yorks Vergangenheit als Industrie- und Verladehafen erkennbar sind (aber mit Parks, Schiffsanlegestellen sowie dekorativen Piers ordentlich aufgehübscht wurden), wurde Manhattans Ostseite peu à peu mit allem zugepflastert, was man anderswo nicht haben wollte: Sozialsilos für sozial Benachteiligte, gewagte Straßenumbauungen, Zufahrten und Tunnel-Unterführungen und schließlich Hochhaus-Bauten, die aus irgendeinem Grund auch unbedingt sein mußten. Zwischendrin: Reste industrieller Vergangenheit sowie dazwischen das – zwischenzeitlich ebenfalls mit Patina behaftete – UN-Hauptquartier.
Manhattans Norden hingegen steht für bürgerlichen Protz, Bildungs-Reputanz sowie – das Zentrum der in New York lebenden Afroamerikaner und Hispanics, Harlem. Auch beidseitig des Central Parks setzt sich die funkionell-stadthistorische Gliederung zwischen West- und East Side fort – hier nur eben auf einen quasi gediegeneren, höheren Niveau. Upper West Side und Upper East Side bilden die Refugien der Betuchten sowie des (gehobenen) Bildungsbürgertums. Die Columbia University hat das Antlitz der Upper West Side auf eine ebenso dezente wie nachhaltige Weise geprägt. Bis heute dienen die beidseits des Central Park gelegenen Viertel als Inspirationsquelle für gediegen-spritzige Screwball Comedys (Beispiel: »Die Glücksritter« mit Eddy Murphy) – oder auch Thriller wie etwa »Panic Room« mit Jodie Foster. Auf der Upper East Side perpetuiert sich das insgesamt gutgetucht-solvent wirkende Bild der Upper West Side fort. Zwischen beiden Arealen liegt der Central Park, New Yorks Grüne Lunge. Wo Harlem (in seinen beiden ethnischen Teilen) anfängt, ist umstritten. Gemeinhin gilt auf der East Side die 96. Straße als Grenze. Eine Definition, die schlüssig ist: Nördlich der 96. geht die gutbürgerliche Backstein-Mietshäuser-Bebauung der gehobeneren Klasse recht rapide über in die vorstädtische, von Ramschläden und Sozialsilos geprägte Architektur von Spanish Harlem. Ähnlich auf der Westseite: wobei die Upper West Side – mit Manhattan Valley, Morningside Heights sowie den großflächigen Gebäudekomplexen der Columbia University – nach Norden hin Puffergebiete hat zu dem Herz-Stadtteil des schwarzen Amerika.
Ein Ghetto – zumindest durchgängig – ist Harlem heute ebensowenig wie die nördlich an Manhattan anschließende South Bronx. Eventuell noch weniger. Anders als in der Bronx, wo Vernachlässigung, armentypische Elendsbebauung sowie ähnlich motivierte Architekturverbrechen weite Flächen bestimmen, verfügt Harlem über ein ausgewiesenes Zentrum: die hier den Namen Martin Luther King Boulevard tragende 110. Straße, in deren Mitte eine altehrwürdige Institution der Black Community ihre Residenz hat: das Apollo Theatre – Auftrittsort so ziemlich aller klassischen RnB- und Jazz-Größen von Sarah Vaughan und Aretha Franklin bis zu Oscar Henderson und James Brown. Straßen sind in Manhattan insgesamt ziemlich aufschlussreich für den Charakter eines bestimmten Bezirks. Wer den strukurellen Wechsel von der industriebaulich bestimmten Westside über das geschäftige Zentrum zur eher tristen East Side nachverfolgen will, ist mit folgenden drei Ost-West-Verbindungen gut bedient: der bereits erwähnten 57th Street als Hot Spot international tätiger Investitionsströme sowie der dazugehörigen Geldelite, der 42nd Street als Tour de force durch das Herz von Midtown und schließlich der 14th Street, der »offiziellen« Grenze zwischen Downtown und Midtown.
Was wäre New York (respektive Manhattan) ohne den Broadway? Nichts. Mit mehr als 25 Kilometer Gesamtlänge ist er nicht nur New Yorks älteste und längste Nord–Süd-Verbindung, sondern auch das Zentrum von Manhattan. Der Broadway beginnt am Südende des Financial Districts, zieht sich durch Downtown, um dann eine leichte West-Neigung zu vollziehen mitten durch das Herz von Midtown. Westlich des Central Park durchquert er die Upper West Side und verliert sich schließlich – erst als lange, schnurgerade Linie, dann als Vorort-Hauptstraße – in den externen Vorstadt-Akklamationen von Park Hill und Yonkers. Mit der Idee, die legendäre Straße zumindest ein Stück weit mit eigenen Füßen zu beschreiten, ist kein Besucher allein. Als Verbindungsstraße in nord-südlicher Richtung, Orientierungspunkt sowie Stadtviertel-Guide ist er natürlich unverzichtbar. In Nord-Richtung führt der Broadway stringent auf jenen Punkt zu, der das absolute »Must« aller New-York-Besucher(innen) zu sein scheint: der Times Square – respektive die Times Square-Mall sowie die umgebenden Straßenzüge. Very sexy: Mit etwas Glück erleben kann man hier eventuell den Naked Cowboy – einen im Chippendales-Look auftretenden Straßenmusiker (oder eines seiner Doubles). Und, wer weiß: Vielleicht ist sogar ein gemeinsames Selfie drin?
Der Times Square mag der Punkt sein, an dem der Kapitalismus sich selbst in seinem absoluten Zentrum begegnet. Dasselbe gilt für das umliegende Viertel, den Garment District. Bis weit in die Siebziger war die Gegend noch ein ziemlich heruntergekommenes Viertel – bestimmt von Junkies, billigen Absteigen, Kleinkriminalität sowie den dazugehörigen Interaktionen zwischen Angebot und Nachfrage. Mittlerweile jedoch kann man den ehemaligen Theaterdistrikt als das pulsierende Herz von New York bezeichnen. Wenn – entsprechende Grundaffinitäten vorausgesetzt – irgendein Ort der Welt den Jubelschrei »Kapitalismus, hier bin ich!« provoziert, dann ist dies die florierende, von allerlei Theatern, Off-Häusern, Clubs sowie Marken-Niederlassungen geprägte Gegend um Broadway, 7th Avenue und 42nd Street. Doch wie sieht es mit der Politik aus? Der New Yorker (sowie sein weibliches und diverses Äquivalent) neigt bekanntlich eher den Demokraten zu. Mit Bill de Blasio hat die Stadt – nach guter Tradition – auch wieder einen demokratischen Bürgermeister. Allerdings: die Vorherrschaft der Demokraten in der Stadt ist keine Ungebrochene – siehe auch die langjährige Amtszeit des aus taktischen Gründen zeitweilig zu den Republikanern geswitchten Medienunternehmers Michael Bloomberg. Bloombergs Vorgänger, dem Republikaner Rudolph Giuliani, wiederum wird – ungeachtet seiner aktuellen Vasallentreue zu Donald Trump – bis heute hoch angerechnet, dass er präsent war, als die Stadt und ihre Bewohner ihn dringend brauchten: am 11. September 2001.
Kommen wir zum berühmtesten – oder zumindest umstrittensten – New Yorker: Donald Trump. Für Manhattan-Verhältnisse ist Trump zwar nachgerade in der Pampa aufgewachsen: im von Eigenheimen und Beschaulichkeit geprägten Queens. Doch auch in Manhattan hat der – noch im Amt befindliche – Präsident bleibende Spuren hinterlassen. Die repräsentabelste Spur ist sicherlich der Trump Tower – ein auf das gehobene Segment zugeschnittenes Mischnutzungs-Hochhaus im Gutbetuchten-Areal rund um die 57nd, ausgestattet mit Stuckgold, rosafarbenem Marmor und auch sonst allem, was man für ein standesgemäßes Leben so braucht. Mit zwielichtigen Spekulationsgeschäften rund um Manhattan-Immobilien der in Konkurs gegangenen Eisenbahngesellschaft Penn Central hatte sich Trump jedoch bereits in den Siebzigern den Ruf eines mit allen Wassern gewaschenen Geschäftsmanns eingehandelt. Aus der Portokasse bezahlt haben dürfte der umstrittene Baubranche-Tycoon hingegen eine Zeitungsanzeige, die er am 1. Mai 1989 schaltete und in der er die Todesstrafe forderte für fünf unter der Bezeichnung »Central Park Five« bekanntgewordene Jugendliche. Der Fall, dessen Sachindizien in der Hauptsache auf erpressten Geständnissen sowie kreativen Vorgehensweisen bei den polizeilich-staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen beruhten, wurde schließlich revidiert – Jahre später, nachdem der wirkliche Täter gefunden wude. Donald Trump – hat das zugespitzte Surfen auf den Wogen der Vorverurteilung zumindest nicht geschadet.
Kleiner Trost: Das Schicksal der »Central Park Five« wurde zwischenzeitlich in einer sehenswerten Serie aufgearbeitet (»When They See Us«). Und: Was wäre New York, was wäre Manhattan ohne die vielen Songs, die es begleiten sowie die Filmmeter, die über Liebe und Leid, Aufstieg und Fall, Leben und Sterben in seinen Lofts und auf seinen Straßen gedreht wurden? Die quirlige Nachkriegsära von Swing und Bebop brachten zwei auf den Punkt, die sie noch aus eigener Anschauung einigermaßen kennen dürften: Robert de Niro und Liza Minnelli (»New York, New York«). Regisseur war Martin Scorsese; nicht fehlen darin durfte natürlich DER New-York-Song schlechthin: Frank Sinatras gleichnamige Lobeshymne. Zugegeben – New York hat auch weniger schöne Seiten. Ob in seiner irischen, afroamerikanischen oder eben italoamerikanischen Variante: die entsprechenden Mobster sind immer für einen Film gut. Mit den tragischsten Tod an der Polizeifront legte 1990 der Kalifornier Sean Penn hin – in »Im Vorhof der Hölle«. Selten ist der Loyalitätskonflikt zwischen Undercover-Ermittler(n) und Gangster-Freund(inn)en aus alten Jugendtagen so herzzerreißend und gleichzeitig so authentisch dargestellt worden wie in diesem Gangsterfilm über den Irish Mob Marke Hells Kitchen.
Selbst der infarktuöse Verkehr zwischen Metropole und Peripherie ist mühelos für gute Stoffe gut. Ein bekannter ist die Serie »Die Sopranos«, in deren Vorspann James Gandolfini aka Vorstadt-Capo Tony Soprano – Home, Sweet Home – täglich zwischen dem Verbrechensbabylon New York und der beschaulichen Bungalow-Idylle in New Jersey hin und her pendelt. Die Jerseyside ist auch Mit-Schauplatz von »Copland« – einem Polizeithriller über, nunja, fortgeschritten vor sich hinfaulende Äpfel im New Yorker Police Department. Last but not least: Dass Cosa Nostra & Co. große Teile der New Yorker Stadtgeschichte schrieben, zeigt eine vergleichsweise neue Serienproduktion: »Godfather of Harlem«. Angesiedelt in den bürgerrechtsbewegten Sechzigern, beschreibt sie die Abwehrkämpfe, die ein lokaler Pate, der (historisch verbürgte) Bumpy Johnson, gegen die vereinte Power der berüchtigten Fünf Familien bestreiten muß.
Letzte Frage: Wird New York, wird Manhattan nach dem 3. November noch so sein, wie wir es allseits kennen? Die einzig richtige Antwort darauf ist: Wir wissen es nicht. Sicher ist zumindest eines: dass der – klimaanstiegsbedingte – Untergang der Stadt New York wohl noch eine Reihe Jahrzehnte hindauern wird. Das mag viele beruhigen. Notorische Amerikafeinde werden diese Zukunftsprognose für das »Herz des Finanzkapitalismus« vielleicht betrüblich finden. Wann immer das Ende stattfindet (so es denn stattfindet): Es wird (voraussichtlich) nach ihrer Zeit passieren. In der Summe jedoch zeigen die Reaktionen auf diese Stadt zumindest eines:
Dass sie kaum jemanden gleichgültig lässt.
INFOS:
Karte bei Wikipedia mit den Stadtvierteln von Manhattan
Fürs Guiness-Buch: Auf der Liste der höchsten Gebäude der Welt rangiert das One World Trade Center lediglich auf Platz 7. Platz eins nimmt der Buj Khalifa in Dubai ein; mit 828 Metern und etwa doppeler Eifelturm-Höhe überragt er das OWTC um knapp 300 Meter. Auf Platz drei rangiert der Makkah Royal Clock Tower in Mekka – ein für Pilger zu den heiligen Stätten konzipierter Hotel- und Einkaufskomplex. Die Plätze zwei sowie vier bis sechs werden von der VR China und Südkorea in Beschlag genommen. Auf Platz 14 ist immerhin auch New York wieder mit im Spiel – mit dem im Beitrag erwähnten Central Park Tower.

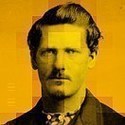



Was ist Ihre Meinung?
Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.