Die Handlung von Tod von Freunden ist schnell erzählt. Zwei Pärchen mit Öko-Background, kulturell renomméeträchtigen Jobs und jeweils zwei Kindern haben sich auf einer dänischen Ostseeinsel zu einer verschworenen Gemeinschaft zusammengefunden – zu einer Art Patchwork Family, wie das bei Habecks & Co. halt so ist. Da die Idylle zu schön ist, um wahr zu sein (und kaum über sieben Folgen tragen würde), lugt das Unglück bereits um die Ecke. Dramatischer Auslöser – und gleichzeitig das Ereignis, zu dem die Serie immer wieder zurückkehren wird, ist eine Bootsfahrt. Sechs sind losgefahren, aber nur fünf werden zurückkehren: Jakob und Charlie Jensen, das dänische Paar, ihre beiden Kinder Cecile und Emile sowie Karl – der autistische Sohn von Bernd und Sabine Küster. Deren zweiter Sohn, Kjell ging über Bord. Was los war, was geschah und was das Ganze auslöste, beleuchtet die Serie in einem Pilotfilm und sechs weiteren Folgen. Wobei die Handlung nicht linear weiterentwickelt wird. Vielmehr widmet sich jede Folge dem Point of View eines anderen Beteiligten. Zu denen sich als handlungstragende Figur Nummer neun Jakob Jensens Bruder Jonas hinzugesellt – ein Außenseiter, der früher möglicherweise Sabine vergewaltigt hat und zudem unliebsame Vergangenheiten politlinker Couleur wieder gegenwärtig macht.
Zugegeben: Der Plot ist nicht direkt die Neuerfindung der Brotschneidemaschine – zumal im Verlauf der Serie auch nicht viel mehr hinzukommt. Die Grundanlage erinnert an Bloodline – eine Netflix-Serie aus der Anspruchsklasse, die mit einem ähnlichen Grundszenario die düsteren Familiengeheimnisse einer im Ausflugs- und Tourismusgeschäft tätigen Südstaatenfamilie in den Florida Keys zum Thema hatte. Tod von Freunden hätte durchaus das Zeug gehabt, einen ähnlichen Weg zu nehmen – oder, alternativ: auch den von Big Little Lies, einer HBO-Serie, die sich dem dolce vita der aufgeklärten Westküsten-Bourgoisie widmete. Im ersten Fall hätte die ZDF-Produktion die selbstgeschaffene heile Aussteigerwelt Stück für Stück zerbröselt. Im zweiten Fall wären ähnliche Erkenntnisse rumgekommen – allerdings mehr sophisticated. Der springende Punkt allerdings ist leider: In beiden Fällen hätte Tod von Freunden mit einer nachvollziehbaren Handlung aufgewartet.
In realitas kann nicht mal in Ansätzen davon die Rede sein. Sicher – die Serie hangelt sich treu und redlich durch ihren Plot. Und ihr selbstgesetztes Setting, jede Folge einen anderen Part seinen Teil der Geschichte erzählen zu lassen. Im Verlauf dieser Inszenierung tappt die Serie allerdings nicht nur in jede Fehlerfalle, die bei deutschen Ambitions-Produktionen zum »State of the art« zählt. Sie sucht sie geradezu, um sich begierig darin reinplumpsen zu lassen. Fehler Nummer eins ist der wohl »typisch deutscheste«: die Geringschätzung der Handlung – nach dem Motto: Die Zuschauer halten schon bis zum Ende durch, wo sie die Auflösung dann schließlich serviert bekommen. Das Wenig an Plot wäre sicher kompensierbar gewesen – entweder mit kleinen Nebenstängen, mit mehr Detailzeichnung, oder insgesamt mehr Inszenierweise nach Arthouse-Kinoart. Von ebenjener kann nicht mal ansatzweise die Rede sein. Nach der Devise »Es zählt nicht, was passiert – es zählt, was du fühlst« dauerurschreien sich die involvierten Figuren durch insgesamt sieben Stunden. Womit wir beim zweiten Konventionalfehler wären: der auf Dauermodus gestellten Überfrachtung – Überfrachtung mit Sinn, mit Sinnsuche und, weil das perfekte Leben sich nicht einstellen will, eben Gefühlsexpressionismus im 24/7-Modus.
Die dazugehörige Farbgebung – Fehler Nummer drei – darf bei Anspruchskitsch dieser Güteklasse natürlich nicht fehlen. Keine – buchstäblich keine – Szene, die nicht ausgeleuchtet wäre wie die Lightshow auf einem Kuschelrock-Konzert beim Stadtfest. Der postproduktionelle Farb-Zuckerguss darf auch beim prä-koitalen Techtelmechtel nicht fehlen. Wenn Sabine Küster (Katharina Schüttler) sich im rotbraunlilalen Schummerlicht an ihren Ehemann (Jan Josef Liefers) kuschelt, um ein paar Problems zu bekakeln, fehlt eigentlich nur der Edeldesign-Möbelhauskatalog auf dem Nachtisch. Wobei der auf dem Fernsehtisch vorm Sofa – auch Lockdowns haben schließlich mal ihr Ende – vielleicht noch besser aufgehoben wäre. Fehler Nummer vier gehört ebenfalls zum Gütesiegel »made in Germany«: die notorische Geringschätzung von Plausibilität oder Dingen, die man ansatzweise als stringent fortgeführter roter Faden bezeichnen könnte. Was im Rahmen dieser Serie ebenfalls seine Logik hat. Die Figuren verhalten sich eben auf eine Weise dauerüberdreht, wie es im echten Leben nicht mal ansatzweise vorkommt. Da stört Realität ähnlich wie das aufgemachte Fenster beim zünftigen Horrorfilm-Abend.
Nichtsdestotrotz feiern die Produktion derzeit fast alle – von der Süddeutschen bis hin zu FAZ und Morgenpost. Das könnte man vielleicht stehen lassen – das Land ist pandemiegeplagt; ein kleiner Serien-Abheber zum Lockdown-Durchstehen ist da vielleicht nicht verkehrt. In seinem Wesenskern frei legt Tod von Freunden letztlich vor allem eines: die Selbstbezogenheit eines bestimmten Milieus, das mit dem Begriff »Helicopter-Eltern« vielleicht ganz treffend beschrieben ist und das zwischen arrivierter Korrektheit und alternativradikalen Vergangenheits-Phantomschmerzen hin und her oszilliert. Anders gesagt: Hätte das ZDF diese Produktion auf die gängige, übliche Weise in den Sand gesetzt, könnte man kommentarlos darüber hinweggehen – mehr als zwei Produktionen pro Jahr kriegt auch ein Ausnahmetalent wie Lars Becker nicht hin. Was neu ist, ist der Umstand, dass Tatort- und Fernsehfilm-Routinier Friedemann Fromm nicht einmal den Versuch unternommen hat, zu seinen Figuren etwas wie Distanz zu schaffen. Überwältigt werden die Zuschauer(innen) stattdessen nicht nur mit Personen, bei denen es Mühe bereitet, sie sympathisch zu finden. Friedemann übernimmt das Ego-Monsterhafte seiner Protagonisten eins-zu-eins – kritiklos, distanzlos und hin bis zu jenen Momenten im Zehnminutentakt, wo sie auf Außenstehende nur noch peinlich wirken.
Darf ich dich anfassen? Ja, du darfst – komm: Es ist diese im Öko-Hausprojekt beheimatete Hybris, die sich mit jeder Szene selbst ein Monument setzen will, die an dieser Produktion, Pardon, schwer auf den Zeiger geht. Folgerichtig wird jedes Gefühl nicht nur artikuliert – nein: unter Zelebrieren wollen es Filmemacher und Darsteller keinesfalls machen. Der Schmerz muß, wenn er schon raus muß, im wilden Yoga-Tanz raus, dem toten Teenager wird mit aufsteigenden Papierlampions am nächtlichen Ostseestrand ein Monument abgefackelt, und der Künstler verbrennt seine bloß kunsthandwerklichen Bilder, um in einem Akt der Katharsis nunmehr Stahlinstallationen zu schweißen. Und auch der Rest der Welt – hallo, laut Programmheft sollte das Ganze auf einer INSEL spielen, nicht: auf einer unbewohnten Insel – kommen auf eine Weise vor, angesichts dessen der Begriff Präsent-Sein Hochstapelei wäre. Anders gesagt: Sie kommen so gut wie nicht vor; neunzig Prozent dieses expressionistisch-schwülen Kammerspiels im Freien spielen sich unter den neun tragenden Figuren ab. Die sich permanent um sich drehen, um ihre Träume, Sehnsüchte und ihre selbstredend einzigartige Geschichte.
Eine Art Familienaufstellung mit grün angehauchten Darsteller(innen) – man hat das schon mal witziger gehabt, etwa in dem Dramedy-Fernsehfilm Wellness für Paare. Aber vielleicht ist Tod von Freunden mehr als der übliche Ö/R-Kitsch vor grünarrivierter Kulisse. Sollte die von Friedemann Fromm inszenierte Gefühlsgemengelage symptomatisch sein für das portraitierte Milieu, kann die Zukunft nur wüst werden. – Übrigens egal, mit welchem Kanzler oder welcher Kanzlerin.
Tod von Freunden. Miniserie, 1 Pilotfilm + 6 Folgen. 55 bis 115 Minuten. ZDF. Regie: Friedemann Fromm. Darsteller: Jan Josef Liefers, Katharina Schüttler, Thure Lindhardt, Lene Maria Christensen und andere. Sendetermine: 14., 21. und 28. Februar, jeweils 22:15 Uhr. Abrufbar in der ZDF-Mediathek.
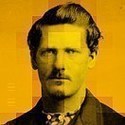




Was ist Ihre Meinung?
Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.