Wie hilft man sich, wenn man mit dem Küchen-Latein am Ende ist? Keine Frage, man googelt das Problem (häufigste Variante) oder man begibt sich auf die Suche nach einem Experten, der in der anliegenden Frage weiterhelfen kann. Erst kürzlich publizierte die Büchergilde einen Sammelband zur Thematik des Expertentums, mit dem schönen Titel: „Auf dem Markt der Experten – zwischen Überforderung und Vielfalt“ – An dieser Stelle deutet sich schon eine erste Problematik des Expertentums an, es gibt zu viele und man weiß nicht, welcher Experte wirklich gut ist. Die Herausgeber, Studierende der Freien Universität zu Berlin, begaben sich daher ins Gespräch mit Wissenschaftlern und Künstlern, um den Begriff des Experten dingfest zu machen.
Viele spannende Dinge kann man hier erfahren, zum Beispiel begann die Expertiseforschung, laut Harald A. Mieg in den zwanziger Jahren mit Untersuchungen zum Schachspiel. Diese Untersuchungen zeigten, dass Experten kein besseres Gedächtnis als „normale Menschen“ haben. Aufgrund ihrer angesammelten Erfahrung und ihres Spezialwissens erfassen Experten Probleme ihres Fachs in ihren spezifischen Konstellationen schneller und besser. Sie sehen die relevanten Sinnzusammenhänge, anstelle von Einzelpositionen. So merkten sich Schachmeister die Partien in Schachzügen, anstatt sich einzelne Figuren einzuprägen. Später definierten William G. Chase und Herbert A. Simon diese Sinnkomplexe als sogenannte „Chunks“.
Kein Hans in allen Gassen
Experten zeichnen sich durch Bereichsspezifität aus. Im Gegensatz zum Intellektuellen, der sich in der Öffentlichkeit über alles und jeden äußern kann, weil er komplexe Zusammenhänge erkennen und anprangern will, bescheidet sich der Experte auf sein Spezialgebiet. Die bewundernswerte Fähigkeit der geistigen Transferleistungen lässt den Intellektuellen attraktiver erscheinen als den Experten, der eben einfach beschränkter daherkommt. Neben dem Intellektuellen wirkt der Experte kleinkariert, obwohl er seine Berechtigung hat.
Doch wie wird man Experte? Laut Mieg gilt die Zehnjahres-Regel. Zehnjährige intensive Beschäftigung mit einem Thema und gesammelte Erfahrungen auf dem spezifischen Gebiet, sowie die stetige Hinzugewinnung weiteren Wissens ebnet den Weg zum Expertentum. Jedoch ist dies kein Ritterschlag für Langzeitstudierende, hinzu kommt das Kriterium, dass man zu den besten zehn Prozent des Feldes gehören muss. Warum eigentlich zehn Jahre? Wenn man bedenkt, dass ein durchschnittliches Masterstudium fünf Jahre dauert, fühlt man sich als Leser deprimiert. War das Studium umsonst?
Als Trost hilft hier das Konzept der „relativen Expertise“. Nach dem Motto „Unter den Blinden ist der Einäugige König“ kann man im Kreise Nichtwissender immer noch den Status eines Experten einnehmen – sofern gewünscht und vom Umfeld akzeptiert. Expertentum erfolgt also auch durch die Zuschreibung von außen, und ist gewissermaßen flüchtig. Kaum bewegt sich der relative Experte in ein anderes Umfeld, kann er auf den Status des Fortgeschrittenen (laut Buch nach drei Jahren erreicht, somit dem Bachelor entsprechend) herabsinken. Das Ringen um die Rolle als Experte ist also auch ein ständiger Kampf um Selbstbehauptung.
Das anonyme Internet wird nicht siegen
Werden Experten überhaupt gebraucht? In Zeiten der Unsicherheit besteht ein großer Bedarf an Expertentum. Im Gegensatz zur Antwortsuche im Internet übernimmt der Experte für seine Aussagen Verantwortung. Das heißt, das von Ihm verkündete Wissen ist an sein Gesicht, an seine Person gekoppelt. Daher werden Experten niemals von der anonymen Wissensmasse des Internets ersetzt werden.
Vor einigen Jahren leitete Dr. Michael Angele ein Seminar zu Besserwissern, Intellektuellen und Experten. Einschneidend war, dass keiner der Studierenden der Neueren deutschen Literatur damals wusste, wer aktuell Kultursenator war. Aber damals standen wir halt noch am Beginn unseres Expertendaseins.
Auf dem Markt der Experten
Herausgeber: Julia Bierstedt, Alexander Binder, Marc Dieke, Nina Flaig, Sophie Gottschall, Antonella Grippa, Friederike Hintze, Charlotte Kirstein, Marie Kruttmann, Eva Philippi, Carolin Schmidt, Ruben Pfizenmaier
Illustrationen: Malte Grabsch
Edition Büchergilde
2016, 204 Seiten
ISBN: 978-3-86406-064-9
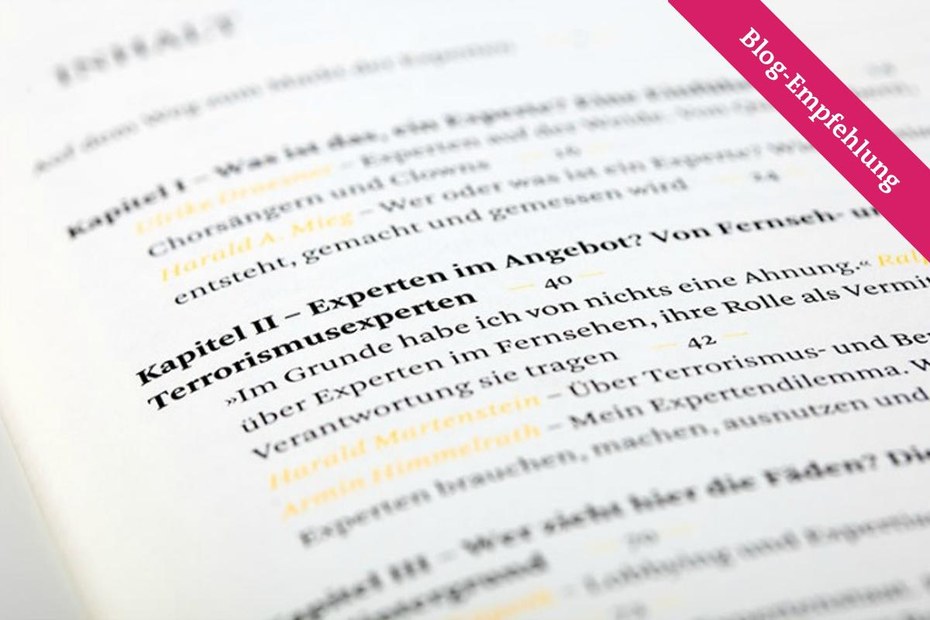




Was ist Ihre Meinung?
Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.