Es ist soweit, wir haben es immer gewusst und nun ist es da: das Ende des weißen Mannes. Mit einem Aufschrei im Feuilleton hat Jens Jessen in der ZEIT nun endlich die Gefahr erkannt, die von #metoo für den Mann ausgeht. Die Bedrohung, die der Feminismus für ihn oder andere Männer darstellt, veranlassten Jessen nun zum Wutausbruch, denn zu Unrecht würde er für die Untaten aller Männer beschuldigt – das wird Mann ja wohl noch mal sagen dürfen!
Neu ist dieser Alarmismus beileibe nicht. Der bedrohte Mann, der impotente Mann, der Mann in der Krise. Diese Rhetoriken schwirren immer schon durch den feuilletonistischen Raum, brisant ist das Thema allemal, allein das Ausmaß hinterlassener Kommentare unter Beiträgen dieser Art spricht Bände. Prominent wurden diese Sprechweisen in den vergangenen Jahren besonders dort bedient, wo sie mit der Geflüchtetensituation in Deutschland zusammengeschaut wurden. Nach den Vorfällen in der Kölner Silvesternacht 2015 wurden Stimmen laut, die nach der Identität des arabischen Mannes fragten. Zugleich wurde sich am westlichen, am deutschen Mann abgearbeitet. Die russische Publizistin Julia Latynina stellte die verwegene These auf, der deutsche Mann sei zu weich, er könne ‚seine Frau‘ nicht mehr beschützen. Harte Zeiten erfordern harte Männlichkeit.
Das zeigt, dass es um relativ einfache Distinktionsmechanismen geht. Wenn es den weißen Mann nicht gibt, muss er in Opposition zu dem anderen allererst hervorgebracht werden. Steht im öffentlichen Diskurs das Neuverhandeln des jeweils anderen – dort der arabische Mann, hier die Frau – sowie das Re-Arrangieren von Geschlechterverhältnissen selbst zur Debatte, dann sieht auch Männlichkeit sich dazu gezwungen, sich neu zu entwerfen. Dabei ist Männlichkeit vielmehr als Projekt zu verstehen, das – genau wie Weiblichkeit – über diskursive Praktiken konstruiert wird. Wie wir darüber sprechen und schreiben macht Geschlecht – und bringt in Relation anderes hervor.
Besonders zeichnet sich Männlichkeit durch eine spezifische Flexibilität aus. Hybrid Masculinity nennen das die Soziologen Tristan Bridges und C.J. Pascoe, eine Form von Männlichkeit, die sich eines Verhaltenskatalogs ‚anderer‘, d.i. queerer, ‚weiblicher‘ oder homosexueller Männlichkeit bedienen.
Hybride Männlichkeit ist hochgradig elastisch und verfehlt genau deshalb das Projekt, männliche Hegemonie zu unterwandern. Der Griff in die Geschlechter-Apotheke verhilft zur Immunisierung gegen neue ‚Bedrohungen‘.
Die aktuelle Debatte zeigt vor allem eines: die selbstattestierte Krise des Mannes ist hausgemacht. Als Strategie kultureller und gesellschaftlicher Hegemonie dient sie dem westlichen Mann dazu, sich (auch) in der Position des Benachteiligten zu wähnen, um von dort aus sich neu aufstellen und auf die vermeintliche Gefahr reagieren zu können. Auf diese Weise bleibt, das hat Raewyn Cornell schon vor 20 Jahren gewusst, heterosexuelle Männlichkeit das dominante Geschlechtermodell, das die Vorherrschaft über Frauen und marginalisierte Männlichkeiten (homosexuelle, schwarze etc.) gewährleistet. Anpassungs- und Aneignungsfähigkeiten sind die Kernkompetenzen weißer Männlichkeit.
Aus einer solchen Krise geht der Mann gestärkt hervor, schließlich verweist der aus der Medizin kommende Terminus der Krise den Umschlagpunkt, an dem der Patient entweder versterben oder genesen wird. Und wie an der jahrtausendealten Vorherrschaft des Patriarchats und den noch immer andauernden Debatten ersichtlich wird, ist der Patient bisher noch nicht verendet.
Doch wäre das angesichts Jessens Befund vielleicht endlich angebracht. Denn wer sich wie der ZEIT-Feuilletonist als Mann mit Händen und Füßen gegen seine Verantwortung wehrt, etwas gegen die Untaten anderer Männer zu unternehmen, lässt das Projekt der Emanzipation verkümmern und handelt nicht weniger beschämend als diejenigen, gegen die sich #metoo zunächst gerichtet hatte. Dass der respektlose Vergleich mit der „Diskriminierungserfahrung der Muslime“ nicht nur völlig verfehlt ist und Privilegien westlicher Männlichkeit sowie deren historischen Vorherrschaft verkennt, sollte nicht einmal einer Erwähnung wert sein.
All das zeugt nun gerade nicht von einer Krise des Mannes. Vielmehr zeigt es, wie aggressiv und gewalttätig Geschlechterentwürfe sind und mit welchen Mitteln sie aufrecht erhalten werden, auf weltpolitischer wie auf feuilletonistischer Bühne. Nur wenn Männer wie Jens Jessen damit aufhören, sich als Opfer in der Krise zu inszenieren, können wir anfangen, uns über diese Entwürfe zu unterhalten. Und das ist dringender denn je.
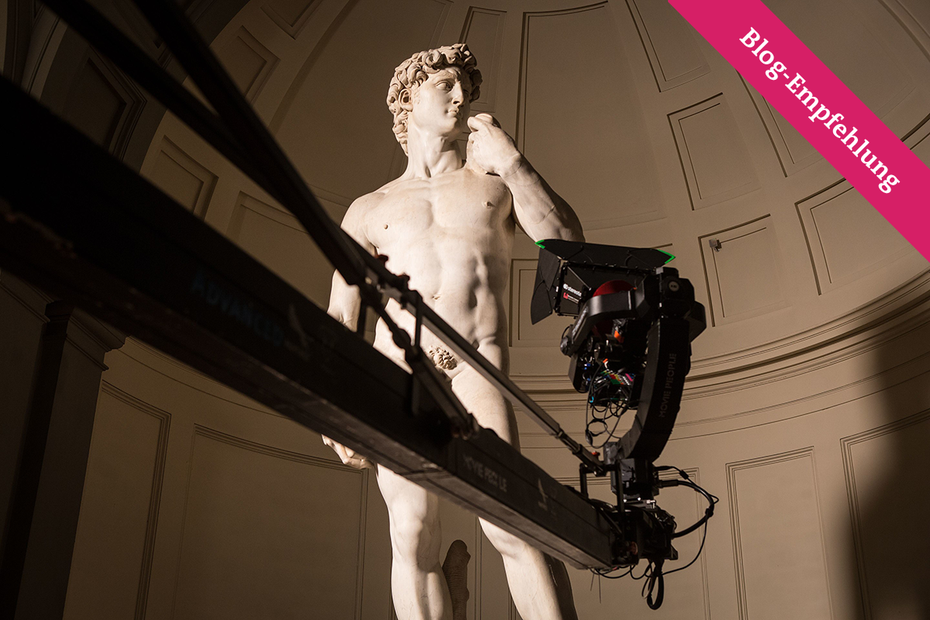





Was ist Ihre Meinung?
Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.