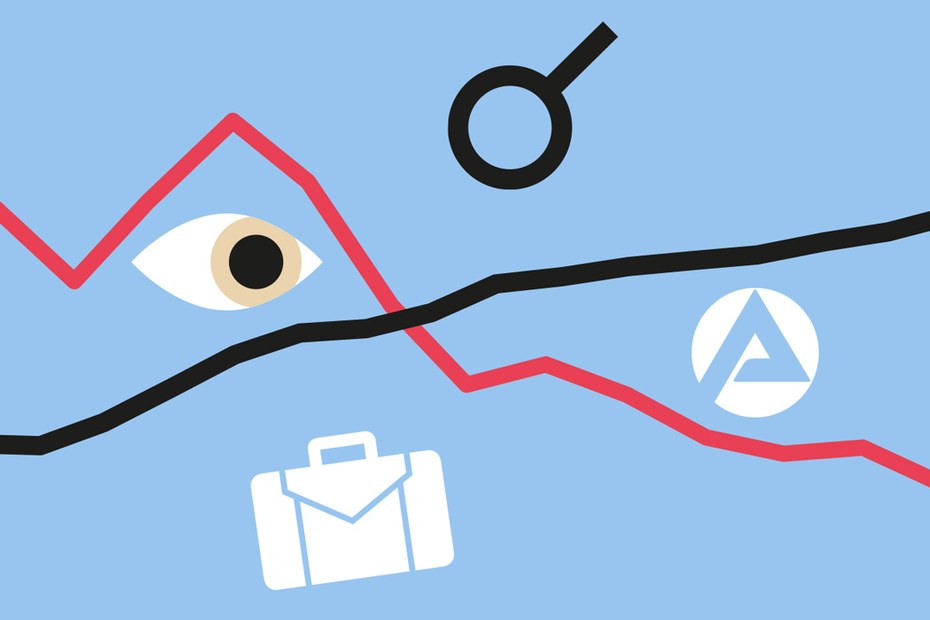Grundlage allen Wirtschaftens ist die Arbeit. Es lohnt, sich das Einfache in Erinnerung zu rufen, bevor wir das Komplexe, Globale in den Blick nehmen. So funktioniert das Gesellschaftssystem, in dem wir leben: Es beruht auf Arbeit. Das gilt für alle gesellschaftlichen Bereiche und damit auch für die Unternehmen. Ohne die Arbeit der abhängig Beschäftigten gibt es für Unternehmen keine Gewinne.
Im marktwirtschaftlich-kapitalistischen System sind Renditen und Gewinne aber offenbar Teil einer Art Gesellschaftsvertrag. Wenn die Löhne steigen, schrumpfen die Renditen: Doch hier kennt das System keinen Humor. Dann wird umstrukturiert, es werden hektisch Produktionsprozesse ausgelagert, internationale Lieferketten etabliert, globale Unternehmenszusammenschlüsse ge
irtschaftens ist die Arbeit. Es lohnt, sich das Einfache in Erinnerung zu rufen, bevor wir das Komplexe, Globale in den Blick nehmen. So funktioniert das Gesellschaftssystem, in dem wir leben: Es beruht auf Arbeit. Das gilt für alle gesellschaftlichen Bereiche und damit auch für die Unternehmen. Ohne die Arbeit der abhängig Beschäftigten gibt es für Unternehmen keine Gewinne.Im marktwirtschaftlich-kapitalistischen System sind Renditen und Gewinne aber offenbar Teil einer Art Gesellschaftsvertrag. Wenn die Löhne steigen, schrumpfen die Renditen: Doch hier kennt das System keinen Humor. Dann wird umstrukturiert, es werden hektisch Produktionsprozesse ausgelagert, internationale Lieferketten etabliert, globale UnternehmenszusammenschlXX-replace-me-XXX252;sse geplant, Nullrunden bei den Löhnen gefordert, Löhne und Gehälter gesenkt, Menschen entlassen und dergleichen mehr. Seit den 1970ern nennen wir dies: „Globalisierung“.Einer der Treiber der wirtschaftlichen Globalisierung war das Ausnutzen des Lohngefälles zwischen verschiedenen Ländern: Outsourcing wurde global betrieben. Massenarbeitslosigkeit und Prekarisierung – auch in Deutschland – waren die Folge. Das Gespenst der Arbeitslosigkeit brachte Existenzängste in den Alltag der sozialen Marktwirtschaft. Lohnverhandlungen wurden oft zu Beschäftigungssicherungsgesprächen. Keine gute Zeit für abhängig Beschäftigte.Jetzt aber gerät die Globalisierung als Erpressung mit der Produktionsverlagerung unter Druck. Coronabedingte Lieferengpässe, Reisebeschränkungen und Quarantäneregelungen wirken drosselnd. Aber nicht nur. Auf einmal werden auch die verborgenen Kosten der unregulierten Globalisierung sichtbar: Globale Arbeitsteilung und globale Lieferketten schlagen auf die CO2-Bilanz durch. An dauerhaft positive gesamtwirtschaftliche Effekte einer weiteren Ausweitung der Globalisierung glaubt heute kaum noch jemand. Aber welchen Einfluss hat dies auf den heimischen Arbeitsmarkt? Erleben wir nun auch das Ende von globalisierungsbedingten Entlassungen und Lohnsenkungen?Renditen versus LöhneZu den Fakten: In Deutschland gibt es 33,73 Millionen abhängig Beschäftigte, im Juli 2021 lag die offizielle Arbeitslosenquote bei 5,6 Prozent, der Vergleichswert für Jugendliche bis 20 Jahre bei 3,5 Prozent. Die aktuellen Werte der offiziellen Arbeitslosenquote liegen unter den Vergleichswerten von vor fünf Jahren. Diese rückläufige Arbeitslosigkeit könnte schon an sich als Argument in Lohnverhandlungen dienen. Aber auch die abflachende Globalisierungsdynamik hilft.Denn mit der Globalisierung wurden nicht einfach nur Produktion verlagert und Arbeit zu Billigstlöhnen eingekauft und imperiale Ausbeutungsmechanismen verfestigt. Zugleich wurden auch zentrale Aspekte des Effizienz-, Produktivitäts- und Profitdenkens exportiert. In einem solchen Gefüge werden Löhne und Lohnnebenkosten zu Arbeitskosten zusammengefasst. Denn hier geht es um wichtige Verteilungsfragen – auf nationaler Ebene wie im internationalen Gefüge. Lohnentwicklungen spiegeln demnach nicht nur die Wirtschaftsentwicklung, sondern auch Verteilungskämpfe wider. Kapitalseite oder abhängig Beschäftigte, welche Seite soll wie viel vom Mehrwert bekommen? Die alte Marx’sche Frage ist immer noch virulent und auch global relevant.Bereits 2018 berichtete das Handelsblatt von hohen Lohnsteigerungen in China. Demnach stiegen die Löhne und Gehälter dort zwischen 2012 bis 2017 um jährlich ganze 9,8 Prozent. In einigen Bereichen liegen die Löhne inzwischen über den Vergleichswerten in Deutschland. Tatsächlich spricht einiges dafür, dass sich gerade im internationalen Arbeitsmarktsegment für hochqualifizierte Fachkräfte eine weltweite Konvergenz der Löhne andeutet. Hochproduktive Arbeit wird inzwischen nahezu weltweit mit hohen Löhnen honoriert. Der Kapitalismus funktioniert tatsächlich global – auch wenn nicht alle abhängig Beschäftigten weltweit gleichermaßen von steigenden Löhnen profitieren können. Es hängt einmal mehr von der Qualifikation ab. Denn Arbeit ist nicht Arbeit.Trotzdem deutet dies darauf hin, dass sich in Zukunft nicht mehr so einfach leichte Renditen durch weitere Globalisierung erzielen lassen werden. Eine internationale Konvergenz der Löhne bedeutet mittel- und langfristig auch eine internationale Angleichung der Preise. Bestenfalls könnten dann noch Wechselkurseffekte eine Rolle spielen. Damit würde eine weitere Globalisierung keinen Sinn machen.Mit der Globalisierung wurde aber nicht nur das Profitdenken exportiert, sondern auch das Thema Lohnverhandlungen. Diese laufen natürlich in den einzelnen Volkswirtschaften unterschiedlich ab. Trotzdem lernen hier wohl gerade die abhängig Beschäftigten in Deutschland vieles dazu. So lässt sich erkennen, dass gerade auf dem internationalen Arbeitsmarkt beliebte Boni, Vergünstigungen und sonstige Zuwendungen ebenso wie flache Hierarchien und vieles mehr in Deutschland mühselig etabliert werden, um Fachkräfte zu gewinnen und zu halten. Einige Studien deuten darauf hin, dass diese von der modernen Betriebswirtschaftslehre empfohlenen Praktiken wichtiger sind als pure Gehaltssteigerungen. Doch in beiden Bereichen gibt es noch Luft nach oben.Nach den Angaben des Statistischen Bundesamtes lag der durchschnittliche Bruttostundenlohn bei Vollzeitbeschäftigten im produzierenden Gewerbe im ersten Quartal 2021 bei 24,93 Euro; das entspricht einem durchschnittlichen Bruttomonatslohn von 4.022 Euro. Bei einer Teilzeitbeschäftigung sinkt der Bruttostundenlohn auf 21,61 Euro – warum? Niemand weiß es so recht. Der Gender-Pay-Gap findet hier eine seiner Quellen.Tatsächlich sind in Deutschland die Reallöhne im 1. Quartal 2021 um 2 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2020 gesunken. Nun gut, könnte man argumentieren, die Gesamtwirtschaft ist im letzten Jahr um fast 5 Prozent eingebrochen, da muss sich dies doch auch in den Löhnen zeigen. Faktisch kommt der Rückgang aber weniger durch sinkende Nominallöhne, sondern durch die Inflation zustande.Grundlage allen Wirtschaftens ist die Arbeit – soweit waren wir uns ja schon einig. Das gilt in jedem Land, daher auch in Zeiten der Globalisierung. Erst durch Arbeit entsteht Output. Auffallend ist, dass die Produktivitätsentwicklung in Deutschland zuletzt relativ gering war. Dies wird in der Regel mit dem Übergang zur Dienstleistungsgesellschaft in Verbindung gebracht, vielleicht hat es aber auch eher etwas mit der Art der Berechnung der Produktivität zu tun.In jedem Fall lassen sich zahlreiche Argumente für eine kräftige Lohnentwicklung in Deutschland finden. Als Faustregel dabei mag gelten: Produktivitätsentwicklung plus Inflation als Mindestforderung. Wenn die Inflation bei 2 Prozent liegt, führt diese Formel automatisch zu Lohnsteigerungen von etwa 3 Prozent pro Jahr. Allgemein gesprochen: Erst ab diesem Schwellenwert würde der Verteilungskampf um den Mehrwert überhaupt greifen. Die Formel ist einfach. Die Umsetzung aber ist schwieriger; höhere Löhne wollen erst noch erkämpft werden.