Zwischen gestern, dem 16. Januar, und Sonntag dem 20. finden wieder die Konzerte des seit 1998 jährlichen Berliner „Festivals für neue Musik“ Ultraschall statt. Veranstaltet von den beiden Rundfunksendern Deutschlandfunk Kultur und kulturradio vom rbb, bleibt es auch in diesem Jahr seinem Ansatz treu, „jüngst entstandene Werke in einen musikhistorischen Kontext [einzubinden], der bis zu den Anfängen der Nachkriegsavantgarde zurückreicht, also mittlerweile immerhin einen Zeitraum von mehr als 70 Jahren umfasst“. Da es aber ein Jubiläumjahr ist, das zwanzigste, werden Andreas Göbel vom rbb und Rainer Pöllmann vom Deutschlandfunk im Vorwort des Programmbuchs noch grundsätzlicher. Seit sich, stellen sie fest, „die digitale Revolution beschleunigt und alle Lebensbereiche durchdringt, [...] wird die Zerstreuung größer, sorgen die sozialen Medien für eine Auflösung dessen, was in Vorzeiten ‚Muße‘ genannt wurde.“
„Auch die Neue Musik ist von diesen Strömungen erfasst. Ein Festival wie Ultraschall Berlin kann und will vor solchen Entwicklungen nicht die Ohren verschließen. Gleichwohl setzt das Festival hier ganz bewusst einen Kontrapunkt zu Tendenzen der jüngsten Zeit. Nicht die extensive zeitliche Ausweitung von Hörfeldern, sondern die Intensivierung und die Konzentration auf das genaue Hören ist unser Ziel – ein Bekenntnis zum ‚kritischen Hören‘, einem selbstbewussten und seines Selbst bewussten Hören und Begreifen dessen, was zeitgenössische Künstler zu sagen haben.“ (Hervorhebung im Original)
Solche „Konzentration“ grenzt sich wohl nicht nur von überlangen Kompositionen ab, sondern auch von der Tendenz, dem Komponieren gleichsam auszuweichen, dadurch dass es zum bloßen Element irgendwelcher Hybride herabgesetzt wird. Dagegen erinnert die Losung „genaues Hören“ an eine pur innermusikalische Entwicklung, die immer noch mit Adornos Frage, bei welchem „Materialstand“ sie inzwischen angelangt ist, erfasst werden kann. Zum „Material“, mit dem komponiert wird, gehören beispielsweise die Töne. Und gerade sie rücken seit Jahrzehnten immer mehr in den Fokus des Komponierens. Das hat den mehr formalen Aspekt, dass sie nicht mehr so genommen werden, wie sie ‚sind‘, das heißt wie wir sie aus den Tonleitern des „wohltemperierten“ Klaviers kennen; und es hat den mehr inhaltlichen Aspekt, dass an der Musik die metaphorisch so genannten Farben hervortreten. Die Farben treten aber auch deshalb hervor, weil eine weitere innermusikalische Tendenz darin besteht, das Schlagwerk zu vergrößern und gerade auch klanglich zu differenzieren. Um das mitzuvollziehen, muss man in der Tat ganz anders zuhören als früher etwa einer „tonalen“ Symphonie, bei der es noch reichen mochte, sich pauschal zu fragen, worauf sie hinausläuft und ob das ihr Anfang schon erahnen lässt. Indem solche Musik per aspera ad astra strebte, ähnelte sie zwar nicht schon dem Kriminalroman, konnte es aber an Spannung mit ihm aufnehmen.
Für das erste Werk, das gestern Abend gegeben wurde, die Recherche sur le fond für Orchester (2010/11) von Charlotte Seither, war es Programm, die Töne ‚nicht zu nehmen wie sie sind‘. Wie es bei Ultraschall üblich ist, gab es nach der Aufführung ein Gespräch mit der Komponistin, da wurde sie auf von ihr veröffentlichte Sätze angesprochen: „Komponieren heißt [...] zuallererst: zerstören. Wir müssen eine tabula rasa schaffen, auf der alte Anhaftungen aufgegeben werden, um einen Boden für neue Sinnzusammenhänge zu eröffnen.“ Das meint sie aber gar nicht so. Dem frühen Boulez, der als erster so gesprochen hat, waren solche Formulierungen ernst und seine „seriellen“ Stücke erinnern wirklich an nichts, was jemals vor ihm geschaffen wurde. Seither hat aber im zitierten Text zuvor gesagt: „Wir müssen die Dinge zerlegen, um sie in ihrer Autonomie begreifen zu können.“ (Alle Hervorhebungen im Original) Zerlegen und Zerstören ist ja nun nicht dasselbe. Wollte man sagen, die Autonomie einer Sache werde durch deren Zerstörung begreiflich, es wäre Unsinn. Seither findet also die treffende Formulierung nicht, die besagen würde, dass sie gerade nicht zerstören, sondern zerlegen - nicht vernichten, als gälte es, einen Feind zu liquidieren, sondern auflösen will, wie man ein Rätsel löst. Aber ihre Komposition ist ‚treffend‘ in diesem Sinn und so konnte sie es im Gespräch auch erläutern.
Wenn sie etwas „zerstört“, dann nur jene Gewohnheit, die sich an den von der wohltemperierten Skala vorgegebenen Ton klammert. Was ist unter diesem Ton, fragt sie, oder was ist sein Grund. Deshalb bewegt sich ihre „Suche“ (Recherche) „auf dem Grund“ (sur le fond). Was sie aber findet, widerspricht der Erwartung, die den Grund mit dem Boden zu identifizieren pflegt, was musikalisch auf tiefe Töne hinauslaufen würde. Die 20minütige Komposition beginnt zwar mit tiefen Tönen, Posaunenglissandi vor allem, die den Verlauf über längere Zeit bestimmen. Sie setzen schon tief ein und und gleiten fallend noch tiefer in kurzen Bewegungen, die an Sirenen oder Bomben des Zweiten Weltkriegs erinnern. Man nimmt sie als einzelne wahr, da es aber so elementare, leicht verständliche Figuren sind, verknüpfen sie sich auch hörbar zum Gesamtgemälde. In diesen Glissandi ist natürlich schon der ganze Tonbereich zwischen zwei Halbtönen präsent, so aber, dass es dem Ohr vertraut ist. Über dem Feld der Tiefe schweben gelegentlich winzige Kratzer der Violinen in äußerster Höhe, die zunächst nichts ausrichten können. Doch dann gelangt man zum Ziel dieser Komposition, dem erreichten „tieferen Grund“, von dem Seither schreibt, es sei ein „lang ausschwingendes Tableau, auf dem die Zeit dann wie im Akte der inneren Betrachtung fast still zu stehen scheint“, angekommen nach dem Ausgang „vom Detail“ bei der „Übergeordnetheit der Zeit als Ganzes“ – und hört mit Erstaunen, dass die „Tiefe“ des Grundes nicht wörtlich gemeint ist. Es ist ein solcher letzterreichbarer Grund, der gerade durch höhere Töne dargestellt wird, wenn auch ein leiser tiefer Ton den ganzen Schlussteil hindurch gehalten wird.
Dazu hat Seither im Gespräch gesagt, es gehe ihr um den „Hintergrund“ der Töne. Wenn der Grund im Hintergrund ist, spielt die Höhe oder Tiefe der Töne gar keine Rolle. Die bedrohlichen Klänge am Anfang haben uns nur bei unserer Erwartung abgeholt und diese zugleich schon in Zweifel gezogen! Denn wie passt das zusammen, dass wir nach „Begründung“ suchen und dabei an fallende Bomben denken? Tatsächlich habe ich schon eine Heidegger-Interpretation gelesen, in der es heißt, der Philosoph habe als tiefsten Grund das Vernichten präsentiert (in seinem Buch Der Satz vom Grund, 1956). Seither aber will keine Tiefe als freien Fall ins Nichts. Und wenn im Zielabschnitt ihres Werks die höheren Töne dominieren, soll damit ebenso wenig gesagt werden, dass in der Höhe, im Himmel womöglich, der Grund sei. Worauf sie vielmehr hinauswill, wird in einer wiederum sehr eingängigen Formel des Schlussteils deutlich: Drei nunmehr in tonaler Akkordzerlegung herabsteigende Töne, die sich mit einem komplexen, aber doch einfach erscheinenden atonalen Feld umkleiden, sicher unter Einschluss von Vierteltönen, ohne Aufregung von hellen Holzbläsern gespielt, werden in Abständen wiederholt. Sie sind da, sagt man sich; man muss nur den Blick für sie haben, oder er muss erweckt werden.
Dass der Titel des Werks an Marcel Prousts Roman À la recherche du temps perdu erinnert, dürfte kein Zufall sein.
Der Konzertabend klang aus mit Joanna Woznys Archipel für Orchester (2008). Es waren Klangfelder, getrennt durch länger werdende Pausen. Pausen sind selber Musik, wie Schweigen zum Sagen gehört. Weil es Inseln sind, die im Meer des Schweigens auftauchen, werden sie „genau gehört“, und so war die Differenziert- und Verschiedenheit der leisen Aquarelle zwischen den Pausen ein Hörgenuss. Zwischen Seither und Wozny wurde Capriccio für zwei Klaviere und Orchester (2010) von Philippe Boesmanns aufgeführt, es gehört zu den Werken, bei denen es sinnlos geworden ist, nach dem Unterschied von „tonal“ und „atonal“ zu fragen. Wobei dieses hier in seiner gewollt traditionellen Gestik der tonalen Schlagseite zuneigt. Es wurde mit nostalgischer Absicht verfasst und erinnert durch den Schleier seines Entstehungsjahrs hindurch an Ravel, auch wohl an Gershwins Amerikaner in Paris. Das ganze Konzert ist heute Abend ab 20.03 Uhr im Deutschlandfunk Kultur zu hören, dann noch einmal am 2. Februar bei rbb kultur. Es spielte das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin unter Leitung vom Sylvain Cambreling; an den Klavieren das GrauSchumacher Piano Duo. Was mich angeht, ich werde morgen mein nächstes Konzert besuchen, am Sonntag zwei weitere und davon jeweils berichten.
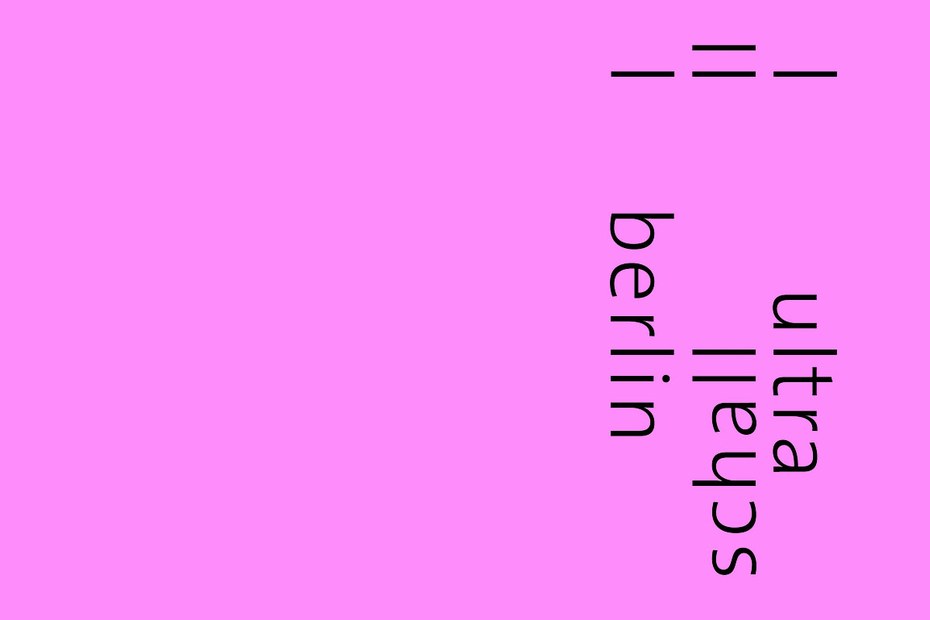





Was ist Ihre Meinung?
Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.