Ist es wirklich wahr, dass „jeder Wissenschaftler“, wie Habermas behauptet, „die Phänomene im Gegenstandsbereich seiner Disziplin“ von einem „fiktive[n] Nirgendwo“ aus betrachten muss? Und wenn es vielleicht nur eingeschränkt wahr ist – der Wissenschaftler „muss“ nicht, tut es aber faktisch; nicht alle, sondern nur einige tun es; oder nicht so sehr die Wissenschaft als vielmehr eine bestimmter Blick auf dieselbe ist dafür verantwortlich zu machen -, wie könnte es dazu gekommen sein? Diese Fragen will ich mir heute ausschließlich vorlegen und dabei auch außer Acht lassen, dass Habermas mit der Betrachtung vom Nirgendwo her, dem „view from nowhere“, wie er auch sagt, keineswegs sympathisiert, sond
Die Aus-dem-Nichts-Sage (2)
Habermas Leitet ein „view from nowhere“ die Naturwissenschaft? Sicher nicht ihre Praxis; die Frage kann nur sein, wann, wo und warum die Vorstellung aufgekommen ist
Exklusiv für Abonnent:innen
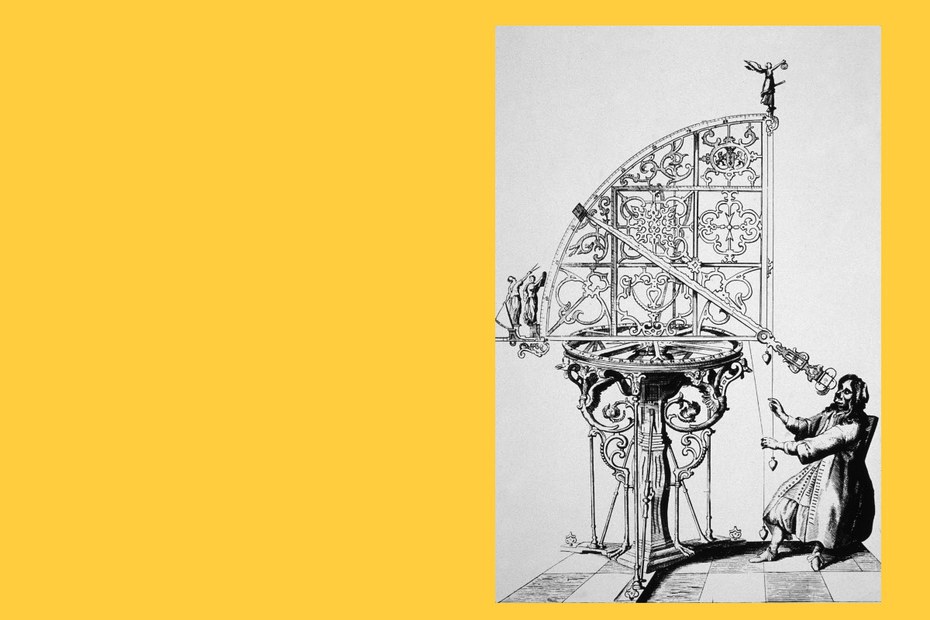
Objektive Gesetze sind unabhängig vom Beobachterstandpunkt, meint Olaf L. Müller
Zeichnung: Hulton|Archive/Getty Image
ondern nur eben meint, sie sei wissenschaftlicher Standard und als solcher ohne Alternative. Auch darauf, dass er den View in der „Lebenswelt“ verankert wissen will und was er von dieser erwartet, gehe ich vorläufig nicht ein. Ich will allerdings hier schon ankündigen, dass es durchaus Folgen hat, schädliche Folgen, für seine Philosophiegeschichtsschreibung, dass er sich den View, sei’s auch unwillig, zu eigen macht.Man würde das zunächst nicht annehmen, da es evident scheint, dass er seinen Gegenstand mit großem Engagement untersucht. Er hat es ja gleich am Anfang offengelegt und dann auch wirklich durchgehalten: Wie eine Philosophie noch möglich ist, auch nach dem Abschied von der Religion, die sich um den Menschen dreht, „uns selber“, will er wissen, auch ob die Religion noch unabgegoltene Erkenntnisgehalte birgt, die ins säkular Philosophische zu übersetzen wären. Das sind keine Fragen aus dem „Nirgendwo“, wie überhaupt gilt, dass aus einem Nichts zu blicken etwas anderes ist als zu fragen. Wer fragt, will immer Bestimmtes wissen, die Frage selber ist immer bestimmt, hat Voraussetzungen, die in sie eingehen, kann nicht aus Nichts bestehen und schon deshalb aus ihm auch nicht herrühren. Ist es also vielleicht so, dass Habermas diesen „Nirgendwo“-Schuh nur ungeschickter- und unnötigerweise anzieht? Nein, das ist nicht der Fall. Ich kann es allerdings erst in der nächsten Folge zeigen. Wir werden dann sehen, dass der View, um den es hier geht, als „Blick“ auf Sachverhalte nicht nur eine Art zu beobachten sondern auch eine Denk- und Äußerungsweise meint, eine „Perspektive“ eben insgesamt. Auf dieser Ebene erst zeigen sich die fatalen Konsequenzen, oder Implikationen, der Habermasschen Unterstellung.Placeholder infobox-1Eine ganz besonders fatale Konsequenz habe ich übrigens schon in der Buchbesprechung benannt: die Behauptung, Marx als Wissenschaftler habe eine „systemisch verselbständigte“ kapitalistische Ökonomie herausarbeiten müssen. In Habermas‘ Sprache heißt „systemisch verselbständigt“ auch so viel wie nicht mehr änderbar. Dabei belegt er Marx‘ Wissenschaftlichkeit mit dessen „Einstellung des Beobachters“, was im Kontext seiner Philosophiegeschichte einen Beobachter „aus dem Nirgendwo“ bedeutet. Wir hatten aber noch nicht verstanden, wie Habermas zu so einem Urteil über Marx gelangen kann.In der heutigen Folge befasse ich mich nur mit der „Einstellung des Beobachters“ und setze bei der Naturwissenschaft an, auf die sich Habermas vor allem beruft. Der „view from nowhere“, so scheint mir, ist eine reichlich ungenaue Beschreibung dessen, was ein Naturforscher rationalerweise tun muss. Worauf kann man den Ausdruck beziehen? Der Philosoph und Wissenschaftshistoriker Olaf L. Müller formuliert es so: „Die Naturgesetze sollten besser nicht von unserer zufälligen Position im Universum abhängen, weil es ihnen sonst an Objektivität mangeln würde; echt objektive Gesetze sind unabhängig vom Beobachterstandpunkt.“ Das heißt wenn man zu Gesetzesaussagen gelangen will, die für das ganze Universum gelten, sollte man berücksichtigen, dass Beobachtungen, die ihnen allerdings zugrunde zu liegen haben, von der Erde aus vielleicht anders ausfallen, als wenn der Beobachter seinen Standort in einem sehr weit entfernten Sternensystem aufschlagen könnte. Wie wir durch Einstein wissen, oder sich vielmehr aus seiner Relativitätstheorie ergibt, die wir als gültig annehmen, ist es tatsächlich so. Wir nehmen also an, dass gewisse Beobachtungen so und so ausfallen würden, wenn wir sie erheben könnten, und natürlich ergänzen wir nun, dass wir insofern überhaupt nicht beobachten – auch nicht „fiktiv“! -, sondern vielmehr das, was nicht beobachtet werden kann, aus Einsteins Theorie erschließen. Diese Theorie muss dann freilich durch Experimente bewährt werden, die für den unmöglichen Beobachterblick aus der Ferne doch irgendwie ein Äquivalent bieten, und wie man weiß, ist das auch möglich. Es ist geschehen, man hat zum Beispiel die „Rotverschiebung“ gesehen. Dazu aber wiederum hat man nicht „from nowhere“ geblickt, sondern gerade so, wie wir immer blicken, aus unserer irdischen Lebenswelt heraus.Und mehr noch. Nicht nur was wir nicht beobachten können, erschließen wir aus Einsteins Theorie, und wenn nicht aus ihr, dann aus einer anderen, sondern auch was wir beobachten können. So hat man jene „Rotverschiebung“ beobachtet, aber hätte man es getan, wenn nicht Einsteins Theorie zu prüfen gewesen wäre? Es gibt überhaupt keine Beobachtung, die nicht theoriegeleitet ist, die also nicht deshalb zustande kommt, weil man etwas sucht oder mindestens erwartet oder weil, das sind die Grenzfälle, „Instinkte“ den Blick leiten oder etwas auffällt, das man von seinem Wissens-Background her, sei er wissenschaftlich oder alltäglich, gerade nicht hat erwarten können. Die Beobachtung kommt also nicht from nowhere, sondern aus der Theorie im engeren oder weiteren Sinn, wir können auch formulieren, sie kommt aus einer Suche oder Frage, ob das nun bewusst oder unbewusst / vorbewusst geschieht.Das von überallher gesehene HausVon daher muss nun auch gefragt werden, ob oder wieviel dieses Konstrukt „view from nowhere“ mit der Praxis wirklicher Forscher überhaupt zu tun hat. Man kann jedenfalls nicht sagen, es habe sie seit Beginn der Neuzeit immer schon bestimmt. Schon deshalb nicht, weil sie anfangs ja noch „Gott“ unterstellten, sei’s auch nur den deistischen, an welchem Umstand auch ihr „methodischer Atheismus“, an den Habermas erinnert, nichts änderte. Man sieht es an Leibniz, einem Philosophen, der auch wissenschaftlich viel geleistet hat. Leibniz‘ Monadenlehre ist durch und durch eine Philosophie des Standpunkts und der Perspektive: Das ganze Universum besteht aus „Monaden“, in denen es sich jeweils abbildet, immer aber nur in dem Maß, wie der Ort der Monade, und auch die Qualität ihrer Perspektive, die bei der Menschen-Monade, unter allen Geschöpfen, die beste ist, es zulässt. Nur der unendliche „Gott“ ist an all das nicht gebunden. Der Forscher kann sich freilich an seine Stelle versetzen, aber nicht durch einen view, sondern indem er das „Geometral“ errechnet, die Integration aller denkbaren Perspektiven. So Leibniz, und ähnlich hatte schon Cusanus argumentiert: Mit unserer armen Vernunft können wir Gottes Unendlichkeit zwar nicht erfassen, aber doch in einer „docta ignorantia“, das heißt mathematisch, mit ihr rechnen.Und auch Einstein hat es dann so gemacht. Wenn er einmal sagte „Gott würfelt nicht“, war das zwar wohl nur eine Redensart. Doch waren Wissenschaft und Engagement bei ihm nicht getrennt. „Warum Krieg“, wollte er einmal von Freud wissen und erwartete eine wissenschaftliche Antwort. Freud war ebenfalls engagiert, auch wenn er nichts wusste, was Einstein hätte trösten können. Leibniz und Cusanus spielen in Ernst Cassirers Genealogie der neuzeitlichen Naturwissenschaft zentrale Rollen, Habermas indes behandelt sie nicht. Auf Leibniz‘ „Geometral“ kommt aber Maurice Merleau-Ponty in seiner Phänomenologie der Wahrnehmung zu sprechen (Berlin 1965, Orig.ausg. Paris 1945). Während „ich“, so Merleau-Ponty, „das Haus gegenüber unter einem bestimmten Gesichtswinkel“ sehe, sei „das Haus selbst“ laut Leibniz „das Geometral dieser und aller möglichen Perspektiven, d.h. der nichtperspektive Term, von dem alle Perspektiven abzuleiten wären, es ist das Haus, von nirgendwo gesehen. Doch was soll eine solche Redeweise bedeuten?“ „Betrachte ich die Lampe auf meinem Tisch, so schreibe ich ihr nicht nur die von meinem Platz aus sichtbaren Eigenschaften, sondern auch die noch zu, die der Kamin, die Wände, der Tisch ‚sehen‘ könnten“ oder anders gesagt, sie gehört zu den Dingen, die ich, ohne „Gott“ zu sein, einfach dadurch umfassend sehen kann, dass ich um sie herumlaufe oder aufhebe und in meiner Hand kreisen lasse. „Jene zuvor ausgesprochene Formulierung bedarf also der Modifikation: das Haus selbst ist nicht das von nirgendwo gesehene, sondern das von überallher gesehene Haus.“So spricht ein Phänomenologe, indessen hat Habermas die von Edmund Husserl herrührende philosophische Tradition in seine Erörterung nicht aufgenommen, obwohl er einräumt, dass sein zentraler Begriff der „Lebenswelt“ von Husserl geprägt wurde. Wie er in der Einleitung darlegt, sieht er nämlich in allem, was nach den Junghegelianern philosophiegeschichtlich noch vorgefallen ist, keine wesentliche Neuerung mehr; die großen Figuren des 20. Jahrhunderts führt er auf den oder jenen Junghegelianer zurück, mit deren ausführlicher Erörterung er sein Werk daher abschließt, während er jene Figuren nur in der Einleitung kursorisch abhandelt. Er meint auch, sie hätten auf die Krisen ihrer Zeit nur mit regressiven Rückkehrversuchen reagiert, so Heidegger mit dem Rekurs auf die Vorsokratiker. Er, Habermas, gehe aber davon aus, dass die Menschheit in ihrer Entwicklung immer auch etwas gelernt habe. Ich meine, er sieht nicht, dass Heidegger gar nicht anders vorgegangen ist als er selber: Zu einer Wegscheide Zurückgehen mit der Frage, ob man damals auch einen anderen Weg, oder einen zusätzlichen, hätte einschlagen können. Ist das nicht genau auch seine Methode, wenn er fragt, ob von der Religion nach ihrer Verabschiedung noch etwas zu lernen ist? Geht er nicht bis zu deren Quellen zurück? Und hat sich das Verfahren nicht glänzend bewährt mit seinem neuem Blick auf die Achsenzeit?An dieser Stelle will ich aber nur die schiefe Einordnung Heideggers monieren. Heidegger erscheint bloß als Nachfolger Kierkegaards, der seinerseits zum Junghegelianer erklärt wird. Ich sagte schon, dass auch Peirce, von dem sich Habermas selbst herleiten will, von ihm zu einem solchen gemacht wird, und so kann denn das Werk mit dem 19. Jahrhundert beschlossen werden. Doch leitet sich Heidegger – auf Habermas‘ Polemik gegen ihn komme ich später noch einmal zurück - nicht nur von Kierkegaard sondern auch von Husserl her, er schreibt nicht nur, in seinen Anfängen, existenziell wie Kierkegaard, sondern ist auch Phänomenologe wie später Sartre und Merleau-Ponty, die alle nicht behandelt werden.Husserl selbst ist nicht nur schief sondern gar nicht eingeordnet. Husserl und seine Folgen - das ist schon eine empfindliche Lücke, die den Wert dieser Philosophiegeschichte etwas einschränkt. Habermas ist in gewisser Weise durch Hegel beschränkt, über dessen Horizont er im Grunde nicht hinausblickt. Das ist nicht nur negativ zu sehen, denn man kann auch sagen, er schöpft diesen Horizont aus. So sieht er wie Hegel in der Philosophiegeschichte eine Fortsetzung der Religionsgeschichte, was zu kritisieren ich nach der Habermas-Lektüre keinerlei Anlass habe. Und auch wie er in Hegel schon den Keim des Peirceschen „Pragmatismus“ sieht, ist interessant. Mit Hegels Begriff des „objektiven Geistes“ sei bereits die gesellschaftliche Intersubjektivität umfasst, wenn auch noch nicht als demokratische ausbuchstabiert. Diese Erweiterung des Subjektbegriffs wird jedermann begrüßen. Ich komme auch hierauf später zurück. An der Subjekt-Objekt-Trennung, die Habermas zuvor ausgewiesen hat, ändert sie allerdings nichts. Denn es ist ja klar, wenn der einzelne Wissenschaftler „aus dem Nirgendwo“ zu blicken glaubt, dann nicht aus eigener Neigung, sondern weil das Wissenschaftler-Intersubjekt ihn dazu nötigt.Aber tut es das wirklich? Das wollen wir jetzt fragen.„Nihilismus“ nach 1848Manches spricht dafür, dass der view from nowhere nicht so sehr von der Naturwissenschaft herrührt als von deren Indienstnahme durchs Kapital. Das Kapital steht, wenn wir Marx folgen, erst „auf eigenen Füßen“, sobald es sich seine „adäquate technische Unterlage“ geschaffen hat, das ist die „Maschinerie“, die sich der „bewussten Anwendung der Naturwissenschaft“ verdankt. Nach neuerem Forschungsstand ist das erst seit 1848 geschehen, typischerweise also gerade in dem historischen Augenblick, als Marx das Kapital zu erforschen begann. Und so hat dieser es definiert: „Das Kapital als solches setzt nur einen bestimmten Mehrwert, weil es den unendlichen nicht at once setzen kann; aber es ist die beständige Bewegung, mehr davon zu schaffen.“ Unendlichkeit - Marx gibt dem erstrebten Mehrwert das Attribut, das seit Scotus und Cusanus Gott (seit Spinoza und Leibniz Gott „oder der Natur“) zugeschrieben wird. Walter Benjamin hat es später ausgesprochen: Das Kapital strebe unbewusst danach, sich an Gottes Stelle zu setzen. Sie als Nichts-Stelle auszugeben, würde einfach die Gewohnheit fortsetzen, das Eigeninteresse bloß am Profit hinter einer Maske, oder Tarnkappe, zu verbergen.Daraus folgt nun die Hypothese, es habe die Behauptung vom naturwissenschaftlichen Blick aus dem Nichts erst nach 1848 gegeben. Und siehe, sie scheint nicht unplausibel zu sein. Denn auch der „Nihilismus“ hat da seinen Ausgang gehabt. Von Richard Wagner seit der Revolutionsniederlage in Musikdramen gestaltet, wurde der dazu passende Begriff von Friedrich Nietzsche ergänzt. (Auch Nietzsche wird von Habermas nicht erwähnt.) Wenn man genauer hinsieht, zeigt sich aber, dass dieser „Nihilismus“ nicht von allen, die ihn durchlebten, als Fall ins leere Nichts erlebt wurde. Grundsätzlich war es eher so, dass sich die Konstellation der Achsenzeit wiederholte, oder besser gesagt aktualisierte: Der Einbruch schwerer sozialer Verwerfungen – das Elend der gerade erst entstandenen Arbeiterklasse – brachte einige Menschen dazu, sich „außerhalb“ zu stellen, von wo sie sich wieder fragen, was es mit der Menschheit auf sich habe. Bei Marx wird es sogar explizit, er schreibt ja, der Übergang von der Vorgeschichte zur Geschichte der Menschheit stehe jetzt unmittelbar bevor.Das ist natürlich keine „nihilistische“ Reaktion, obwohl Marx‘ Lehre, bezeichnenderweise, von großen Teilen des Bürgertums so wahrgenommen wurde; vielmehr sehen wir, dass verschiedene Intellektuelle sich im Außen, das sie einnahmen, verschieden verhielten; die einen fanden sich wirklich – aus Verzweiflung – im leeren Nichts wieder, andere, wie Marx, fanden zur vollen Abstraktheit des Fragens zurück, das heißt zur sokratischen Haltung: Sie versuchten, nicht als die Person, die sie waren, zu fragen, sondern in ihrer abstraktesten Eigenschaft, die sie von keiner Person unterschied, nämlich Mensch zu sein. Sofern nun Wissenschaftler von sich glauben, sie blickten „from nowhere“, gehören sie zweifellos zu denen, die nihilistisch, also verzweifelt reagieren. Die Eigenschaft, Wissenschaftler zu sein, ist schon ziemlich abstrakt, der Schritt zum noch Abstrakteren, zum Menschen, stünde ihnen aber offen. Viele gehen ihn nicht, sondern verstecken ihre Verzweiflung hinter einem Schein von Gleichgültigkeit. Dass diese Gleichgültigkeit von Aggressivität nicht frei ist, hat Robert Musil in einem berühmten Kapital seines Romans Der Mann ohne Eigenschaften (1930) dargestellt, es ist überschrieben „Das In den Bart Lächeln der Wissenschaft“.Auch Kierkegaard schreibt in den Jahren vor und nach 1848. Verzweifelt ist er nicht, doch ist Verzweiflung sein Thema. Habermas behandelt ihn ausführlich, um ganz andere Zusammenhänge herzustellen. Ich möchte indessen meine Erörterung des view from nowhere mit dem Hinweis auf einen weiteren Romanautor schließen, auf Flaubert. Sein Roman Madame Bovary erschien 1857. Er wurde als neuartig angesehen, weil er Flauberts Grundsatz illustriert, die Erzählhaltung habe unpersönlich, gelassen und objektiv zu sein („impersonnalité, impassibilité, objectivité“). „Der Autor“, schreibt er in einem Brief, „muss in seinem Werk also sein wie Gott in seinem Universum, nämlich überall gegenwärtig und nirgendwo sichtbar.“ Auch aus diesem Grundsatz spricht Verzweiflung, dieselbe, die er seiner Romanheldin gibt - der ennui, die Langeweile, die wiederum auch Kierkegaard beschäftigt. Doch wenn Flaubert aus der Unsichtbarkeit schreibt, orientiert er sich zwar an der Wissenschaft („Ich glaube, dass die große Kunst wissenschaftlich und unpersönlich ist“), schreibt aber keineswegs aus dem Nichts. Vielmehr dient das „Stilprinzip der Unpersönlichkeit“ dazu, so der Literaturwissenschaftler Manfred Hardt, die „Perspektive des Autors, die dem Entstehungsprozess des Werkes zugrunde liegt, kommentarlos und damit um so überzeugender zu übermitteln“.*Hier geht es zum dritten Teil.
×
Artikel verschenken
Mit einem Digital-Abo des Freitag können Sie pro Monat fünf Artikel verschenken. Die Texte sind für die Beschenkten kostenlos. Mehr Infos erhalten Sie hier.
Aktuell sind Sie nicht eingeloggt. Wenn Sie diesen Artikel verschenken wollen, müssen Sie sich entweder einloggen oder ein Digital-Abo abschließen.