Die Metamorphosen für 23 Solostreicher (1945) von Richard Strauss (1864-1949) habe ich oft, sehr oft gehört - eine unglaublich schöne, eindeutig tonale und dabei so originelle Musik, dass man meint, eine der Botschaften, die der Komponist damit verbunden haben mochte, könnte die sein, dass es gar nicht nötig gewesen wäre, der tonalen eine atonale Musik zur Seite zu stellen oder gar jene durch diese abzulösen. Es war das ja jedenfalls die Doktrin des eben untergegangenen NS-Staates, in der jegliche atonale Musik verboten war. Strauss hatte sich da zum Präsidenten der Reichsmusikkammer machen lassen (1933-35) und hatte zu den Olympischen Sommerspielen 1936 die Hymne beigesteuert. Man weiß auch, dass er nach dem verlorenen Krieg fürchtete, die deutsche Musiktradition werde dem Vergessen anheimfallen.
Im Konzertsaal, glaube ich fast, war mir das halbstündige Werk noch nie zu Ohren gekommen. Der gestrige Abend, als das Rundfunk-Sinfonieorchester unter Leitung seines Chefdirigenten Vladimir Jurowski spielte, wurde mit ihm eingeleitet. Es war ein Erlebnis, wozu Jurowskis plastisches Talent sicher viel beitrug. Aber schon seine Entscheidung, die Streicher und Streicherinnen stehend spielen zu lassen, gab der Darbietung eine quasi existenzielle Dimension. Ich werde den Abend so schnell nicht vergessen. Auch das Programmheft mit den sehr guten Beiträgen Steffen Georgis trug zum Erfolg bei. Ich war zum Beispiel noch nicht auf die Idee gekommen, die Metamorphosen in eine Linie mit dem Sextett für Solostreicher, das die Strauss-Oper Capriccio (1942) einleitet, zu stellen; Georgi weist darauf hin, dass auch für die Metamorphosen ein ursprünglich geplantes Sextett die Keimzelle war und dass es eine Frühfassung als Septett gibt, die erst vor wenigen Jahren rekonstruiert werden konnte. Auf die Nähe beider Werke kann der Hörer wahrlich auch ohne solche Hinweise aufmerksam werden, denn es zeichnet sie eine kristallene Reinheit aus, bei äußerst verschlungener Polyphonie, man möchte sagen: wie Glas kurz vor dem Zerspringen, für die man schwerlich noch ein weiteres Beispiel finden wird. Wenn man bedenkt, welche Realitäten hinter der Musik stehen, wird man sagen, sie sei Ideologie. Sie ist aber wohl auch ein Versuch, die „Idee“ der (tonalen) Musik von allem Geschichtlichen zu sondern und gegen es festzuhalten. Mir war die Nähe nie aufgefallen, obwohl ich auch das Capriccio-Sextett sehr gut kenne, wahrscheinlich weil ich die Kontexte der beiden Kompositionen nicht zusammenbrachte; unter Jurowskis Dirigat war sie zu hören.
Ganz am Ende der Metamorphosen wird der Anfang des Trauermarsches aus Beethovens dritter Symphonie, der Eroica (1805), wörtlich zitiert und damit legt Strauss den Charakter der gesamten Komposition offen. Dass sie Züge eines Trauermarsches hat, hört man auch ohne das, ja man hört es in vielen CD-Aufnahmen nur allzu gut, denn sie hinterlassen den Eindruck, das sei schon alles, was sie emotional mitteilt. Während Jurowski zeigt, dass eigentlich nur der Anfang und das Ende trauermarschmäßig komponiert sind. Es ist der Rahmen, der angibt, was das Thema ist: ein Leben als abgeschlossenes. Eingerahmt wird aber eben das Leben. Die Metamorphosen sind überwiegend lebendig und lebensfroh, vor nie fehlendem tragischen Hintergrund freilich, so eben, wie man es von dem Nietzscheaner, der Strauss war, erwartet. Was aber den Rahmen angeht, so hat er den Eroica-Trauermarsch auch schon am Anfang zitiert, ein Stück aus der Mitte des dortigen Themas, eine abwärts laufende punktierte Linie, nur dass man sie wegen des komponierten Umfelds nicht wiedererkennt.
Wo ein Trauermarsch ist, muss auch ein Held sein, der betrauert wird. In der angelsächsischen Forschung wurde oft unterstellt, dieser Held sei für Strauss Hitler gewesen. Die deutsche Forschung hat das zurückgewiesen, und wie ich glaube mit Recht – trotz allem, was ich selbst zum möglichen Stützung der These noch anführen muss. Ich halte es aber doch für wahrscheinlicher, dass der zum Zeitpunkt der Komposition 81-jährige Strauss sich selbst feierte. Es gab ja schon ein Werk von ihm, das Ein Heldenleben betitelt war und ihn selbst zum Thema hatte. Komponiert 1898, da war er 34 Jahre alt! Er ironisiert sich zwar in dieser Komposition und hat natürlich auch den Titel ironisch gemeint, aber trotzdem... Und auch bei der Tondichtung Tod und Verklärung, die er als 25-Jähriger schrieb, wird er an sich selbst gedacht haben: Es soll, wie er schreibt, von einem Todkranken handeln, dem noch einmal „das Ideal“ erscheint, „das er zu verwirklichen, künstlerisch darzustellen versucht hat, das er aber nicht vollenden konnte, weil es von einem Menschen nicht zu vollenden war“. Ja, an Selbstbewusstsein hat es ihm nicht gefehlt. Im Sommer 1942 war er allein vor die Tore des KZs Theresienstadt getreten, wo jüdische Verwandte seiner Schwiegertochter interniert waren; er dachte, wenn er, der berühmte Herr Strauss, da ein Donnerwetter losließ, würde man sie wohl freigeben. Natürlich musste er kleinlaut wieder abziehen.
Die Episode zeigt, dass er alles andere als ein Nazi war. Vermutlich glaubte er, den NS-Staat für sein musikalisches Programm einspannen zu können. Das Programmheft hebt gebührend hervor, dass er nicht nur kein Antisemit war, sondern dies auch öffentlich zur Schau stellte. So ließ er sich zwar von Goebbels zum Präsidenten der Reichsmusikkammer machen, weigerte sich aber, deren Statut zu unterschreiben, das einen Arier-Paragraphen enthielt. Man muss dennoch beklagen, dass sich Steffen Georgi der geläufigen Unsitte anschließt, nur Strauss‘ positive Seiten hervorzuheben. Wir lesen, dass er „die Streicher-Goebbelssche Judenhetze für eine Schmach für die deutsche Ehre“ gehalten hat, ja, so steht es in seinen Privataufzeichnungen. Lesen aber nicht, dass er Hitler dennoch verehrte. Sein Brief an seinen jüdischen Librettisten, den Schriftsteller Stefan Zweig, wird zitiert: „Dass ich den Präsidenten der Reichsmusikkammer mime? Um Gutes zu tun und größeres Unglück zu verhüten. Einfach aus künstlerischem Pflichtbewusstsein! Unter jeder Regierung hätte ich dieses ärgerreiche Ehrenamt angenommen.“ Der Brief wurde abgefangen und kostete Strauss das Amt. Wir lesen nicht, dass er Zweig für dessen Nichtbeteiligung an der „Lügenpropaganda gegen Hitler“ lobte (Brief vom 24.5.1934). Auch nicht, dass er sich gegen den Rausschmiss aus der Musikkammer mit einem Brief an Hitler wehrte (vom 13.7.1935), wo er flehentlich um eine persönliche Unterredung zwecks Rechtfertigung bat. Walter Panofsky schreibt dazu: „Es ist ein beklagenswerter Brief; er gipfelt in einem Kotau vor dem ‚großen Gestalter des deutschen Gesamtlebens‘.“ (Richard Strauss. Partitur eines Lebens, München 1965, S. 295) Also, jenes Amt hatte er bestimmt auch angenommen, um „Unglück zu verhüten“ - aber dass er es nur „ärgerreich“ fand, darf man bezweifeln.
Sicher war er auch nicht traurig darüber, dass Hitler persönlich anwesend war, als sein 75. Geburtstag mit der Darbietung seiner ein Jahr zuvor komponierten Oper Friedenstag gefeiert wurde. Dieser Einakter hat, nebenbei, etwas damit zu tun, dass ich Journalist wurde. Die NS-Presse hatte geurteilt, in ihr habe Strauss erstmals „nationalsozialistisches Ethos“ gestaltet, was sich mir in einer Analyse, die ich dazu schrieb, bestätigte; Strauss hatte sich da in eine Kampagne zur psychologischen Vorbereitung auf den Weltkrieg einspannen lassen („Verbrenne die Mauern, schließe uns ein“. Ein Opernskandal, der totgeschwiegen wird, in: Kommune 1/1990, S. 68-74; das Zitat im Titel stammt aus dem Libretto). Ich war anwesend, als Friedenstag am 3.9.1989, nunmehr um 125. Strauss‘ Geburtstag und 40. Todestag zu ehren, in Westberlin gegeben wurde - wenige Wochen vor der Öffnung der Berliner Mauer am 9.11.1989, diesmal in Anwesenheit des damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker. Was mich besonders erschütterte, waren die dreisten Lügen, die damals im Programmheft standen. Da las man zum Beispiel, Strauss sei 1935 vom Amt des Präsidenten der Reichsmusikkammer zurückgetreten, um damit politisch gegen die Nazis zu demonstrieren. Als Musikliebhaber konnte ich mit Strauss‘ durchwachsener Persönlichkeit leben, nicht aber mit der politischen Szenerie, die ab 1990 heraufzudämmern schien.
Gestern Abend standen noch White für Doppeltrichtertrompete solo (2015, rev. 2016) von Rebecca Saunders und die Fünfte von Beethoven, eingeleitet durch Beethovens Drei Equale für vier Posaunen WoO 30 (1812), auf dem Programm. Diese Equale sind keine besonders anspruchsvolle Musik, haben aber dadurch Bedeutung, dass sie auch zu Beethovens Beerdigung gespielt wurden. Mit der Idee, Beethovens Fünfte durch andere Musik einzuleiten – in beiden Fällen so, dass die eine in die andere direkt überging – hatte sich Jurowski auf dem Musikfest 2017 als neuer Chefdirigent des RSO eingeführt; damals ging Luigi Nonos „Fučik“ (entstanden 1951, uraufgeführt 2006) voraus. Julius Fučik war ein tschechischer Journalist und Schriftsteller, der sich als Mitglied der Kommunistischen Partei in Prag vor den Nazis zu verstecken versuchte, aber doch gefasst und im September 1943 im Gestapo-Gefängnis Berlin Plötzensee hingerichtet wurde. Jurowski versteht es jedenfalls, sein Publikum emotional mitzureißen.
Zu Saunders schreibe ich anlässlich der Film & Live-Musik am Montag, wo sie ebenfalls mit einer Komposition für Trompete Solo beteiligt ist.
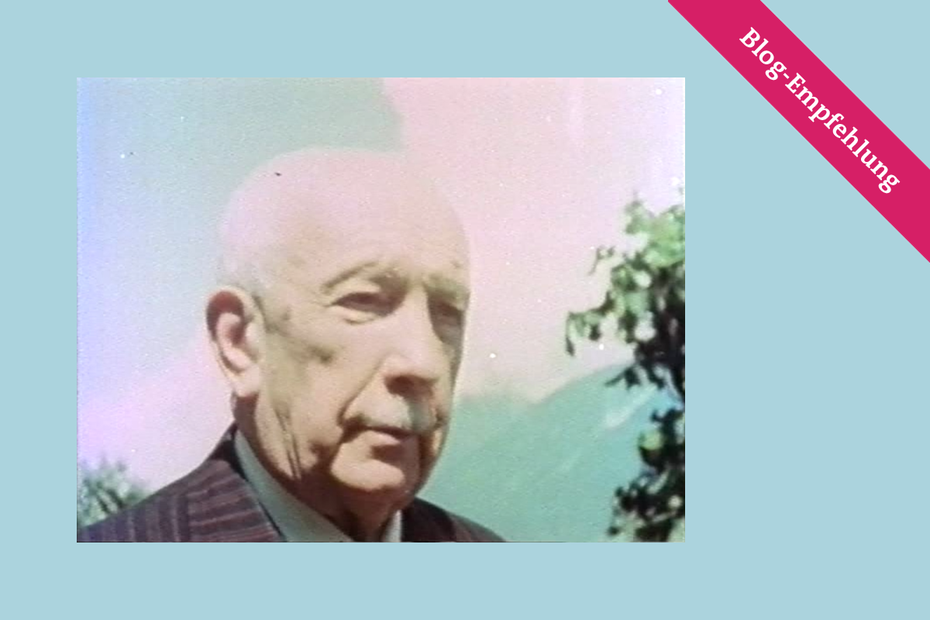





Was ist Ihre Meinung?
Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.