Markus Söder hat recht: dass Angela Merkel und Armin Laschet, die Kanzlerin und der Parteivorsitzende der CDU, sich öffentlich miteinander anlegen – das geht gar nicht. Merkel wirft Laschet vor, er setze gemeinsam beschlossene Corona-Maßnahmen nicht um. Laschet lässt es nicht auf sich sitzen. Erst beruft er sich auf den Föderalismus, dann versucht er plötzlich, Merkel noch zu überbieten. Wie will so eine Partei die anstehende Bundestagswahl gewinnen? Aber in dem Streit steckt mehr, es „verdichten sich“, wie man psychoanalytisch sagen würde, mehrere Ebenen in ihm, das heißt, er kann als „Symptom“ begriffen werden. Symptom wofür? Ziemlich noch an der Oberfläche stellt sich die Frage, ob Söder oder Lasch
Eine Republik des Bundes
Kanzlerin Im Streit über die Corona-Maßnahmen wird der Föderalismus herausgefordert. Und mit ihm das Grundgesetz
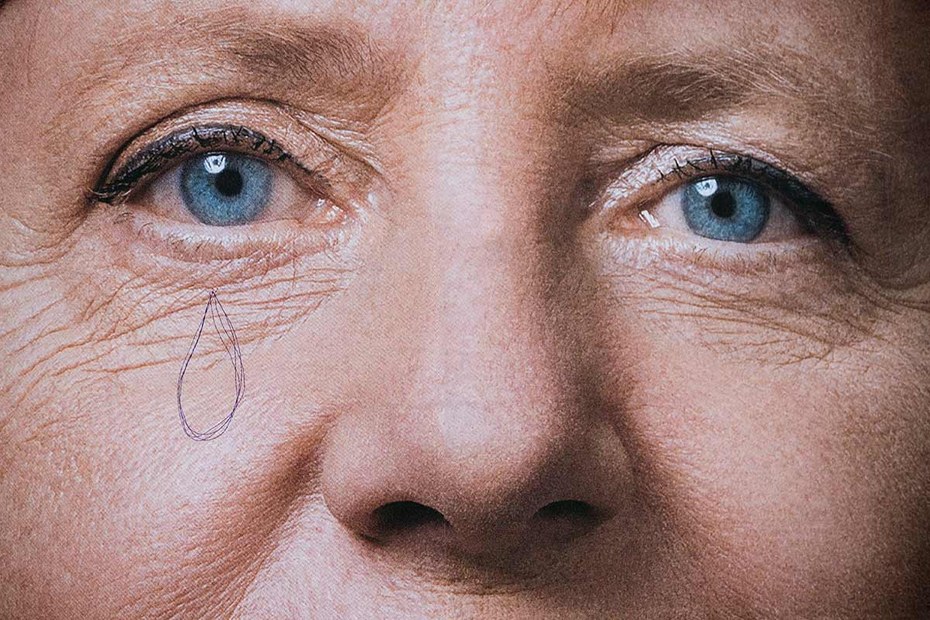
Ob Tränenflüssigkeit eher ein antiviraler Schutz oder ein Ansteckungsrisiko innewohnt, ist noch nicht hinreichend erforscht
Foto: Emmanuele Contini/Nurphoto/Getty Images
schet Kanzlerkandidat der Unionsparteien werden wird. Söder hat zwar recht, wenn er Merkels Streit mit Laschet kritisiert, aber er schürt ihn auch, weil er von ihm profitiert. Denn indem Merkel gegen Laschet Stellung bezieht, unterstützt sie faktisch Söders Kandidatur. Söder wiederum, indem er sich Merkels Kritik an Laschet zu eigen macht, stellt sein faktisches Bündnis mit der faktischen Unterstützerin zur Schau.Zweitens sind aber Söder und Laschet Ministerpräsidenten, der eine von Bayern, der andere von Nordrhein-Westfalen. Merkel hat Laschet nicht nur kritisiert, sondern auch eine Konsequenz angedroht: die Corona-Politik nicht mehr in der Ausführung den Bundesländern zu überlassen, wie es bisher üblich war bei gemeingefährlichen und übertragbaren Krankheiten, sondern sie ganz zu zentralisieren. Den Föderalismus also, dem unser Staat den Namen verdankt – er heißt „Bundesrepublik“ –, zu verändern, zu schwächen. In diese Perspektive gestellt, hat Merkel gar nicht speziell Laschet kritisiert, sondern auch andere Länderchefs, so den saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans, CDU, und den Berliner Regierenden Bürgermeister Michael Müller, SPD. Dass diese beiden Einkäufe in vielen Geschäften zulassen, wenn sich Käufer oder Käuferin durch negative Corona-Tests ausweisen, ist ihr nicht recht.Gleichwertig ja, einheitlich neinAuf einer dritten Ebene müssen wir konstatieren, dass die Politiker von der Corona-Krise überfordert sind. Irrational zu reagieren, liegt dann nahe. Warum erscheint es Merkel und Söder so selbstverständlich, dass eine Gefahr, je größer sie ist, sie desto besser durch Zentralismus bewältigt werden kann? Diese Haltung wendet sich auf die Föderalismusfrage nur an. Mit dem ihr selbst zukommenden Namen wäre sie als „autoritär“ zu bezeichnen. Albrecht von Lucke hat es auf den Begriff gebracht, in den Blättern für deutsche und internationale Politik: Es gibt durch Corona eine „Autoritäts- und Vertrauenskrise“ des parlamentarischen Systems – wie auch des föderalen, wäre zu ergänzen –, was sich im Ruf nach mehr Autorität, mehr Macht für Zentralen und zentrale Personen gerade zeigt. Merkel scheint zunächst nur sagen zu wollen, dass zentral gebündeltes Handeln generell wirksamer sei als zerstreutes. Aber sie kann es nicht lassen, zusätzlich noch auf ihre Kompetenz als Physikerin zu verweisen. Was soll eigentlich dafür sprechen, dass sie mehr von Corona versteht als Laschet? Sie haben doch beide ihre wissenschaftlichen Berater.Aber wer entscheidet heute schon, was wissenschaftlich ist und was nicht: Sind es die Einschätzungen eines Hendrik Streeck? Oder die eines Christian Drosten? Was ist mit Roland Wiesendanger? Vor nicht langer Zeit hat die Exzellenzuniversität Hamburg eine Studie unter Leitung dieses Physikers veröffentlicht, der zufolge das Coronavirus einem virologischen oder auch biowaffentechnischen Labor entwichen sein könnte. Heikle These. Im Spiegel wusste eine Journalistin, „dass es sich um wissenschaftlichen Unfug handelt“. So fertigt man heutzutage einen forschenden Nanowissenschaftler ab. Einer Physikerin hingegen, die niemals forscht, dafür aber den Staat führt, liegt man zu Füßen. Auch das ist autoritärer Charakter.Die mögliche Schwächung des bundesdeutschen Föderalismus verdient in diesen Zeiten besondere Aufmerksamkeit. Im verfassungsrechtlichen Sinn kann man von einer Schwächung gar nicht sprechen, auf den ersten Blick jedenfalls nicht. Denn wir lesen im Grundgesetz, dass Gesundheitsfragen in der „konkurrierenden Gesetzgebung“ geregelt werden. Das heißt, sowohl die bundesstaatliche Zentrale als auch die Bundesländer können die Gesetzgebung an sich ziehen. Im Konfliktfall hat die Zentrale den Primat. Einen solchen Konflikt bauen Merkel und Söder jetzt auf. Das Infektionsschutzgesetz ist in allen Versionen, die es bisher gab, von der Zentrale erlassen worden, also vom Bundestag unter Mitarbeit der Bundesregierung. Im Gesetz selbst aber wird den Ländern ein Spielraum der Ausführung eingeräumt. Wenn die Zentrale ihn einkassieren will, kann sie das tun. Merkel und Söder wollen ihn nicht einkassieren, aber einengen. Das Gesetz soll in dem Sinn präzisiert werden, dass Ländermaßnahmen, die der Kanzlerin nicht gefallen, nicht mehr möglich sind. Der Fall ist in der Verfassung vorgesehen, also wäre, wenn sie sich durchsetzen, am Föderalismus verfassungsrechtlich gar nichts geändert.Auf den ersten Blick allerdings nur. Denn es ist auch geregelt, dass die Zentrale von ihrem Primat nur unter bestimmten Umständen Gebrauch machen, sprich eine Sache qua Bundesgesetz regeln darf. So muss, wo es um jene Krankheiten geht, argumentiert werden können, dass sich „gleichwertige Lebensverhältnisse“ in allen Bundesländern anders nicht erreichen lassen. In früheren Fassungen des Grundgesetzes war von „einheitlichen“ Lebensverhältnissen die Rede gewesen, man erkannte dann, dass diese Formulierung für eine Bundesrepublik schon zu zentralistisch war. Wer auf den Unterschied von „einheitlich“ und „gleichwertig“ Wert legt, will offenbar betonen, dass ein und dasselbe Niveau von Lebensverhältnissen auf verschiedenen Wegen erreicht werden kann. Genau das war im Infektionsschutzgesetz immer vorgesehen.Nun geht es in diesem Gesetz um „Lebensverhältnisse“ im buchstäblichsten Sinn, um Leben und Tod nämlich. Soll man sagen, je mehr das so sei, desto weniger sollten verschiedene Wege zugelassen werden? Nein, das wäre ganz verrückt. Denn gerade wo es um Leben und Tod geht, ist es am wichtigsten, dass die besten Lösungen gefunden werden und zur Anwendung kommen. Dem dient es, wenn die Glieder des Bundes ihren Spielraum behalten. Aus zwei Gründen. Zum einen sind die Bundesländer näher am Geschehen als die Zentrale. Zum anderen können sie experimentieren; man wird sehen, wo der Erfolg am größten ist. Gerade wenn es um eine Gefahr geht, die noch nicht hinreichend erforscht sein kann, während sie sich schon dramatisch entfaltet, sollte auf so ein Verfahren nicht verzichtet werden. So ein Verzicht mag sich auf die Buchstaben des Verfassungsrechts berufen, in der Sache ist er antiföderal, mit dem „Geist“ einer Bundesrepublik nicht vereinbar.Nehmen wir das Beispiel der nächtlichen Ausgangssperre. Merkel hält sie für notwendig. Aber es gibt Studien, die dagegensprechen. Wenn gewisse andere Maßnahmen ergriffen würden, wie die Begrenzung der Personenzahl eines Treffens, sei die Ausgangssperre verzichtbar, sagen sie. Auch werde die Sperre umgangen, indem sich viele Leute dann eben vorher treffen, etwa schon zwischen 18 und 20 Uhr zum Abendessen. Wie kann es da produktiv sein, zentralstaatliche Regeln zu erlassen? Wer das tut, gaukelt ein Wissen vor, das nicht existiert.Die Gefahr ist so groß und so wenig beherrscht, dass das Regieren schlechthin an seine Grenzen kommt. Die Bevölkerung merkt das, deshalb kommt es zum „Autoritäts- und Vertrauensverlust“. Das dürfte der tiefste Punkt sein. Zunächst sehen wir nur die Verluste der Unionsparteien, über die man schon wirklich erschrickt, selbst wenn man mit ihnen nicht sympathisiert. Von 36 Prozent im Januar auf 27 Prozent im März, ist das nicht erschreckend? Aber nicht nur die Unionsparteien implodieren, es geschieht weit mehr. Wir sind auch nicht nur Zeugen des Niedergangs am Ende einer langen Kanzlerschaft; Merkel ist ein ganz anderer Fall als Konrad Adenauer oder Helmut Kohl. Um zu verstehen, was gerade geschieht, wird dieser Vergleich helfen.Merkel hatte keine AufgabeAdenauer und Kohl waren erfolgreiche Kanzler, die erreicht haben, was man von ihnen erwartete: ökonomisch die „soziale Marktwirtschaft“, sprich den weithin erschwinglichen Konsumismus für jedermann, und deren neoliberale Überarbeitung; politisch die Rolle des vorgeschobenen Postens der NATO. Adenauer akzeptierte sie, um die Wiedervereinigung zu erreichen, Kohl führte das aus. Beide konnten am Ende von ihrer persönlichen Macht nicht lassen, verhinderten den Erfolg ihrer designierten Nachfolger (Ludwig Erhard, Wolfgang Schäuble). Daher kam beide Male die SPD für kürzere Zeit ans Ruder und sorgte für gewisse notwendige Korrekturen, die am grundsätzlichen Weg der Bundesrepublik nichts änderten. Als dann Merkel kam, hatte sie keine große Aufgabe mehr. Ihre Aufgabe war nur noch, das Bestehende zu verwalten. Durch zwei große Einzelentscheidungen sticht sie hervor, einmal den Ausstieg aus der Atomenergie als Reaktion auf Fukushima, zum anderen den Einlass des großen Flüchtlingstrecks 2015. Bezeichnenderweise waren das Entscheidungen, die vom politischen Inhalt her genauso gut ein SPD-Kanzler hätte treffen können. Der Gegensatz der „Volksparteien“, CDU/CSU und SPD, der die alte Bundesrepublik geprägt hatte, war nach 1990 verbraucht. In Merkels Ära waren sie faktisch nur noch zwei Flügel derselben Partei.Aber auch das geht jetzt zu Ende. Es wird erfahrbar, dass Union und SPD für die Bewältigung zweier Gefahren einfach nicht geschaffen sind: der ökologischen und der Corona-Krise. Um der ökologischen Krise zu begegnen, müssten der Konsumismus und seine Quelle in der Kapitallogik gebändigt werden. Er war aber das Lebenselixier der alten Bundesrepublik. Die ökologische Aufgabe überfordert das alte Parteiensystem, deshalb zeichnet sich seit 2018 sein Ende ab. Während die SPD zu diesem Zeitpunkt längst schwächelte, gab es nun erste Umfragen, in denen die Grünen auch die Union überholten. Durch Corona wurde ihr Aufstieg zwischenzeitlich gestoppt.Dass eine Pandemie politisch rechtes Denken fördert, ist nicht verwunderlich. Vor Ansteckung warnen war schon immer Unionsstil. Adenauer warnte vor dem Untergang Deutschlands, falls Sozialdemokraten regierten, weil sie sich von kommunistischen Gedanken anstecken ließen. Heute ist Ansteckung durchs Coronavirus real. Diese Realität schien den rechten Diskurs mehr zu bewahrheiten als den linken – bis sich die Unfähigkeit der Union zeigte. Die ungebrochene „Inzidenz“ scheint nun die Bevölkerung an die noch gefährlichere ökologische Krise zu erinnern. Und so sind die Grünen wieder auf der Überholspur.In dieser Gesamtsituation ist Merkel immer noch Deutschlands beliebteste Politikerin. Dass ihre Kanzlerinnenschaft endet, hat sie schon lange angekündigt. Gerade deshalb ist sie stark. Innovationen in der Lösung von Problemen traut ihr zwar niemand zu, aber dass sie in deren Verwaltung geübt ist, erscheint in diesen Monaten wie ein rettender Anker.Wahrscheinlich würde die Union ihre Macht nur dann nicht verlieren, wenn Merkel doch noch einmal anträte. Mit Söder oder Laschet hat sie kaum Chancen, da die beiden zu sehr mit der Spaltung korrelieren, die sich in der Bevölkerung zunehmend festigt – alle sind unzufrieden, die einen aber deshalb, weil ihnen die Corona-Maßnahmen zu lasch, die anderen, weil sie ihnen nicht lasch genug sind. Aber Merkel ist nicht wirklich ein Anker. Deutschland braucht keine autoritäre Führerin, sondern Autorität für bewährte grundgesetzliche Verfahren.
×
Artikel verschenken
Mit einem Digital-Abo des Freitag können Sie pro Monat fünf Artikel verschenken. Die Texte sind für die Beschenkten kostenlos. Mehr Infos erhalten Sie hier.
Aktuell sind Sie nicht eingeloggt. Wenn Sie diesen Artikel verschenken wollen, müssen Sie sich entweder einloggen oder ein Digital-Abo abschließen.