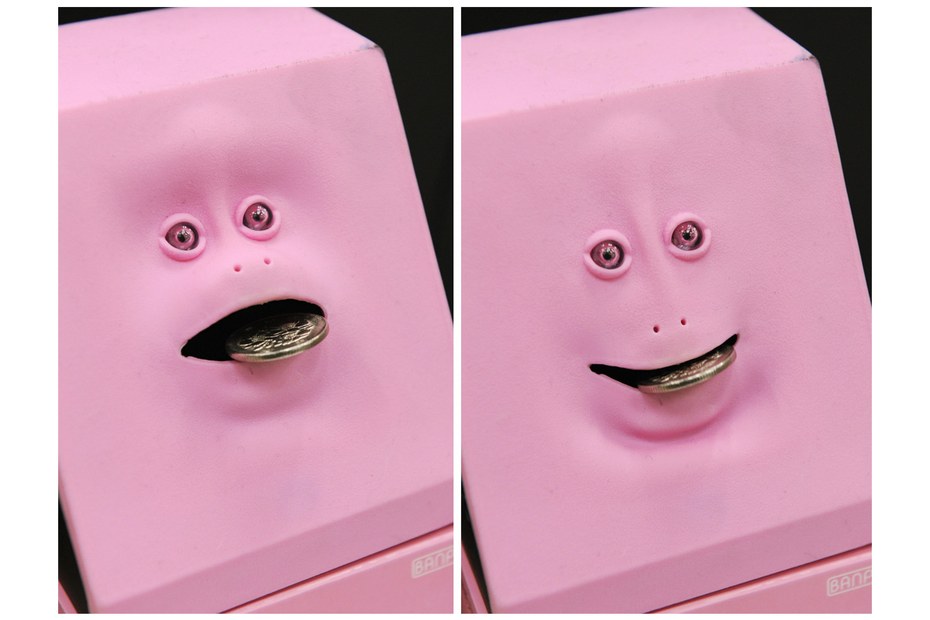In Deutschland ist Ökonomie Glaubenssache. Es geht um Moral, um Gut und Böse. Statt von Kapitalismus redet man lieber von „der Marktwirtschaft“. Alles, was mit Geld, Kredit, Banken und Finanzmärkten zu tun hat, gilt hierzulande als anrüchig. Über allem steht unumstößlich der Glaube, dass Schulden schlimm, Staatsschulden das ökonomische Erzübel schlechthin sind.
In Deutschland hat der Sparzwang nun seit zehn Jahren Verfassungsrang. 2009 wurde die Schuldenbremse von Bundestag und Bundesrat mit Zweidrittelmehrheit beschlossen, seither ziert den Artikel 109, Absatz 3 des Grundgesetzes das Verbot, die jährliche Nettokreditaufnahme des Bundes über 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu steigern. In Kraft trat sie im Bundeshaush
undeshaushalt mit dem Haushaltsjahr 2011. Erste Länder zogen nach: Seit Januar 2014 gilt die Schuldenbremse in Sachsen, seit 2019 in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern, die Länderhaushalte von Bayern, Bremen, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein folgen ab 2020, wenn die Schuldenbremse verbindlich wird. Die letzten Abweichler vom ökonomischen Tugendpfad sitzen noch in Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, dem Saarland und Thüringen; in Niedersachsen wurde Ende März ein entsprechender Gesetzesentwurf eingebracht.Wäre es nach Merkel gegangen, würden nicht nur die deutschen Bundesländer, sondern auch die Länder der Eurozone mit Hilfe von Schuldenbremsen längst zur Tugend verdonnert. Derzeit teilen sich die Schweiz und Deutschland den traurigen Ruhm, Musterländer des Neoliberalismus zu sein. Die Idee ist alt, neoliberale Ökonomen haben sie seit Jahr und Tag gepredigt: Die einzig richtige und alleinseligmachende Wirtschafts- und Finanzpolitik muss in der Verfassung verankert werden. Nur so können wankelmütige Politiker daran gehindert werden, auf Druck der vielen begehrlichen Wähler den Staat zu Verschwendung und überflüssigen Sozialausgaben zu treiben. Gerade in der fixen Idee eines Verfassungsartikels zur Schuldenbegrenzung zeigt sich also der antidemokratische Kern der neoliberalen Ideologie: Wählern und Parteipolitikern sei nicht zu trauen. Die Österreicher scheinen das gemerkt zu haben, denn sie haben den Versuch der Schwarz-Blauen, eine Schuldenbremse nach deutschem Vorbild einzuführen, schon 2017 vereitelt. Auch in der EU sind ähnliche Versuche bereits gescheitert. Was Merkel und ihren Finanzminister nicht hinderte, den Sparzwang durch die Hintertür des Fiskalpakts wieder einzuschleppen.Märchen zum FürchtenWer in Deutschland an der Schuldenbremse zu zweifeln wagt, durfte bislang mit wütender Gegenwehr rechnen. Hierzulande glaubt man mit Inbrunst an ökonomische Märchen: Erstens an das Märchen, die Weltfinanzkrise von 2007/2008 sei eine Folge zu hoher Staatsverschuldung gewesen. Tatsächlich ist die Staatsverschuldung in allen Krisenländern erst nach Ausbruch der Krise gestiegen, und zwar dank massiver Bankenrettungsaktionen. Zweitens glaubt man das uralte Märchen, Staatsschulden führten in jedem Fall zur Hyperinflation. Was nur in wenigen, sehr speziellen Fällen zutraf und -trifft.Am wirksamsten jedoch ist das Märchen, Staatsschulden belasteten zukünftige Generationen und seien daher ungerecht. Seit der Erfindung der „ewigen Staatsschuld“ vor ein paar Jahrhunderten ist das nicht mehr so. Eine Belastung für die zukünftigen Generationen kommt durch Fehlinvestitionen und, vor allem: fehlende Investitionen des Staates zustande – die Art der Finanzierung spielt dabei nur eine geringe Rolle. Die Enkel, die mit verotteten, veralteten oder nicht vorhandenen Infrastrukturen und chronisch unterbesetzten oder unterbezahlten öffentlichen Diensten leben müssen, haben an schwarzen Nullen wenig Freude.Als die Schuldenbremse eingeführt wurden, betrugen die deutschen Staatsschulden über 80 Prozent des BIP, mit steigender Tendenz. Inzwischen sind dank Niedrigst- und Nullzinsen für deutsche Staatsanleihen und sprudelnden Steuereinnahmen die Schulden des Bundes und der Länder gesunken. In diesem Jahr werden sie wohl unter der 60 Prozent-Marke des Maastricht-Vertrags landen. Vor diesem Hintergrund erscheint die Schuldenbremse fast als Erfolg – genau so lange, wie der inzwischen eklatante Mangel an öffentlichen Investitionen in Deutschland noch übersehen wird.Doch kaum zu glauben, aber wahr: Auch in Deutschland regt sich langsam leiser Widerspruch gegen das bestgeglaubte aller ökonomischen Dogmen. Etwa von Michael Hüther. Der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft zu Köln – linker Ideen wohl gänzlich unverdächtig – empfindet die „Verteufelung der Schulden“ als nicht mehr „zeitgemäß“, wie er es in einem 32-seitigen Papier Ende März formulierte. Hüther plädiert darin für eine „innovations- und wachstumspolitische Öffnung der Schuldenbremse.“ Der Grund für den Sinneswandel: Im Moment schrumpfen dank der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank die deutschen Staatsschulden von selbst, denn die Zinsen auf deutsche Staatsanleihen liegen unter der Wachstumsrate des BIP. Gleichzeitig gibt es einen unübersehbaren Investitionsbedarf im gesamten öffentlichen Sektor. Wenn man der Stagnation ohne massive Steuererhöhungen entkommen will, muss die Schuldenbremse ganz gehörig gelockert werden. Die Grenze von 0,35 Prozent des BIP, die laut dem Grundgesetz für jedes strukturelle Defizit des Bundes gelten soll, muss erhöht werden – und ebenso müssen die entsprechenden Bestimmungen in den Länderverfassungen geändert werden. Die Bundesrepublik braucht in der gegenwärtigen Periode des rasanten technologischen Wandels also massive Zukunftsinvestitionen, die im Moment leicht per Kredit zu finanzieren sind.Beengtes DenkenDas ist noch kein Abschied von der Denkweise, die uns die Schuldenbremse beschert hat. Aber ein erster Schritt in die richtige Richtung. Eine ganze Reihe konservativer Ökonomen sehen die Schuldenbremse inzwischen als übertrieben starr an, einige wenige wissen oder ahnen, dass es mit der wissenschaftlichen Begründung für Obergrenzen beim Schuldenstand und beim Defizit nicht weit her ist. Sie engt aber den Entscheidungsspielraum von Regierung und Parlament ein – ganz im Sinne der Erfinder. Selbst Finanzminister Olaf Scholz sieht sich in der Bundestagsfraktion der SPD heute einer wachsenden Zahl von Dissidenten konfrontiert, die die Weisheit der schwarzen Null und einer Schuldenbremse zu bezweifeln wagen. Warum, so fragen viele in der SPD, können wir nicht zu der guten alten „Goldenen Regel“ zurückkehren, die jahrzehntelang galt, bevor der neoliberale Furor über die Bundesdeutschen kam? Nach dieser Regel soll sich die Höhe der staatlichen Nettokreditaufnahme nach dem Volumen der öffentlichen Investitionen richten. Da richtig geplante und eingesetzte öffentliche Investitionen das ökonomische Wachstum stimulieren und stabilisieren, ist Verzinsung und Rückzahlung solcher Schulden unproblematisch – und von einer ungerechten Belastung kommender Generationen kann keine Rede sein. Fragt sich nur, ob die Politikergeneration, die im neoliberalen Gedankenkäfig aufgewachsen ist, dem noch entkommen kann.