Ein überaus beliebtes Format im deutschen Blätterwald ist das Pro und Contra, bei dem zwei gegensätzliche Meinungen zum selben Thema einander gegenübergestellt werden. Aber was spricht eigentlich dafür? Und was dagegen? Höchste Zeit für ein Pro und Contra.
Pro Eine offene Gesellschaft muss eine Pluralität von Meinungen aushalten können. Das betrifft auch Meinungen, die nicht miteinander vereinbar sind. Das journalistische Format des Pro und Contra erlaubt es mir, meine Meinung pointiert zu vertreten. Die agonale Situation des Duells mit Wörtern zwingt mich dabei nicht nur zur besonderen Prüfung meiner Argumentation, sondern auch zu ihrer Zuspitzung. Bei der Verteidigung meines Standpunktes kann ich mein Argumentationsgeschick unter Beweis stellen. Und Haltung demonstrieren. Seien wir doch einmal ehrlich, fehlt es heute nicht gerade an Letzterem? An Menschen, die nicht immer „Jein“ sagen, sondern klare Kante zeigen? Dafür oder dagegen, ja oder nein, richtig oder falsch und nicht von allem ein bisschen? An Menschen, die Konflikten nicht aus dem Weg gehen, sondern sagen, was Sache ist, auch wenn sie dafür Contra kriegen? Für Überzeugungen einzustehen, anstatt lethargisch in der Ecke zu sitzen und ein laues „Kann sein, aber kann auch nicht sein“ vor sich hin zu murmeln, sollte doch das Ideal sein in einer pluralistischen Gesellschaft. Die ist schließlich kein Ponyhof. Intellektuelle Zweikämpfe in den Medien schärfen nicht nur das Bewusstsein dafür, dass es Überzeugungen gibt, für die man mit aller argumentativen Macht einstehen sollte. Sie demonstrieren auch, dass Menschen zwar gleich sein sollten darin, eine Meinung haben zu dürfen, diese Meinung aber nicht die gleiche sein muss. Und es auch nicht sein sollte. Mladen Gladić
Contra Die journalistische Behandlung eines Themas als Pro und Contra gaukelt vor, das sich alles in ein Zweierschema pressen lässt, egal wie kompliziert es ist: dafür oder dagegen, gut oder schlecht, schwarz oder weiß. Die Übersimplifizierung, die sich aus dieser Zuspitzung auf nur zwei Positionen ergibt, ähnelt dabei auffällig den Vereinfachungen, mit denen Populisten arbeiten. Deren Parteien und Gruppen heißen nicht umsonst „Alternative für Deutschland“ oder „Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes“. Auch nicht umsonst findet sich bei AfD & Co. die agonale Logik der Freund-Feind-Unterscheidung, die sich auch im journalistischen Wortduell beobachten lässt. Schlimmer ist aber, dass das Schema es gleichzeitig so erscheinen lässt, als ob es für jede Frage mindestens zwei Antworten gäbe, die gleichberechtigt nebeneinanderstehen können. Warum würde man denn sonst zwei unterschiedliche Ansichten zum gleichen Thema abdrucken? Man befördert damit einen Relativismus, der letztlich alles zur Meinung erklärt. So ähnlich hat es jedenfalls der Philosoph Daniel-Pascal Zorn neulich formuliert. Und er hat recht: Statt ernsthaft darauf abzuzielen, die Antwort auf ein Problem zu finden, bleibt es beim Pro und Contra letztlich bei einem lauen „Ich sehe das zwar anders, aber“. Das ist bei vielen Fragen relativ ungefährlich, wenn es etwa darum geht, ob Oasis oder Blur die bessere Britpop-Band war. Oder ob Oliver Kahn oder Manuel Neuer der bessere Keeper. Aber die Gesellschaft ist kein Fußballplatz und auch keine Disko. Eine „Ich bin okay, du bist okay“-Haltung die jede Meinung gleich viel gelten lässt, ist in der politischen Auseinandersetzung pures Gift. Die, die Meinungsfreiheit letztendlich mit Füßen treten, werden das für sich nutzen. Mladen Gladić
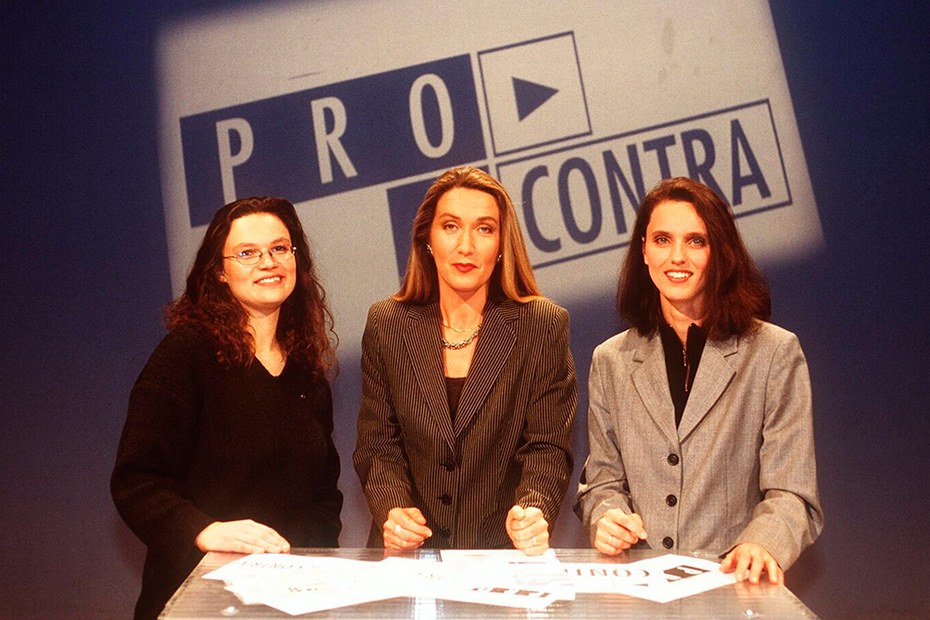






Was ist Ihre Meinung?
Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.