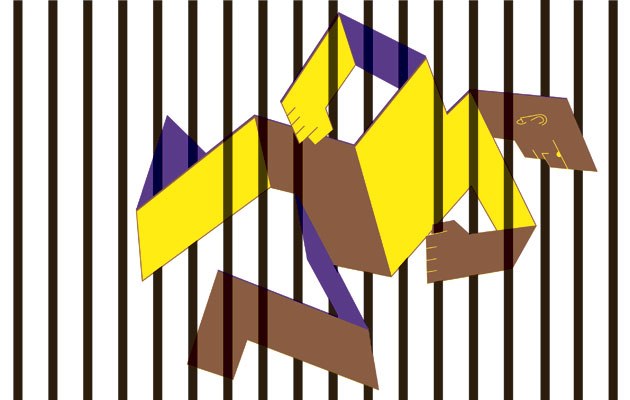Der Berliner Bezirk Neukölln wird gerne als vermeintlicher Mikrokosmos für die Probleme in dieser Republik herangezogen. Das Viertel gilt vielen als die erste Adresse, wenn es darum gehen soll, gesellschaftliche Misstände möglichst plastisch anzuprangern. Im Freitag hat dies zuletzt der Buchautor und Sozialarbeiter Fadi Saad getan.
Er war in Neukölln Sozialarbeiter und behauptet auch deshalb zu wissen, wovon er spricht. Dennoch: Seine Beobachtungen sind vor dem Hintergrund kriminologischer Forschung aus mindestens zwei Jahrzehnten gerade nicht verallgemeinerbar. Insbesondere seine These, dass jugendliche Gewalttäter mit Haftstrafen wieder auf den richtigen Weg gebracht werden könnten, ist wissenschaftlich kaum zu halten.
Straftaten nehmen ab
Zutreffend weis
n, ist wissenschaftlich kaum zu halten. Straftaten nehmen abZutreffend weist Fadi Saad auf den seit über zehn Jahren anhaltenden Trend in der polizeilichen Kriminalstatistik hin: Die Anzahl der registrierten Straftaten von Jugendlichen und Heranwachsenden geht jedes Jahr weiter zurück. Dies gilt sowohl für Körperverletzungs- als auch für Tötungsdelikte. Im internationalen Vergleich der registrierten schweren Gewaltdelikte erweist sich Deutschland mit durchschnittlich 170 Taten pro 100.000 Einwohner ohnehin als eines der sichersten Länder der Erde.Aber natürlich ist Gewalt für das menschliche Zusammenleben immer ein Problem und offenkundig liegen in einigen Regionen, darunter die Stadtstaaten, die Gewaltraten deutlich höher als im Durchschnitt. Dabei versteht es sich von selbst, dass Wegschauen oder Kleinreden keine akzeptablen Reaktionen sein können. Auch wird niemand ernsthaft Gewalttaten pauschal mit einer problematischen jugendlichen Biografie entschuldigen wollen.Allerdings stellt sich schon die Frage, ob Haftstrafen – wie sie Fadi Saad im Interview fordert oder wie sie die Bundesregierung mit dem sogenannten Einstiegsarrest gegen den Rat der überwiegenden Zahl der Experten forciert – der richtige Weg sind, um die Gewaltkriminalität zu senken. Was nützt schließlich „hartes Durchgreifen“, wenn es danach genauso oder sogar schlimmer weitergeht?Hohe RückfallrateDass der Arrest wie auch die Jugendstrafe oft nicht die versprochene resozialisierende Wirkung erzielen, zeigt schon ein Blick in die Statistik: Vergleicht man die Rückfallraten zwischen den einzelnen Sanktionsformen, so disqualifiziert sich der Arrest mit einer Rückfallrate von über 60 Prozent innerhalb von drei Jahren zusammen mit der Jugendstrafe ohne Bewährung als die Negativspitze des gesamten strafrechtlichen Maßnahmenkatalogs. Danach folgt mit geringem Abstand die zur Bewährung ausgesetzte Jugendstrafe. Diese Rangfolge, aber auch der Umstand, dass nach ambulanten und sozialpädagogisch ausgestalteten Maßnahmen deutlich weniger Rückfälle ermittelt werden, lässt viele Experten und den Fachverband Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen seit vielen Jahren für eine Stärkung der ambulanten und sozialpädagogisch ausgestalteten Reaktionsformen eintreten. Die mit 35 Prozent geringsten Rückfallraten weisen schließlich die Verfahrenseinstellungen ohne jede förmliche Verurteilung („Diversion“) auf. Mit diesen Einstellungen werden gelegentlich Auflagen zur professionell begleiteten Schadenswiedergutmachung oder zum Besuch von sozialen Trainingsmaßnahmen verbunden.Soziale Bindung ist entscheidendFadi Saad berichtet von Jugendlichen, die ihm regelmäßig mit schweren Gewalttaten auffallen. Es gibt diese kleine Gruppe von Jugendlichen und Heranwachsenden, die über mehrere Jahre hinweg viele, auch schwere Straftaten begehen und deshalb als „Intensivtäter“ bezeichnet werden können. Die kriminologische Forschung der letzten 15 Jahre hat jedoch nachgewiesen, dass auch bei den meisten Intensivtätern Abbruchsprozesse mit Erreichen des 20. Lebensjahres einsetzen.Entscheidend für die erfolgreiche Abkehr von delinquenten Verhaltensweisen ist der Aufbau konformer sozialer Bindungen: in erster Linie in Form einer guten Partnerschaft und durch ein dauerhaftes und existenzsicherndes Beschäftigungsverhältnis.Ambulante Interventionen haben deshalb gegenüber jeder Inhaftierung, neben den geringeren Kosten, zwei Vorteile: Der Kontakt zu einem bekannten sozialen Umfeld bleibt möglich. Und der Einstieg in die für den Resozialisierungserfolg in hohem Maße gefährliche Gefängnissubkultur wird vermieden. Schule des VerbrechensDas Gefängnis wird nicht ohne Grund als die „Schule des Verbrechens“ bezeichnet. Wer dort einsitzt, verliert oft die verbliebenen, nicht straffälligen Freunde. Stattdessen ergibt sich ein bestenfalls solidarischer Kontakt mit anderen Gefangenen, die ihrerseits eine bis dahin von Kriminalität geprägte Biografie haben. Gewalt- und Drogenerfahrungen gehören für viele Jugendliche zum Alltag in den Vollzugsanstalten. Gegenseitig kann man sich dort leicht in der Ablehnung von Legalität und gesellschaftlichen Normen bestärken und vielleicht noch gleich Mitstreiter für die nächste Straftat nach der Entlassung finden. Ambulante sozialpädagogische Betreuung dagegen kann Menschen langfristig bei der Abgrenzung von delinquenten Gruppen unterstützen und ihnen helfen, den Kontakt zu einem konformen Umfeld zu stärken. Warum sollten einem prügelnden Jugendlichen ausgerechnet zwei Wochen Arrest auf dem Weg in ein gewaltfreies Leben weiterhelfen, wenn er anschließend in seinen unverändert problematischen Alltag entlassen und weiter „durch den Fernseher erzogen“ wird?Danach droht: EntlassungslochSozialpädagogische Angebote sind zweitens eine Reaktionsform, die nicht auf kurzfristigem Zwang basiert, sondern die als Angebot zum Dialog ein ziviles Miteinander (auch durchaus konsequent) vorlebt. Nur so kann es gelingen, die Sozialisationsdefizite, die sich bei „Intensivtätern“ zeigen, auszugleichen. Was passiert nämlich, wenn der Aufenthalt im Camp beendet oder die Haftstrafe abgesessen ist? Viele Jugendliche fallen in das sogenannte Entlassungsloch. Selbst wer sich gezielt von Straftaten fernhalten will, steht nämlich häufig vor einem großen Problem: Es fehlt die in der Haft allgegenwärtige Aufsichtsperson, die in der „totalen Institution“ Gefängnis den Tagesablauf oktroyiert und im Zweifel jeden Konflikt autoritär entscheidet. Die daraus resultierende Orientierungslosigkeit, auch in vermeintlich banalen Alltagssituationen, dürfte nicht selten der Grund für einen Rückfall in Gewalt und Aggression sein. Um den Sozialisationsprozess von Jugendlichen und Heranwachsenden stattdessen positiv zu beeinflussen, muss man ihnen immer wieder vermitteln, dass und wie die vielfältigen und unvorhersehbaren Konflikte des Alltags selbständig gelöst werden können. Empathie und Respekt müssen durch die Erwachsenen im Dialog vorgelebt werden. Wer Jugendliche jedoch auffordert, „den Arsch rauszubewegen“, statt sie respektvoll, aber dennoch bestimmt zu bitten, „den Raum zu verlassen“, kultiviert genau die Respektlosigkeit und Unnachgiebigkeit, die so oft der Nährboden für Rohheit und Gewalt sind.Immer neue KürzungenEs sind deshalb viel mehr engagierte Sozialpädagogen wie Fadi Saad nötig, um diesen individuellen Problemen zu begegnen und so die natürlich ablaufende Integration in die Gesellschaft zu begleiten und wenn möglich zu beschleunigen. Anders als es der mittlerweile populäre Buchautor und Talkshowgast Fadi Saad recht pauschal unterstellt, dürften dabei für die meisten seiner Kollegen Verdienstaussichten nicht die handlungsleitende Größe sein: Jährliche Mittelkürzungen in den kommunalen Haushalten provozieren gerade in der Jugendhilfe mehr denn je Überstunden und prekäre Arbeitsverhältnisse.In manchen Fällen schließlich wird die Haft nicht zu vermeiden sein, entweder weil die Betroffenen im Dialog über zu lange Zeit nicht zu erreichen oder weil ihre Straftaten für ein friedliches Zusammenleben zu gefährlich sind. Falsch ist es dann jedoch, die Inhaftierung als progressiven Schritt auf dem Weg zur Resozialisierung zu propagieren. Das Gefängnis bleibt eine Bankrotterklärung der Zivilgesellschaft, es mag vielleicht zunächst Sicherheit bringen – sozial integrieren kann es nicht.