"Die machen mit uns Bürgern, was Sie wollen." und analog ist es nicht nur zu Wahlkampfzeiten zu vernehmen, wenn mal wieder über die Politiker geschimpft und das eigene Verhalten dabei marginalisiert (ausgeblendet) wird.
Worauf lässt sich dieses Verhalten zurückführen und gibt es entsprechende Literatur, die erhellendes darüber zu sagen hat? Ja es gibt sie und es ist u.a. die immer noch oder wieder aktuelle Kritische Theorie (kritische Gesellschaftstheorie oder auch kritische Sozialphilosophie genannt), die über die marxistische Denkrichtung der Entfremdung durch ökonomische Faktoren hinaus (wiewohl auch diese Faktoren Einfluss ausüben) die in der Industriegesellschaft vorherrschenden Kräfte der "technischen Vernunft", "formalisierten Vernunft", "technischen Rationalität", "eindimensionales Denken" erfordern (generiert), wie sie laut den Denkern der Frankfurter Schule (FS) ihren Ausdruck im Positivismus und Pragmatismus erhält.
Sicher lässt sich auch diese Denkrichtung kritisieren, zumal sie utopistische Gesamtentwürfe erstellt und damit Fragen offen bleiben (müssen), die die Herrschaftsstrukturen selbst betrifft, die sich nicht nur aus der "technologischen Rationalität" oder "instrumentellen Vernunft" ableiten lässt.
Deshalb zur Auffrischung oder Erinnerung nun eine Textpassage, die einiges zum Verhalten der Wähler erklären kann:
"Neben dieser (a) instrumentalistischen Grundtendenz hat man der technischen Rationalität noch eine Reihe von anderen Merkmalen zugeschrieben: so (b) die Tendenz, vornehmlich quantitative Kategorien an die Wirklichkeit anzulegen und möglichst alle Phänomene und Sachverhalte unter formale Gesetzmäßigkeiten und quantifizierbare Regeln zu subsumieren. Das "Diktat der Quantifizierung" (Adorno) wird für die Kritischen Theoretiker in der Gegenwart an der mathematischen Logik und an übertriebenen Mathematisierungstendenzen in den einzelnen Wissenschaften offensichtlich oder etwa an Bemühungen, unbedingt quantitative Kriterien zur Arbeitsplatzbewertung festsetzen zu wollen (neue Taylorisierung), Freizeitverhalten durch das Vorschreiben von quantitativen Normen zu regulieren usw.
Die Tendenz zur Quantifizierung, Formalisierung und Rationalisierung (Ökonomisierung) der menschlichen Lebensbereiche hat zur Folge, das wesentliche qualitative Aspekte und Unterschiede im menschlichen Leben eingeebnet und Freiheitsspielräume eingeschränkt werden (was dem einen oder anderen gar als positives Element erscheint!).
Ein Gedanke, der in diesem Zusammenhang erwähnt werden muss, weil er in der Kritischen Theorie ein oft wiederholtes Denkmotiv darstellt, ist folgender: der moderne Mensch, der in der technologischen Rationalität (und konsumtiv abhängig) befangen ist, schafft auf der einen Seite immer neue Gesetzmäßigkeiten in der Natur und der Gesellschaft, weil er deren Phänomene kategorisieren, rationalisieren und damit beherrschbar machen will. Auf der anderen Seite erkennt er aber die von ihm selbst in die Natur und die Gesellschaft projizierten Gesetzmäßigkeiten nicht mehr als seine eigenen Denkprodukte (es gibt keine Alternativen), sondern er hält sie für von ihm unabhängige, unveränderliche Sachzwänge, denen er sich hilflos ausgeliefert sieht.
Dieser Gedanke verweist auf ein weiteres Kennzeichen jener instrumentell-technologischen Denkweise, deren Kritik im Philosophieren der Frankfurter Schule einen so zentralen Stellenwert einnimmt: (c) die resignative Inaktivität und den Konformismus gegenüber allem Bestehenden und Etablierten (also Denkweisen, Institutionen, Verhältnisse usw.).
An weiteren Merkmalen der technologischen Rationalität oder instrumentellen Vernunft heben die Philosophen der Kritischen Theorie hervor: (d) die Tendenz zur Stabilisierung der in der Gesellschaft gegebenen Macht- und Herrschaftsverhältnisse; (e) die Tendenz zur Unterdrückung von schöpferischer Spontaneität und von unreglementierten, spekulativ-kühnen Gedankenentwürfen, die über die eingefahrenen Denkbahnen hinausgehen (wie es aktuell z.B. notwendig wäre zum Aufbau einer neuen Verkehrsinfrastruktur); (f) die Unfähigkeit, gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Prozesse in ihrem Gesamtzusammenhang und historischen Kontext zu erkennen.
Der in der technologischen Rationalität befangene Mensch kann an solchen Prozessen angeblich immer nur isolierte Ereignisse und Aspekte sehen, er ist nicht dazu in der Lage, diese Prozesse in ihrer "Totalität" zu erfassen; (g) die Tendenz zur Standardisierung und Nivellierung der menschlichen Denkweisen, Bedürfnisse und Verhaltensweisen. Diese Tendenz wird durch die von der Reklame- und Konsumindustrie verbreiteten Stereotypen besonders gefördert sowie durch jene Normierung von Denk- und Verhaltensformen, die mit der Anpassung an die Zwänge der Rationalisierung und Mechanisierung im modernen Arbeitsprozess verbunden ist.
Als letztes Merkmal der technologischen Rationalität sei hier auch noch (h) die Tendenz genannt, (moralische, politische usw.) Wertentscheidungen aus dem Bereich des vernünftig Begründbaren auszuschließen und sie als Ergebnisse von irrationalen Entschlüssen hinzustellen. Gegen diese Tendenz wurde von den Kritischen Theoretikern der Vorwurf des Dezisionismus erhoben."
Zitat Ende.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nachtrag 30.08.2017
Kurzcharakteristik der Kritischen Theorie (KT) in der Einführung von Kurt Salmun als Zitate.
"a) Eine Kernannahme der KT, die als allgemeiner spekulativer Bezugsrahmen hinter den meisten Argumentationen ihrer Vertreter steht, ist eine Verdinglichungs- oder Entfremdungsthese. Diese These besagt in ihrer einfachsten Form ausgedrückt, dass die Gesellschaft und die Menschen nicht das sind, was sie ihrem Wesen oder ihren Möglichkeiten nach sein könnten. Sie sind ihrem Wesen bzw. ihren Möglichkeiten entfremdet. (...)
Fragt man nach den Ursachen des Entfremdungs- und Verdinglichungsphänomens, dass die Philosophen der KT immer wieder eindringlich beschrieben haben, wird man von Horkheimer, Adorno und Marcuse auf mehrere Faktoren verwiesen (nun als Aufzählung): die kapitalistischen Produktions- und Marktverhältnisse - "Warenfetischismus" -, der den Beziehungen der Menschen zu den Dingen und untereinander Warencharakter verleiht, d.h. sie zu unpersönlichen Mittel-Zweck-Verhältnissen und Nutzensbeziehungen macht, die extreme Arbeitsteilung im Produktionsprozess, die Mechanisierung des Arbeitsprozesses, die Bürokratisierung der Verwaltung, die Massenproduktion, die Reklame und Kulturindustrie, die Massenmedien usw. Der letzte Punkt wurde bereits eingangs unter
b) weiter ausgeführt.
c) Eine weitere Kernthese der KT ist die These vom Repressions- und Herrschaftscharakter der modernen, fortgeschrittenen Industriegesellschaft. Diese These besagt in ihrer allgemeinsten Fassung, dass die moderne, hochtechnisierte Industrie- und Wohlstandsgesellschaft ein umfassendes System von Unterdrückung und Herrschaft darstellt. Vor allem Marcuse hat diese These immer wieder nachdrücklich vertreten und sie u. a. aus der Kulturphilosophie und der Philosophie der Psychoanalyse von Sigmund Freud zu begründen versucht. Er übernimmt dabei von Freud die Auffassung, dass die bisherige gesellschaftliche und kulturelle Entwicklung der Menschheit nur aufgrund von permanenter Unterdrückung und Hemmung von menschlichen Triebbedürfnissen möglich war. (...)
Für unseren Zusammenhang ist nun bedeutsam, dass Marcuse über Freud hinausgehend die Ansicht vertritt, in allen bisherigen Gesellschaften sei jenes Maß an Triebunterdrückung und repressiver Triebmodifikation, das für das Fortbestehen der Menschheit unerlässlich war, noch um ein zusätzliches, unnotwendiges Maß an Unterdrückung verstärkt gewesen. Dieses unnotwendige Maß an Unterdrückung in der sozialen Entwicklungsgeschichte der Menschheit sei stets auf ungerechtfertigte Interessen und Institutionen von Herrschaft zurückzuführen gewesen. Auch für die moderne, fortgeschrittene Industriegesellschaft gilt in den Augen der Vertreter der KT, dass in ihr ein hohes Maß von unnotwendiger Unterdrückung und Herrschaft institutionalisiert sei (und ihr auch immanent ist!) (...)
Die Zwänge dieser technischenApparate (Strukturen), die oftmals gar nicht mehr als Zwänge empfunden werden, gehen soweit, dass sie die Menschen über die Suggestion von unechten Bedürfnissen und die Verinnerlichung von stereotypen Verhaltensformen bis in die Privatsphäre hinein beherrschen.
d) Im engen Zusammenhang mit der Repressions- und Herrschaftshypothese in der KT steht die These von der Manipulation der Bedürfnisse. Dieser These zufolge führen die Menschen in der modernen Konsum- und Wohlstandsgesellschaft, in der sie ihre geistigen und materiellen Bedürfnisse in einem Ausmaß wie nie zuvor befriedigen können, bloß subjektiv und oberflächlich gesehen ein zufriedenes Leben. Bei genauerer Betrachtung erweisen sich (aber) nahezu alle Bedürfnisse, deren Befriedigung unter den bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen Zufriedenheit und Glücksgefühle vermitteln, als falsche, repressive Bedürfnisse, weil sie den Fortbestand eines Lebens in Unfreiheit, harter Arbeit (prekäre dazu!) unnotwendiger Triebrepression nur verewigen. Sie werden den Menschen letzten Endes von den herrschenden Mächten (oder auch systemischen Ergebnissen) in dieser Gesellschaft suggeriert, die daran interessiert sind, den gesellschaftlichen Status quo aufrecht zu erhalten (und wer kann schon ernsthaft bestreiten wollen, dass das nicht vorzüglich gelingt).
e) Ein weiteres Hauptcharakteristikum der KT ist ein kritisch-revolutionärer Grundzug. Dieser Grundzug ergibt sich nicht zuletzt aus dem Anspruch der KT, die Alternative zur "traditionellen Theorie" zu sein, d.h. zu jener Denkweise und theoretischen Einstellung, die (mehr oder weniger) blind am Gegebenen orientiert ist. Aus diesem Anspruch heraus üben die Vertreter der KT scharfe Kritik an anderen philosophischen Richtungen, vor allem dem Positivismus und Pragmatismus, an etablierten wissenschaftlichen Denkformen und an der modernen Industriegesellschaft. (...)
Daraus ergibt sich dann im Rahmen der KT mehr oder weniger explizit die Forderung, diese Gesellschaft von Grund auf zu revolutionieren, d.h. nicht nur die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Organisationsformen zu verändern sondern auch das Denken (selbst), die Einstellungs- und Bedürfnisstruktur und sogar die die Sprache der darin lebenden Menschen.
f) Als weiteres Charakteristikum der KT sei hier die vieldiskutierte These von den erkenntnisleitenden Interessen in den wissenschaftlichen Forschungsprozessen genannt (explizit von Habermas, aber vorformuliert von Horkheimer in einem Aufsatz von 1937). Habermas unterscheidet drei Typen von Wissenschaften bzw. wissenschaftlichen Denkweisen: die empirisch-analytischen, die historisch-hermeneutischen und die systematischen Handlungswissenschaften. Diesen drei Wissenschaftstypen werden drei erkenntnisleitende Interessen zugeordnet, welche jeweils die Konstitution von Erkenntnissen und Theorien im Rahmen dieser Wissenschaften bestimmen. In der Reihenfolge der Aufzählung wären das technische Erkenntnisinteressen (Beherrschung der Natur), ein praktisches Erkenntnisinteresse, das ist ein Interesse, das die „Intersubjektivität“ handlungsorientierter Verständigung garantieren will und die systematischen Handlungswissenschaften (laut Habermas Ökonomie, Soziologie und Politik), verfolgen als kritische Sozialwissenschaften ein „emanzipatorisches Interesse“, d.h. sie zielen von vornherein darauf ab, den Menschen aus naturwüchsigen Zwängen zu befreien und ihn durch Selbstreflexion zur Mündigkeit zu verhelfen.
g) In seiner sog. Theorie des kommunikativen Handelns unterscheidet Habermas – in teilweiser Anknüpfung an die These von den erkenntnisleitenden Interessen – zwei grundsätzlich verschiedene Typen des Handelns: 1.) das erfolgsorientierte zweckrationale Handeln und 2.) das verständigungsorientierte kommunikative Handeln. Habermas möchte in Bezug auf das letztere gewisse Regeln herausarbeiten, die immer schon der Idee vernünftiger Rede zugrundelagen und die bei jeder Verständigungsbemühung als implizite Geltungsansprüche einer idealen Sprechsituation vorausgesetzt werden. Als solche Geltungsansprüche werden genannt: Verbindlichkeit, Wahrheit, Wahrhaftigkeit und Richtigkeit.
--> Daraus die Entwicklung einer allgemeinen Theorie der kommunikativen Kompetenz und Rationalität (zum Unterschied von der kognitiven- instrumentellen Rationalität), die einer kritischen Gesellschaftstheorie als normativer Maßstab zur Korrektur von Deformationen und „Pathologien“ in der modernen Lebenswelt dienen könnten“.
Text zur kritischen Theorie entnommen aus "Was ist Philosophie?" (UTB), herausgegeben von Kurt Salamun.
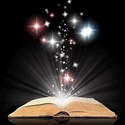




Was ist Ihre Meinung?
Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.