Die Zukunft der Arbeit wird uns mit rosigen Farben dargestellt, zumindest von den Arbeitgeberverbänden und Teilen der Exportindustrie. Die weitere Durchdringung der Arbeitswelt mittels digitaler Prozesse wird immer mehr Arbeitnehmern (AN) kleinere Entscheidungsspielräume zur Verfügung lassen (falls sie nicht gleich der Rationalisierung zum Opfer fallen), die zudem einer immer dichteren Überwachung unterliegt.
Denn die Algorithmen der sogenannten KI ermöglichen flexible Kontrollen jeglicher Art, die von den Betriebsräten (falls überhaupt vorhanden) über das Betriebsverfassungsgesetz nicht mehr adäquat begegnet werden kann (Mitbestimmung in Fragen der Verhaltens- und Leistungskontrolle).
Zudem taucht unvermeidlich auch mein "Lieblingsfeind" Amazon in dem Beitrag auf, denn wie nicht anders zu erwarten nutzt auch dieses Unternehmen eine Crowdwork-Plattform "Amazon Mechanical Turk".
Eine modernisierte Neuauflage der Taylorisierung beginnt!
Alles weitere in dem Beitrag "Wenn Computer bestimmen".
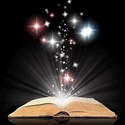




Was ist Ihre Meinung?
Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.