Mit dem Skandal um Harvey Weinstein nimmt im Herbst 2017 eine globale Debatte ihren Anfang. Unter dem Hashtag „#MeToo“ melden sich unzählige Frauen in den sozialen Medien zu Wort, die Opfer von Belästigungen, Übergriffen oder sogar Vergewaltigungen geworden sind.
Die Philosophin Svenja Flaßpöhler nimmt in der Diskussion eine umstrittene Position ein, sie sagt: „Abgesehen davon, dass die Auswüchse von #MeToo mit Rechtsstaatlichkeit nichts mehr zu tun haben, hat sich Feminismus in eine Opferrolle hineingetwittert, die so schlicht nicht mehr vorliegt.“ Mit ihrer 2018 veröffentlichten Streitschrift „Die potente Frau“ möchte sie Frauen zur Aktivität ermutigen, „nicht nur im Sexuellen, sondern aus dem Sexuellen auch ins Existenzielle, ins Berufliche hineinwirkend“.
Jakob Augstein diskutiert mit Svenja Flaßpöhler über den Stand des feministischen Diskurses im Jahr zwei nach #MeToo – über weibliche Selbstermächtigung, Geschlechtergleichheit und den Gender Pay Gap
Sie können unseren Podcast auch über Apple Podcasts, Spotify oder podcast.freitag.de abonnieren
Das Gespräch wurde im Rahmen des radioeins und Freitag Salon am 16. Dezember 2019 in der Berliner Volksbühne aufgezeichnet
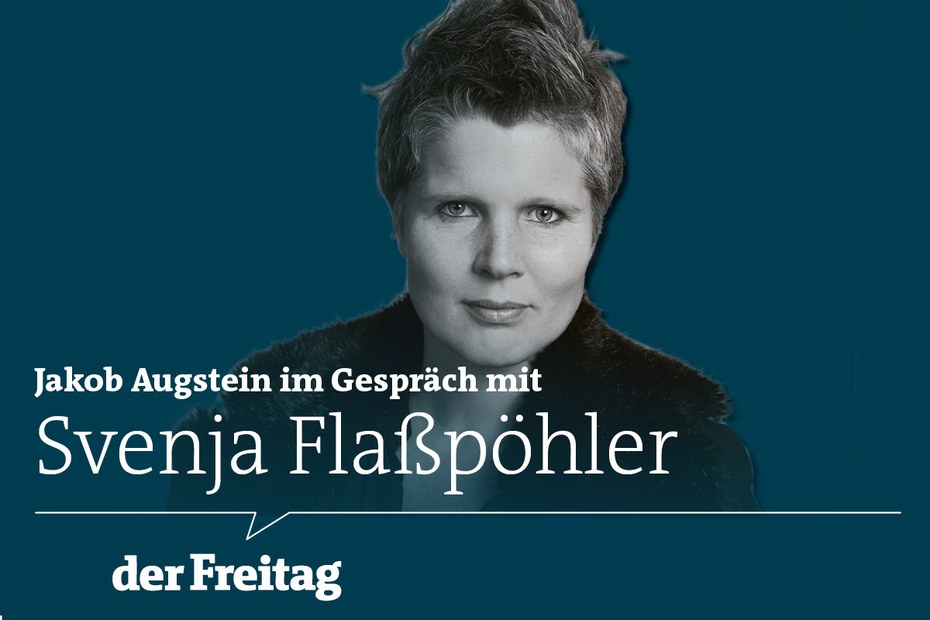






Was ist Ihre Meinung?
Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.